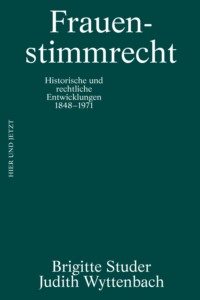Kitabı oku: «Frauenstimmrecht», sayfa 7
Eine kleine, organisierte Minderheit
Hauptträger des politischen Handelns für das Frauenstimmrecht war zwischen 1909 und 1971 der kontinuierlich aktive Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht (SVF), wohingegen sich die Gegnerinnen in wechselnden, meist ad hoc gebildeten Bündnissen organisierten.
Obschon zahlenmässig bedeutender als die gegnerischen Organisationen, handelte es sich beim SVF, auf dem im Folgenden der Fokus liegt, um einen relativ schwachen Kollektivakteur. Zur Zeit der Gründung der nationalen Organisation 1909 zählte er wie erwähnt 765 Mitglieder und sieben Sektionen, während der BSF 1904 33 Mitgliedervereine und 11 000 Frauen repräsentierte.139 Bis 1916 gab es mehr SVF-Sektionen in der Westschweiz, dann kehrte sich das Verhältnis um. 1950 konnte der Verband 33 Sektionen ausweisen.140 1959 hatte sich die Anzahl Mitglieder nach Jahren des Rückgangs auf 6056 und die Zahl der Sektionen auf 34 erhöht.141 In der Zeit zwischen 1934 und 1968 oszillierte die Mitgliederzahl zwischen 4000 und 6000.142 Der SVF war eine gemischte Organisation und zählte vor allem in den ersten zwei Jahrzehnten etliche männliche Mitglieder. Wohl um dem Vorwurf zuvorzukommen, sie seien vom Ausland gesteuert, nahm der Zentralvorstand nur Schweizerinnen auf, während auf lokaler Ebene vereinzelt auch Ausländerinnen aufgeführt sind. Die ersten Gruppen entstanden auf lokaler Ebene, meist aus einer Fusion zwischen philanthropischen und sittlichmoralischen Kreisen und dem progressiven Teil der frühen Frauenbewegung, je nach örtlichen Verhältnissen mit unterschiedlich starker Beteiligung von sozialdemokratischen und einzelnen bürgerlichliberalen, fortschrittlich eingestellten Politikern.
Männer als Feministen
Vor allem in den Anfangsjahren war der SVF durch eine starke Beteiligung der Männer charakterisiert – Männer, die sich aus weltanschaulichen Gründen politisch für die Rechte der Frauen einsetzten. Vor dem Zweiten Weltkrieg sassen im Zentralvorstand des SVF insgesamt neun männliche Mitglieder, darunter zwei SP-Nationalräte und ein FDP-Nationalrat, ein Zürcher Regierungsrat, ein Pfarrer und ein Professor. Nach 1945 sind im Zentralvorstand des SVF allerdings keine Männer mehr zu finden, obschon in den Sektionen durchaus noch Männer aktiv waren.143
Die Rolle der Männer in der ersten Zeit lässt sich beispielhaft an der 1907 gegründeten Genfer Sektion zeigen, einem Zusammenschluss zwischen religiös-sozialen, abolitionistischen Kreisen und der Union des femmes de Genève. Gründer der Association genevoise pour le suffrage féminin und im ersten lokalen Leitungskomitee Co-Vizepräsident (zusammen mit Camille Vidart) war der wie seine Mutter philanthropisch engagierte Genfer Ingenieur und Grossrat Auguste de Morsier (1864–1923). De Morsier war von 1909 bis 1912 auch erster Zentralpräsident des SVF. Männer bildeten im ersten Genfer Komitee mit vier Vertretern die Mehrheit. Neben de Morsier waren dies der sozialdemokratische Grossrat, Schriftsteller und Redaktor des Peuple genevois Valentin-Henri Grandjean (1872–1944), der aus Ungarn stammende Soziologe André de Maday (1877–1958), damals noch Privatdozent an der Universität Genf, später Professor an der Universität Neuenburg und ab 1924 Direktor der Bibliothek des Bureau International du Travail in Genf, der französische Sozialist und Professor für politische Ökonomie Edgard Milhaud (1873–1964) und ein näher nicht identifizierter Paul Robert als Kassier. 1910 kamen drei Frauen als neue Mitglieder hinzu: Emilie Gourd, die bald zur prägenden Figur des Stimmrechtskampfs mit transnationalem Netzwerk werden sollte, die Ehefrau von Grossrat Grandjean und die Ehefrau von André de Maday, Marthe de Maday-Henzelt, spätere Autorin von Studien über die Mutterliebe. Dazu kam Dr. Alexandre Claparède (1858–1913), früherer Grossrat, Naturwissenschaftler und Sekretär der Société des Arts de Genève. Die Funktion der Präsidentin fiel allerdings einer Frau zu: Aline Hoffmann-Rossier (1856–1920), Leiterin eines Mädchenpensionats und Schriftstellerin – auch sie dem Abolitionismus nahestehend. Als weitere Frau sass seit der Gründung Pauline Chaponnière-Chaix (1850–1934) in der Leitung.144
Auch in anderen Lokalsektionen war die Leitung in der Gründungszeit gemischtgeschlechtlich. Im ersten Komitee des Kantons Waadt sassen elf Frauen und vier Männer, in der Stadt Neuenburg zwölf Frauen und vier Männer, in La Chauxde-Fonds elf Frauen und sechs Männer. Auch in Zürich, wo sich bis zu ihrer Fusion 1919 zwei Organisationen Konkurrenz machten, sassen einige prominente Männer in den Leitungsausschüssen, so Emil Zürcher (1850–1926), freisinniger Nationalrat, Rechtsanwalt und Professor an der Universität Zürich, der bereits 1902 im Kantonsrat mehr Rechte für Frauen gefordert hatte.
Das Engagement der Männer für das Frauenstimmrecht zeigte sich auch in deren Vertretung an den nationalen Sitzungen. So kamen beispielsweise an die ausserordentliche Generalversammlung im Jahr 1918, nach dem Generalstreik, 34 Frauen und fünf Männer. Yvonne Voegeli hat die damaligen Wortmeldungen gezählt und kommt kritisch zum Schluss, dass sich die Männer unverhältnismässig oft äusserten: In der Debatte um das umstrittene Telegramm Gourds an den Bundesrat von 1918 und das weitere Vorgehen des Verbands meldeten sich zwölf Frauen insgesamt fünfzig Mal, die meisten unter ihnen führende Persönlichkeiten der schweizerischen Frauenbewegung, während die anderen 22 stumm blieben. Dagegen ergriffen alle fünf Männer zusammen 32 Mal das Wort.145
Zur Zeit der Lancierung der grossen Petition von 1929 figurierten drei Männer im 15-köpfigen Arbeitsausschuss: der Waadtländer Professor für Gynäkologie Maurice Muret (1863–1954), Robert Briner (1885–1960), promovierter Jurist, Präsident der Demokratischen Partei und Vorsteher des Zürcher kantonalen Jugendamts, und der Neuenburger Charles Schürch, ursprünglich Uhrenarbeiter, seit 1918 Westschweizer Zentralsekretär des SGB und seit 1920 Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamts. Auch im grossen Aktionskomitee, dem neben den Organisationsvertreterinnen auch 28 Mitglieder als Einzelpersonen angehörten, figurierten 26 prominente Männer: Darunter befanden sich 13 National- und Ständeräte (respektive Alt-National- und -Ständeräte), drei Regierungsräte, eine Anzahl Grossräte, ein Professor, zwei Chefredaktoren, mehrere hohe Staatsbeamte und Rechtsanwälte aus den Kantonen Bern, Zürich, Basel, Genf, Neuenburg, Tessin, Aargau, Schaffhausen, Luzern, Solothurn, Zug und Thurgau. Am stärksten vertreten waren die Sozialdemokraten – soweit zu eruieren ist – mit zwölf Personen, gefolgt von den Freisinnigen mit vier, den Liberaldemokraten mit zwei sowie einem Christlich-Sozialen und sogar einem Vertreter der BGB.146
Lokale Eliten
Die soziale Zusammensetzung der ersten lokalen Frauenstimmrechtsvereine war bürgerlich-elitär, zumindest was deren Leitungsorgane betrifft, wenngleich mit Ausnahmen. Die erwähnten Genferinnen und Genfer waren allesamt Vertreter des aufgeklärten Bildungs- und Finanzbürgertums, in der internationalen Stadt mit einer kosmopolitischen Färbung. Sie repräsentierten politisch sowohl liberale als auch sozialdemokratische Orientierungen, in einer Zeit, als die Abgrenzungen zwischen den beiden noch nicht so scharf gezogen waren wie dann nach dem Ersten Weltkrieg. Unter den Männern fanden sich vier Grossräte, einer zudem auch der Sohn eines Staatsrats, und zwei Akademiker, unter den Frauen die Witwe eines Bankiers, die jeweiligen Ehefrauen eines Pfarrers, eines Privatdozenten und eines Chefredaktors. Schliesslich gesellte sich mit Gourd eine ledige Frau aus dem protestantischen Genfer Grossbürgertum dazu. Ihr Vater war Philosophieprofessor an der Universität Genf. Die ausgebildete Lehrerin übernahm schon mit 28 Jahren das Sekretariat des BSF, 1911 für 35 Jahre das Präsidium der Genfer Sektion des SVF und ab 1914 für 14 Jahre dasjenige der schweizerischen Vereinigung. 1912 gründete sie mithilfe von Vidart und de Morsier die Zeitschrift Le Mouvement féministe, deren Redaktion sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1946 leitete.147 Gourd war in der Zwischenkriegszeit nicht nur eine führende Figur der Stimmrechtsbewegung in der Schweiz, als Sekretärin des Weltbundes für Frauenstimmrecht sicherte sie ab 1923 auch deren internationale Vernetzung.
Nicht zuletzt manifestierte sich die soziale Herkunft der Genfer Sektion in den gewählten politischen Aktionsformen: So organisierte die Sektion 1935, als der Besitz eines Automobils noch Vermögenden vorbehalten war, eine motorisierte Protestkundgebung. Näher bei den Geschlechternormen, doch habituell ebenfalls bürgerlich kodiert, lud sie bis 1943 regelmässig zu den «thés suffragistes» ein.148
Prominent akademisch besetzt war auch die Leitung des Zürcher Frauenstimmrechtsvereins mit seinen 157 Mitgliedern im November 1909, der bei seiner Gründung 1908 noch Akademischer Verein für Frauenstimmrecht geheissen hatte und 1919 mit der Union für Frauenbestrebungen fusionierte. Präsidentin war die Juristin, Lehrerin und erste Anwältin der Schweiz, Anna Mackenroth (1861–1936), die 1911 von Gilonne Brüstlein (1880–1933), ebenfalls einer promovierten Juristin und Anwältin, abgelöst wurde. Neben dem erwähnten Professor Emil Zürcher zählte der Vorstand auch Frauen, die selbst einen akademischen Titel trugen, wie die aus der Ukraine stammende Ärztin Betty Farbstein-Ostersetzer (1873–1938), die zwischen 1895 und 1909 mit dem SP-Politiker und Juristen David Farbstein verheiratet war, oder Mathilde Schneider-von Orelli (1883–1983), promovierte Naturwissenschaftlerin, deren Mann später eine Professur für Entomologie innehatte. Andere wie Sophie Glättli-Graf (1876–1951) waren mit bekannten Politikern verheiratet. Sie selbst hatte ihre Lehrerinnenausbildung nicht abgeschlossen, um ihren kranken Vater zu pflegen, während ihr Mann freisinniger Zürcher Staatsanwalt war.149
Auch die vier Männer im ersten Waadtländer Komitee waren Akademiker: Drei waren Ärzte (einer sass dazu als Liberaler im Grossen Rat) und einer Professor für Römisches Recht an der Universität Lausanne. Über die weiblichen Vorstandsmitglieder ist weniger bekannt. Die Gründerin und Präsidentin Antonia Girardet-Vielle (1866–1944) war die Witwe eines Architekten, die nach dem Tod ihres Mannes in ihrer grosszügigen Villa eine Pension für ausländische Studenten eröffnete, um den Lebensunterhalt für sich und ihre drei Kinder zu bestreiten. Lucie Dutoit (1868–1937), die Mitgründerin, Sekretärin und ab 1916 Präsidentin des Waadtländer Vereins, war Deutschlehrerin an der privaten École Vinet, der ersten Sekundarschule für Mädchen im Kanton Waadt. Dank ihrer Deutschkenntnisse sicherte sie zwischen 1924 und 1936 als Sekretärin und Übersetzerin des SVF den Kontakt zur deutschen Schweiz.150 Auch Eva Rouffy (1866–1961) war als diplomierte Hebamme eine ökonomisch selbstständige Frau. Sie war zudem Präsidentin der Société vaudoise des sages femmes und lebte seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrer Lebensgefährtin zusammen.151
In La Chaux-de-Fonds, der Stadt der Uhrenindustrie, war die soziale Zusammensetzung der lokalen Sektion des SVF stärker als anderswo von den Mittelschichten und Funktionären der Arbeiterbewegung geprägt, die nun in der sozialdemokratisch regierten Stadt die politisch-administrativen Eliten darstellten. Doch auch hier gehörte das bürgerliche Element (im sozialen Sinn) dazu, in bildungs- und unternehmensbürgerlicher Form.152 Die Initiantin und erste Präsidentin, Marie Courvoisier-Sandoz (1842–1921), nannte sich den Konventionen der französischen Oberschichten gemäss Madame James Courvoisier und stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie der Gegend. Ihr Mann war ein renommierter Pastor und einer der Gründer des lokalen Stimmrechtsvereins. Sie war sehr religiös, eine Veteranin der Sittlichkeitsbewegung, in der sie mit Émilie de Morsier (1843–1896) zusammengearbeitet hatte, der Mutter von Auguste de Morsier, der selbst 1908 mehrmals nach La Chaux-de-Fonds reiste, um die Gründung der lokalen Gruppe zu unterstützen. Ferner war sie im Internationalen Verein der Freundinnen junger Mädchen aktiv, der in Neuenburg seinen Sitz hatte. Ein weiteres prägendes Mitglied des ersten Komitees war Jeanne Vuilliomenet-Challandes (1870–1938), Tochter eines Patrons einer kleinen Uhrgehäusefabrik und eines Mitglieds der Freisinnigen Partei, die mit einem Kunstmaler verheiratet war. Sie ersetzte bald Marie Courvoisier als lokale Präsidentin, leitete zwischen 1914 und 1918 das nationale Sekretariat des SVF und hatte zwischen 1926 und 1932 in dessen Zentralvorstand Einsitz; anschliessend arbeitete sie als Journalistin. 1923 vertrat sie den SVF am 9. Internationalen Kongress der International Woman Suffrage Alliance in Rom. Ein weiteres Mitglied, Marie Wasserfallen-Ducommun (1868–1948), früher Lehrerin, war die Frau des Direktors der Primarschule in La Chaux-de-Fonds und Mutter von sechs Kindern. Die vierte Frau, über die Daten greifbar sind, war die Sozialdemokratin und frühere Lehrerin Blanche Graber (1878–1975), Tochter eines Pastors und Frau des prominenten sozialdemokratischen Politikers Ernest-Paul Graber (1875–1956), Redaktor, Grossrat und ab 1912 Nationalrat. Überhaupt waren im Komitee von La Chaux-de-Fonds Lehrerkreise stark vertreten. So war auch der Sozialdemokrat Henri-Justin Stauffer (1854–1935), der ab 1912 der städtischen Exekutive vorstand, Gymnasiallehrer, ebenso Adolphe Grosclaude (1880–1962), späterer Direktor des Gymnasiums. Letzterer gehörte zu den Gründern der Parti progressiste national, einer im Kanton Neuenburg als Reaktion auf den Generalstreik von 1918 gebildeten rechtsbürgerlichen Partei. Ferner sassen ein Bildhauer und Lehrer der Kunstgewerbeschule, ein Bijoutier und ein ehemaliger Gemeinderat im Komitee sowie der Gewerkschafter Charles Schürch, eine führende Persönlichkeit der sozialdemokratischen Partei des Kantons und erster Motionär für das Frauenstimmrecht im Grossen Rat.
Sittlich-soziales Engagement und Erwerbstätigkeit
Ein Blick auf die nationale Ebene zur Zeit des ersten Zentralvorstands nach der Gründung des SVF am 28. Januar 1909 verweist ebenfalls auf den gut situierten, elitären Charakter der Verbandsführung. Unter den sieben Vorstandsmitgliedern gilt dies jedenfalls für den Präsidenten Auguste de Morsier, die Vize-Präsidentin Klara Honegger (1860–1940), Tochter eines Zürcher Regierungsrats, die Sekretärin Antonia Girardet-Vielle und die Beisitzerin Marie Courvoisier.153 Ein weiteres markantes Charakteristikum der Gruppe ist das Gewicht des sozialen Engagements im Leben der Beteiligten. Neben de Morsier und Courvoisier hatten mindestens auch Klara Honegger und Louisa Thiébaud (1869–1940) durch ihr Engagement in der Sittlichkeitsbewegung erste politische Erfahrungen und waren sozialreformerisch tätig.
Eine spätere Momentaufnahme der acht Sektionspräsidentinnen, die 1959/60 einen Beitrag im Aktivitätsbericht des SVF über seine letzten 25 Jahre verfassten und über die Daten vorhanden sind, zeigt sowohl Elemente des Wandels als auch der Kontinuität in der soziokulturellen Zusammensetzung des SVF auf lokaler Ebene. Es handelte sich um die Präsidentinnen der Kantone Genf, Neuenburg, Waadt, Basel (Stadt und Land), Tessin, Zürich, Bern und Solothurn.154 Die Genfer Präsidentin Marcelle A. Prince-Koiré (1892–1975), in Batumi in Georgien geboren, war die Tochter eines russischen Reeders und einer Französin, die seit 1901 in der Schweiz lebte und im Ersten Weltkrieg als freiwillige Krankenpflegerin in Marseille im Einsatz gewesen war. Sie lebte in grossbürgerlichen Verhältnissen und engagierte sich nach 1960 in der Liberalen Partei. Die in Schaffhausen geborene Clara Waldvogel (1889–1972), Tochter eines Deutschlehrers des Collège latin in Neuenburg, war in derselben Stadt Lehrerin für Deutsch und Englisch an der Mädchensekundarschule, Pazifistin, Freundin des Gründers des Service Civil International Pierre Cérésole und Mitglied des Schweizerischen Frauen-Alpenclubs, der 1918 nach dem Ausschluss der Frauen aus dem SAC 1907 gegründet worden war. Auch ihr Bruder war ein pazifistischer Aktivist; er war Mitglied der Gruppe der antimilitaristischen Pastoren. Als Tochter eines Neuenburger Pastors und einer Schottin dürfte auch die Waadtländer Präsidentin und Anwältin Antoinette Quinche in einem Elternhaus mit hohen moralischen Ansprüchen an den Einzelnen und die Gesellschaft sozialisiert worden sein. Eine Prägung durch die Sittlichkeitsbewegung findet sich ferner bei der Basler Lehrerin Anneliese Villard-Traber (1913–2009), die ihren Mann – einen Dienstverweigerer – in der schweizerischen abstinenten Jugendbewegung kennengelernt hatte. Ein gemeinnütziges Engagement neben demjenigen für das Frauenstimmrecht prägt auch die Biografie von Marie Jäggi-Schitlowski (1904–1981), Tochter russischer Einwanderer, Fürsprecherin und mit einem Kunstmaler verheiratet, die nicht nur Vorstandsmitglied des Frauenstimmrechtsvereins Bern, sondern auch der Sektion Bern des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins war. Ihre Co-Präsidentin des Frauenstimmrechtsvereins Bern, Adrienne Gonzenbach-Schümperli (1900–1987), war als Lehrerin tätig. Seit den 1930er-Jahren war sie in der FDP engagiert, wo sie die lokale Frauensektion aufgebaut hatte. Die Tessinerin Alma Zeli-Bacciarini (1921–2007), die jüngste dieser Gruppe, war die Tochter eines Ingenieurs. Nach einem Studium der französischen und italienischen Literatur in Zürich und Genf wurde sie Mittelschullehrerin. Zwischen 1954 und 1963 war sie auch Vizepräsidentin des Schweizerischen Verbands. Nach Einführung des Frauenstimmrechts sass sie für die FDP im Grossen Rat und im Nationalrat.155 Die Zürcherin Erika Grendelmeier (1906–1988), ursprünglich Deutsche, Tochter eines Kaufmanns, war die Ehefrau des langjährigen LdU-Nationalrats und Anwalts Alois Grendelmeier. Sie präsidierte den Zürcher Frauenstimmrechtsverein von 1954 bis 1962. Als eine der wenigen Hausfrauen in der Leitung des Stimmrechtsvereins diente sie laut Gertrud Heinzelmann «als Aushängeschild zur Demonstration ‹normaler Weiblichkeit› in der Öffentlichkeit».156
Von den ledigen Lehrerinnen zu den verheirateten Juristinnen
Fragt man nach den Gemeinsamkeiten dieser Gruppe und nach dem, was sie spezifisch machte, fällt nicht nur auf, dass erstens mindestens die Hälfte der Frauen aus einem Pastorenhaus stammten respektive stark religiös oder sittlich-sozialreformerisch geprägt waren. Trotz der durch die Kleinheit des Samples beschränkten Aussagekraft manifestiert sich zweitens auch ein allmählicher Wandel des Berufsspektrums: Es figurierten nun zwei Juristinnen unter den Sektionspräsidentinnen; die Lehrerinnen mit vier Vertreterinnen überholten sie damit allerdings nicht. Zwei Frauen waren ferner nicht erwerbstätig, eine war Hausfrau, während die andere ihren Lebensverhältnissen entsprechend sehr wahrscheinlich Hauspersonal hatte. Festzustellen ist drittens eine Zunahme der verheirateten Frauen, die mit sechs Personen die Mehrheit gegenüber den ledigen bildeten. Für weltgewandte Milieus spricht viertens, dass – so weit aus den Quellen ersichtlich – vier der acht Frauen mindestens einen ausländischen Elternteil hatten, während bei einer weiteren Frau ein längerer Auslandsstudienaufenthalt in ihrer Jugend belegt werden kann. Fünftens ist die nun explizite Parteizugehörigkeit auch bürgerlicher Frauen zu erwähnen.
Späte Auflösung der protestantischen Dominanz und vermehrtes parteipolitisches Engagement
Betrachtet man die Präsidentinnen des SVF, bestätigt sich die elitäre Prägung der nationalen Leitungsebene auch über die Jahre. Von den neun Personen, die zwischen 1909 und 1971 dem SVF vorstanden, stammte nur die letzte aus einfachen Verhältnissen: Gertrude Girard-Montet (1913–1989), die 1968 das Präsidium des nationalen Verbands übernahm, war die Tochter eines Kaminfegers. Durch ihren Mann, Inhaber eines Malereigeschäfts, war sie in den gewerblichen Mittelstand aufgestiegen. Im Unterschied zu den anderen Präsidentinnen fehlte ihr hingegen ein akademisches Umfeld.157 Gertrud Heinzelmann (1914–1999), die das Präsidium 1959/60 nur kurz innehatte, kam aus einer mittelständischen Familie; ihr Vater war Kaufmann. Sie konnte, anders als Girard-Montet, jedoch studieren und arbeitete als promovierte Anwältin. Auch ihre Nachfolgerin von 1960 bis 1968, Lotti Ruckstuhl (1901–1988), war promovierte Anwältin, sie war jedoch bereits in einer akademischen Familie aufgewachsen. Sowohl ihr Vater wie auch ihr Ehemann waren Ärzte.158 Aus welchem sozialen Milieu die auf Auguste de Morsier folgende erste Präsidentin, Louise von Arx-Lack (1876–1945) stammte, ist unbekannt, doch heiratete sie einen Professor für deutsche und französische Sprache, der am Kantonalen Technikum von Winterthur lehrte. Politisch war sie wie de Morsiers Mutter in der Sittlichkeitsbewegung im Kampf gegen den Mädchenhandel aktiv gewesen. Sämtliche vier Präsidentinnen zwischen 1914 und 1959 hatten einen grossbürgerlichen respektive akademischen Familienhintergrund. Neben der erwähnten Emilie Gourd galt das für Annie Leuch-Reineck (1880–1978), die mit einem Bundesrichter verheiratet war und selbst ein Doktorat in Mathematik erworben hatte, sowie für Elisabeth Vischer-Alioth (1892–1963), Tochter eines Basler Maschinenfabrikanten und früh verwitwete Frau eines Juristen aus dem Basler «Daig». Vor ihrer Heirat hatte sie eine Ausbildung an der Sozialen Frauenschule in Berlin absolviert und nebenamtlich für die Pro Juventute gearbeitet.159 Alix Choisy-Necker (1902–1979) war die Tochter eines Genfer Bankiers und einer Patrizierin.
Von der Konfession her waren alle reformiert. Die Katholikin Lotti Ruckstuhl war eine Ausnahme. Ihre Wahl zur Präsidentin in den 1960er-Jahren zeigt, dass sich die dem Frauenstimmrecht positiv gesinnten Kreise ausgeweitet hatten. Dieses Faktum zeigte sich im Übrigen auch in der Zusammensetzung der 1957 gegründeten Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau, die unter ihren 38 Frauenorganisationen und 15 kantonalen Frauenzentralen drei parteipolitische Frauengruppen – der SP, des LdU und der FDP – sowie den der Katholisch-Konservativen Partei nahestehenden SKF zählten. Sowohl die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft, Hanni Schärer-Rohrer (1904–1979), Präsidentin der FDP-Frauengruppe Schweiz, als auch die beiden Vize-Präsidentinnen, die Agronomin Mascha Oettli (1908–1997) als Zentralsekretärin der SP sowie der Sozialdemokratischen Frauengruppen der Schweiz, und Lotti Ruckstuhl für den SKF vertraten eine politische Partei.160
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.