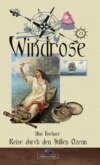Kitabı oku: «Reise durch den Stillen Ozean», sayfa 28
Unsere Mittagsstation war das Dorf Kalapama. Welch köstliche Wohlthat, als plötzlich die knirschende Lava aufhörte und ein weicher Grasboden die Hufe verstummen machte, als wir wieder vom Pferde springen durften, auf einer kühlen Veranda den erquickenden Knetkünsten der herbeigeeilten Mädchen uns preiszugeben und danach in einem brackischen Tümpel, welchen ein hoher natürlicher Deich aus Lavageröll von der draussen donnernden Brandung des Meeres abschloss, ein Bad zu nehmen, bis die unvermeidlichen Hühner gemordet, gerupft und gebraten waren.
Nach zwei Stunden gings abermals fort, abermals über Lava, glasharte, knirschende und kratzende Lava. Etliche Dörfer flogen vorüber. Denn in der Nähe menschlicher Wohnstätten kamen wir meistens auf eine wohlgeglättete Strasse, und unbekümmert um die holde Weiblichkeit, die uns zu sehen aus den Hütten trat, spornten wir die Pferde zur höchsten Eile, um die wenigen besseren Stückchen des Weges auszunützen.
Bergauf und bergab, bald dicht am Meere entlang, bald weiter innen durch Lavawüsten und Pandanusdickichte, führte uns der ermüdende Ritt. Ein seltsamer Begräbnissplatz stand unmittelbar am Rande des steilen Ufers, etwa sechs Leichenhügel aus Lavablöcken, deren glänzend weissgetünchte Umzäunungen eigenthümlich von der Schwärze der rauhen Umgebung abstachen. Es gab weit und breit nicht Humus genug zur Beerdigung. Donnernd prallten die Wogen gegen die Felswand unten, und die Brandung spritzte herauf bis zu der Stätte wo die Todten ruhten.
Ein mit Gras und Kukuigebüsch bewachsener Hügel erschien zur Linken, das Wahrzeichen unseres Zieles Kapoho, eine herzerfreuende Oase nach solcher 42 Meilen langen Lavawüstenei.
Mein Landsmann, Kapitän Eldart, kam uns entgegen und wies uns den Weg in sein gleich einer Burg mit Zyklopenmauern umgebenes Gehöft. Einige braune Burschen bemächtigten sich der Pferde. Wir selbst liessen uns sofort zum Baden führen.
Natürlich ist auch der nächste Hügel gleich hinter dem Gehöft ein alter Vulkan, in dessen Krater ein Teich sich angesammelt hat. Goldfische werden in ihm gezüchtet, und hie und da blitzte einer dieser glänzenden Bewohner des dunklen und stillen Grundes empor, als wir in sein kühles Wasser tauchten, den Schweiss des heissen Tages von den Gliedern zu spülen.
Die Umgebung Kapohos wird nach innen durch eine Reihe ganz mit Gras überzogener Hügel abgegrenzt, nach aussen gegen die See zu dehnt sich die einförmige Lavafläche mit ihrer dünnen Farnkrautdecke. Aussergewöhnlich schlanke Kokospalmen stehen gruppenweise zusammen, die Spitzen der Hügel sind mit dem eigenthümlichen Silberglanz der Kukuibüsche geziert.
Kapitän Eldarts Hauptbeschäftigung ist die Jagd auf die seit hundert Jahren verwilderten Rinder, die heerdenweise ringsherum leben und nur wegen ihres Talges und ihrer Häute geschossen werden. Ein gefährliches und verwegenes Handwerk, auf solchem Boden und zu Pferde diesen Thieren nachzustellen, oft genug auch von ihnen sich jagen zu lassen. Seit zwei Jahren lebt ein junger Verwandter aus Deutschland bei ihm als Gehilfe, ein ehemaliger Ulan, der mit in Frankreich gewesen und jetzt erst recht in seinem Elemente sich fühlt, da er so viele Gäule zu Schanden reiten kann als er mag. Ein nicht zu verachtender Nebensport scheint ihm die Verbesserung der Rasse im nächsten Dorf drüben zu sein.
Die Mischung germanischen und polynesischen Blutes giebt ganz prachtvolle Jungen. Kapitän Eldarts reizende Kinderschaar, die sich stetig dem Dutzend nähert, liefert ein nachahmungswürdiges Beispiel. Sein Aeltester ist ein ideal schöner Knabe im Style jenes jungen Italieners von Karl Becker. Gleichwohl fehlte es auch hier nicht an Symptomen der überall zu beobachtenden Thatsache, dass die Ehe eines Weissen ausserhalb seiner Rasse zu Missverhältnissen führt. Es schien mir, als ob mein Landsmann unser freundlicher Wirth sich seiner braunen Gattin schämte. Wir bekamen sie nicht zu Gesicht. Sie wohnte abseits in dem Haus für die Dienerschaft und blieb dort verborgen, solange wir in Kapoho weilten.
Am nächsten Morgen regnete es. Ab und zu kamen heftige Windstösse und bogen die schlanken Palmen und zausten an ihren Kronen, dass sie aussahen wie zerrissene und umgestülpte Regenschirme. Wir benützten deshalb unseren Rasttag nur zur Besichtigung der allernächsten Merkwürdigkeiten. Wir waren auch viel zu müde und steif um weit herumzulaufen.
Der junge Eldart führte uns zuerst auf einen Hügel zu den Ueberresten eines alten Heidentempels, von welchem gegenwärtig nur mehr einige sehr exakt gearbeitete Lava-Quaderblöcke vorhanden sind. Dann nahmen wir ein Bad in einem äusserst malerisch zwischen steilen Felsen gelegenen warmen Tümpel, »Wai wela wela« (Wasser warm warm) genannt. Farnkrautbüschel und Pandanen hängen von oben über die Wände der Schlucht herab. Das angenehm laue Wasser ist wunderbar blaugrün und so klar, dass man jedes Steinchen des Grundes sieht, obwohl er so tief ist, dass es keinem von uns gelang ihn tauchend zu erreichen. Eine Viertelstunde entfernt ist noch eine andere von den Mächten der Göttin Pele geheizte Badegelegenheit, welche wir am Nachmittag besuchten. Wir stiegen durch eine Kluft 20 Meter ins Innere der Erdkruste hinab, nachdem wir uns oben entkleidet und Stearinkerzen angezündet hatten. Dann nahm uns ein schmales Wasserbecken auf, etwas wärmer als jenes oberirdische Wai wela wela, in welches wir etwa 200 Schritt hineinschwammen, indem wir von Zeit zu Zeit Lichter an den Wänden befestigten. Man soll eine Meile weit hier unten fortschwimmen können.
Dies werden wohl die beiden »heissen Quellen« sein, welche auf Karten bei Kapoho angegeben sind. Ich habe sonst nichts dergleichen zu erfragen vermocht.
Auf dem Rückweg lernte ich eine sehr interessante Pflanze kennen, welche hier in Menge vorkommt und bei den Einwohnern englischer Sprache »Air Plant« heisst. Wenn man ein einziges Blatt davon mit einer Stecknadel am Fenster oder sonstwo anspiesst, so stirbt dasselbe ab, aus einer Stelle seines Randes aber wächst ein neues Pflänzchen hervor, dem das Gewebe des alten Blattes als nährender Boden dient.
Wir hatten Sonntag, und es war sehr öde und menschenleer in Kapitän Eldarts Ranch. Nur die Kinder und das Schiessen von Truthähnen und Hühnern für unseren Tisch, die sich sonst nicht so leicht hätten ergreifen lassen, gewährten einige Unterhaltung. Bier oder Schnaps gab es hier nicht, da diese Artikel im Hawaiischen Königreich überhaupt, ausgenommen in Honolulu, verboten sind. Hingegen besass der halbchinesische Diener unseres Wirthes eine Lizenz zur Bereitung und Verabreichung von Awa, welche monatlich 25 Cents kostet. Und da wir nichts Besseres wussten, liessen wir uns am Abend Awa vorsetzen. Wer dieselbe zurechtgekaut hatte, wurde uns diskreter Weise nicht verrathen. Die schmutzig graubräunliche Flüssigkeit, in Schoppengläsern kredenzt und ohne den romantischen Zauber der Yankonagelage auf Viti, machte mir keinen sehr verlockenden Eindruck. Aber getrunken wurde sie doch. Sie schmeckte ganz ähnlich der Yankona, nur etwas schärfer seifenartig und konzentrirter. Auch an der Pflanze, die man uns zeigte, konnte ich keinen Unterschied von dem Piper methysticum Kandavus wahrnehmen. Es stellten sich indessen bei vieren von uns sehr unangenehme Folgen in Form von Ergüssen aus beiden Enden des Tractus Alimentationis ein, welche uns einen erheblichen Theil der Nachtruhe raubten.
An demselben Abend ass ich zum ersten mal Brotfrucht. Auf Kandavu waren sie gerade nicht reif gewesen, und auch diese war nur ein kleines, faustgrosses Individuum. Sie wurde uns in gekochtem Zustand aufgetragen, ihr Geschmack ähnelte dem junger noch etwas seifiger Kartoffeln.
Die letzten 24 Meilen am folgenden Tag, die wir bis Hilo zurückzulegen hatten, waren nicht angenehmer als die vorhergegangenen. Während die anderen noch sattelten und packten ritt ich langsam voraus. Ich war eben an der Schule eines weiter abwärts gelegenen Dorfes angelangt, in welcher die Kinder gerade ihr Morgengebet beteten, da kam hinter mir Kapitän Eldart nachgejagt, um sich den Namen einer Arznei aufschreiben zu lassen, den ich ihm gestern gesagt, den er jedoch mittlerweile wieder vergessen hatte. Der Schulmeister, ein Kanaka, brachte Papier und Tinte heraus, mit ihm seine ganze kleine Heerde.
Je mehr wir uns Hilo näherten desto mehr hofften wir, der Weg möchte doch endlich einmal besser werden. Er blieb aber gleich niederträchtig bis zum Schluss. So wie die Wegmacherei im Hawaiischen Königreiche betrieben wird, ist es kein Wunder wenn die Wege schlecht sind. Es wird dem Einzelnen freigestellt, die Steuer dafür durch Arbeiten abzuverdienen, und dieser begnügt sich gewöhnlich damit, alle Monat ein Häufchen Erde zusammenzukratzen und auf den Weg zu schütten.
Die Pandanusdickichte wurden lichter und machten stellenweise einem dünnen Wald von Ohiabäumen Platz, an denen sich Kletterpflanzen mit schönen rothbraunen Blüthen emporrankten. Zuweilen liess sich die schnalzende Stimme eines Vogels vernehmen, das einzige mal dass ich derlei auf Hawaii hörte.
Durchnässt von Regen und Schweiss und übermüde des quälenden Knirschens der Lava sprangen wir frohlockend im Hotelgarten zu Hilo aus dem Sattel. Unsere Pferde hatten keine Eisen mehr, und wir selbst waren mehr oder weniger mit Blut gezeichnet.
XXI
VON HILO NACH HONOLULU
Eine seltsame Todtenfeier. Kapitän Spencer und seine Zuckersiederei. Der Kilauea kommt nicht. Ein hawaiisches Souper und Abschied von Hilo. Nächtliche Bootfahrt nach Kohala. Konflikt mit dem Sabath und abermals fort. Landung auf Maui. Ein interessanter Mann der Presse. Der Bäcker von Lahaina. Stürmisches Wetter. Endlich in Honolulu.
Von nun an fiel fast beständig Regen in Strömen herab, so dass wir grösstentheils zu Hause bleiben mussten.
Einige Weisse kamen uns zu besuchen, darunter auch ein Missionär und ein Arzt. Der Kollege litt an einer Krankheit, die in der heissen Zone häufig zu sein scheint. Er hatte sich das Schnapstrinken so sehr angewöhnt, dass er es nicht mehr lassen konnte und ohne Schnaps unglücklich war. Nun war ihm vor einigen Tagen sein Vorrath, den erst die Ankunft des Dampfers von Honolulu erneuern sollte, zu Ende gegangen, und er fühlte sich recht elend. Bei mir hoffte er eine Flasche des süssen Giftes zu erhalten. Leider waren jedoch auch unsere Spirituosen auf der Neige, und der halbe Schoppen Whisky, den ich ihm vorsetzte, erregte nur ein halb wehmüthiges halb verächtliches Lächeln.
Dieser langweilige Tag fand einen höchst interessanten Abschluss. Abends als es bereits dunkelte, kam unser Halbchinese in grosser Aufregung, wie gewöhnlich wenn er etwas Neues wusste, und lud uns ein schnell ihm zu folgen, er wolle uns zu einem Hula Hula führen, wie wir noch keinen gesehen hätten. Da nichts Besseres zu thun war, ging ich mit. Ich versprach mir nicht viel und dachte, es handle sich wieder um eine der gewöhnlichen erotischen Unternehmungen, zu welchen dem Fremdling in jenem Lande so reichlich Gelegenheit geboten wird.
Wir hatten bis ans andere Ende der ausgedehnten Ortschaft zu gehen. Schon von weitem tönte die einförmige wilde Melodie und das schrille Klappern der Kalebassen durch die Gärten herüber, als wir auf engen schlüpfrigen Seitenpfaden zwischen Zäunen und niedrigen Mangobäumen leise im Gänsemarsch dahinwanderten.
Neugierige standen in Gruppen vor dem Hause, welches unser Ziel war, und in dessen Veranda, von einer Petroleumlampe beleuchtet, zwei Frauenzimmer auf dem Boden sassen und unter dem rhythmischen Hin- und Herwerfen des Oberkörpers und der Arme die uns bereits wohlbekannte geräuschvolle Musik verübten. Unter der Thüre, hinter den geöffneten Fenstern und im Innern des Hauses, welches durch seine europäischen Möbel einen höheren Grad von Wohlhabenheit verrieth, sassen alte Weiber, ein paar Männer und einige junge Mädchen.
Wir schienen nicht unwillkommen zu sein. Man machte Platz in der Veranda und brachte Stühle heraus. Hapai stellte uns den jungen Damen vor. Sie waren entfernte Kousinen von ihm und hatten auf der Missionsschule Englisch gelernt. Nun freuten sie sich, ihre Konversationskünste zeigen zu können, und plapperten sehr angenehm los, trotzdem der unaufhörliche Lärm der Hula Hula-Rassel das Sprechen beinahe vereitelte.
Eine geraume Weile sassen wir so da, ohne zu ahnen, welcher eigenthümlichen Art von Feierlichkeit wir beiwohnten, bis eine der anziehenden Schönen frug, ob wir nicht ihre todte Schwester ansehen wollten. Erstaunt und ungewiss, ob wir auch richtig verstanden, traten wir ins Innere, und – da lag wirklich eine Leiche mitten im Zimmer auf dem Paradebett, die Leiche eines jungen Mädchens von 17 Jahren.
Blumenkränze und Blattguirlanden bedeckten das schwarze Tuch, welches über sie gebreitet war. Zwei Frauen, schwarzgekleidet wie die Uebrigen, kauerten traurig daneben, zerdrückten hie und da mit dem Taschentuch eine Thräne und wehrten mit Blumenwedeln die Fliegen ab.
Draussen aber lärmten unermüdlich und immer ungestümer die beiden Tänzerinnen. Sie hatten sich erhoben und führten nun jene äusserst unzüchtigen Bewegungen aus, welche zum Hula Hula gehören.
Wir waren Zeugen einer Todtenfeier im altem Styl. Und dieselben Frauen, die eben an der Leiche geweint hatten, traten dann und wann ans Fenster, sahen dem Hula Hula zu und klatschten laut und lachten ausgelassen, wenn gerade eine Passage besonders verfänglich war. Wie ganz anders als wir mussten diese Menschen fühlen.
Wir setzten uns wieder in die Veranda. Unseren jungen Damen war keine sonderliche Traurigkeit anzumerken, sie waren heiter wie immer. Nur an dem Hula Hula schienen sie nicht denselben Gefallen zu finden wie die älteren Weiber. Sie gehörten entschieden der besten Klasse von Hawaiierinnen an und hatten soviel Vornehmes und Ladylikes in ihrem Benehmen, dass sie den Vergleich mit Europäerinnen nicht zu scheuen brauchten. Dabei besassen sie den ganzen naturfrischen Duft ihrer Rasse. Ihre weissen Zähne glänzten so verführerisch und ihre Augen blitzten so herausfordernd, dass es nicht Wunder nahm, wenn meine Gefährten bald wärmer wurden und den Gesprächen eine Wendung gaben, die es mir lieb machte, dass die Mädchen nur mangelhaft Englisch verstanden. Und mit welcher Würde und mit wie viel Anmuth wussten sie ihre Abweisung zu erkennen zu geben, als sie endlich begriffen.
Unterdessen klapperten und schrieen die Tänzerinnen immer wüthender fort, und immer leidenschaftlicher wurden ihre Hüftenevolutionen, und immer entzückter lachten und klatschten die alten Weiber, die Mütter und Tanten unserer Freundinnen.
Und wie ich das sah, schien es mir selbst, dass wir nicht an einem Orte waren, für welchen schüchterne Zurückhaltung passte. Da kam aber gleich wieder die hoheitsvolle sittliche Entrüstung, sobald wir uns die kleinsten Freiheiten erlaubten. War dies Koketterie oder Wahrheit, mitten in solcher Umgebung, im Angesicht des scheusslichen Hula Hula? Man verzieh uns übrigens und vertraute uns an, dass der anwesenden jüngeren Generation der Hula Hula ebenso verhasst sei, als beliebt bei der älteren.
Wir hatten zwei Kulturstufen, die eine tiefe Kluft trennte, vor uns. Die Alten staken noch fest in ihrer alten Barbarei, die Jungen fühlten bereits europäisch. Dass beide Kulturstufen, anderwärts durch jahrhundertlange Zwischenstufen vermittelt, hier auf einem Fleck nebeneinander vorkamen, war ein Anachronismus, der eben nur bei einer so rapiden Zivilisirung möglich ist, wie die Hawaiier sie genossen.
In einem Missionarbericht aus den zwanziger Jahren erinnere ich mich ein Gegenstück zu unserem Erlebniss gelesen zu haben. Als Kamehameha II. gestorben war, trauerte ganz Honolulu um ihn und zwar in folgender Weise. Beide Geschlechter enthielten sich Wochen lang jeglicher Bekleidung. Einige hackten sich die Finger ab, andere schlugen sich die Vorderzähne aus. Tag und Nacht wurde Hula Hula getanzt, und die Weiber ergaben sich der uneingeschränktesten Prostitution.
Als wir am nächsten Morgen wieder nach jenem Hause gingen, um der Beerdigung beizuwohnen, war diese schon vorüber. Vor der Veranda aber sass ganz allein ein altes Weib, die Mutter des todten Mädchens, und sang die Todtenklage, ein so herzzerreissendes grässliches Wimmern und Heulen, wie ich vorher nie von einer menschlichen Stimme vernommen hatte.
Trotz des schlechten Wetters folgten wir einer schon früher erhaltenen Einladung Kapitän Spencers, des amerikanischen Konsuls von Hilo, ihn in seiner eine Viertelstunde entfernten Zuckerfabrik zu besuchen. Kapitän Spencer, ebenfalls ein ehemaliger Walfischfänger, wie alle die vielen »Captains« auf Hawaii, ist eine hervorragende Persönlichkeit. Jedermann weit und breit kennt ihn, er ist berühmt durch seine Körperstärke und durch die vielen halbbraunen Kinder, die er allenthalben gezeugt hat. Er fängt aber auch bereits an alt zu werden, und als wir zu ihm kamen, war er in sehr schlechter Laune, denn er litt wieder einmal an einem Gichtanfall. Dieses hinderte ihn jedoch nicht uns aufs Reichlichste zu bewirthen. Unangenehm war nur der Ton des Gespräches, den er anschlug, indem er mit dröhnender Stimme über Alles schimpfte, was nicht amerikanisch war, und erst aufhörte, als wir uns empfahlen. Er gab uns einen Burschen bei zur Führung durch seine ausgedehnten Zuckerfelder, die sich ein paar Meilen ins Land hinauf erstrecken, und durch die Siederei.
Künstlich angelegte Abzweigungen des reissenden Wailuku dienen dazu, das oben geschnittene Zuckerrohr herabzuschwemmen. Die Siederei ruhte eben, ein Theil derselben war vor wenigen Wochen abgebrannt, wahrscheinlich durch einen entlassenen Arbeiter angezündet. Auf diesem Rundgang begegneten wir einem blonden Hawaiier mit blaugrünen Augen. Er sah skrophulös aus und hatte Drüsennarben am Halse. »Kanaka maoli« (maoli-maori, echt) sagte mir der Führer. Ohne diese Bemerkung würde ich ihn für einen Engländer oder Deutschen der ärmsten Auswanderersorte gehalten haben.
Am 30. August sollte der Dampfer Kilauea wieder kommen, um uns nach Honolulu zurückzubringen. Wir warteten vergeblich den ganzen Tag, aber er kam nicht. Auch der folgende Tag verging, und kein Dampfer liess sich sehen. Es musste ihm etwas zugestossen sein. Der Postmann, welcher die Strecke von Hilo bis Kohala an der Nordspitze der Insel abgeritten hatte, traf mit der Nachricht ein, auch in Kohala und in Kawaihae sei nichts von einem Dampfer zu bemerken gewesen. Man fing an zu munkeln, der Kilauea sei untergegangen, er sei schon seit lange nicht mehr seetüchtig, kein Wunder dass ihn endlich sein Ende ereilt. Da sassen wir nun und wussten nicht was thun, ohne Telegraphen und ohne Gewissheit.
Es blieb vorläufig nichts übrig, als geduldig zu warten und die Zeit zu vertreiben so gut wir konnten. Wir machten Kanuufahrten ins Meer hinaus, wir gingen mit aufgespanntem Regenschirm am Strand spazieren, wir badeten Vormittags in der See und Nachmittags im Fluss, wir machten Besuche und empfingen solche, und Abends kam, falls es nicht zu stark regnete, der Gesangverein von Hilo und gab uns ein Konzert draussen im Garten um ein paar Zigarren zu verdienen.
Aber alles dieses war eigentlich doch sehr langweilig, jetzt da unser Programm durch das Nichterscheinen des Dampfers gestört war und wir alle von Hilo fortzukommen wünschten. Auch das famose Bad im Wailuku hatte allen Reiz eingebüsst, da die höhere weibliche Schuljugend sich nicht mehr einstellte. Ihre so anziehende Schwimm- und Purzelbaumproduktion des ersten Tages hatte das Missfallen der frommen Missionäre erregt. Es war ihnen eingeschärft worden, unsere Nähe zu meiden, und um die Tugendhaftigkeit im Kampf mit dem Bösen zu unterstützen, schlich nächtlicher Weile die hohe Polizei um unser Hotel.
Zwei Tage warteten wir noch, und als der Kilauea immer noch nicht kam, mussten wir das Hoffen auf ihn aufgeben und in irgend einer anderen Weise nach Honolulu zurückzugelangen suchen, wollten wir nicht den Verlust unserer Passage nach San Francisco riskiren. In Kohala, war uns gesagt worden, läge ein Schuner segelfertig für Honolulu, und wenn wir uns beeilten, könnten wir diesen noch erreichen. Zu Land und mit Pferden würden wir mindestens zwei Tage gebraucht haben, und ans Reiten konnten wir mit unseren zerschundenen Gliedmassen nicht denken. Wir beschlossen deshalb, irgend ein Fahrzeug zu miethen und dorthin aufzubrechen.
Das war aber leichter gesagt als gethan. Man suchte uns jetzt durch alle möglichen Vorstellungen der grossen Gefährlichkeit einer solchen Reise an der Küste voller Klippen und Brandung entlang abzuhalten. Erst nachdem wir nochmals einen Tag mit Herumlaufen nach jeder Richtung verloren hatten, gelang es uns durch die gütige Vermittelung Kapitän Spencers, ein grosses Walfischfängerboot aus der guten alten Zeit der Walfischfängerei, welches schon lange keinen Walfisch mehr gesehen hatte, sowie eine Mannschaft von sechs Kanakas aufzutreiben und für 50 Dollars bis Kohala zu miethen.
Wir verproviantirten uns mit Esswaaren und Trinkwasser und um Mitternacht sollten wir in See stechen. Wir hätten dies eigentlich schon mehrere Stunden früher thun können. Aber da wir für den Abend bei liebenswürdigen jungen Damen zu einem Souper eingeladen waren, so mussten wir die Abfahrt verschieben.
Die holden Wahines hatten uns Blumenkränze zum festlichen Schmucke geschickt, wir kauften noch einige mehr dazu, und blumenbehangen wie die Boeufs gras zu Paris verfügten wir uns in ihre Behausung. Es handelte sich um eine etwas verfeinerte Mahlzeit im landesüblichen Styl mit Poi, rohen Fischen, Fischgedärmen, roher Schweinsleber und Seemuscheln. Um auch dem europäischen Geschmack Rechnung zu tragen, gab es ausserdem noch kalte Hühner, Schinken und Brot, Kaffe und Thee.
Die ganze Bescherung war in der Mitte des Zimmers auf dem mattenbelegten Boden ausgebreitet. Wir setzten uns ringsherum und kreuzten die Beine, neben und zwischen uns die braunen Schönen, selbstverständlich gleichfalls über und über mit Blumen bekränzt. Die Versammlung war ein duftender Blumengarten. Wirkte nun allerdings das Fremdartige einiger Gerichte störend auf unseren Appetit, und konnte man sich auch vielleicht daran stossen, dass die nackten Füsse der Damen häufig mit den uns vorgesetzten Portionen in Berührung geriethen, und dass wir Alles mit den Händen zu zerreissen hatten, so waren unsere Wirthinnen doch von einer so gewinnenden Liebenswürdigkeit, und es machte ihnen sichtlich so viel Freude uns zu bewirthen, dass wir mit Beherrschung der widerstrebenden Gefühle wacker zugriffen und ihnen selbst gestatteten, uns eigenhändig den Poi-Brei in den Mund zu schieben. Man that uns damit eine Ehre an, deren Ablehnung eine Beleidigung gewesen wäre. Sie machten ihre Sache auch recht artig und gingen erst hinaus um sich die Hände zu waschen, ehe sie damit in die grossen Kalebassen tunkten, den sauren Kleister um die zwei ersten Finger wickelten und uns willenlose Opfer damit regalirten.
Die Bootsmannschaft, welche wir auf elf Uhr bestellt hatten, wurde ungeduldig und wir mussten uns losreissen. Noch ein zärtlicher Abschied, viel hundert Alohas, und wir wandten uns nach dem Gestade.
Mister Wilky liess sein Pferd satteln uns zu begleiten. Ein zahlreicher Tross von Chinesen und Kanakas holte das Gepäck aus dem Hotel herbei, und unter den kräftigen Tönen eines kriegerischen Gesanges marschirten wir durch die nächtlich stillen Strassen von Hilo. Ein dreimaliges Hurrah und wir stiessen ab. Den bereits im Schlummer liegenden friedlichen Bewohnern wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn wir uns minder geräuschvoll empfohlen hätten. Mancher Fluch mag uns nachgesandt worden sein. Als wir in die Bucht hinausgerudert waren und die ersten Windstösse um die Ecke kamen, schlug es auf den zwei Kirchthürmen zwölf Uhr.
Nur selten erschien der Mond in den Lücken des Gewölks und beleuchtete auf kurze Augenblicke die gigantischen Massen Hawaiis, unter denen wir, getrieben von dem frischen Hauch des Passates, vorüberglitten. Leider stellte sich die Seekrankheit ein, und die Fahrt in dem engen Boot wurde sehr ungemüthlich. Zwar hatten wir uns so komfortabel als möglich eingerichtet. Das Hintertheil unseres Fahrzeuges war durch Matratzen und Kissen und Decken in ein geräumiges Bett für drei Personen umgewandelt, und die Reihenfolge des Schlafens war ausgeloost worden. Aber drei von uns fünfen stöhnten so jämmerlich, dass mein Freund Bats, an den ich mich enger angeschlossen, und ich selbst gerne auf unser Recht verzichteten.
Der Morgen kam und enthüllte eine Naturschönheit nach der anderen. Schade dass wir in unserem unausgeschlafenen Zustand, müde, gähnend und blinzelnd, nicht viel davon geniessen konnten. Wieder ging es an den vielen Wasserfällen vorüber, die zur tosenden Brandung herabstürzten, an der grossartigen Thalschlucht des Waipiu Valley, an kahlen Wänden, ununterbrochen oder zu riesigen Blöcken zerklüftet senkrecht aus dem Meere emporschiessend, um erst in 300 Meter Höhe zu einem sanft ansteigenden Winkel sich abzubiegen, an Zuckerplantagen und Ohiawäldern oben auf unzugänglicher Kante, an einsam verlassenen Kirchen und an Ortschaften, winzig klein im Grunde der steil gethürmten Felsenkulissen. Häufig fuhren wir so nahe an Vorsprüngen der Insel hin, dass wir deutlich Menschen erkannten, welche unter den Blöcken und dem schäumenden Gischt des Ufers herumkrochen und fischten.
Gegen Mittag waren wir in Kohala, das heisst an der nördlichen Landspitze. Von dem Dorfe dieses Namens selbst, welches eine Viertelstunde binnenwärts liegt, war noch nichts zu sehen. Wir fanden erst nach längerem Suchen den Landungsplatz. Die See ging hoch, unser Kapitän kannte den Grund nicht, überall drohten Klippen. Zum Glück erschien als rettender Engel eine Kanakin zu Pferd auf dem nächsten Hügel und blickte verwundert zu uns herab. Einer unserer Leute zog sich aus und schwamm ans Ufer, um sich bei ihr zu erkundigen. So gelangten wir endlich in eine versteckt gelegene Bucht, in welcher ein Boothaus stand, die erste Andeutung menschlicher Wohnstätten. Von dem versprochenen Schuner weit und breit nichts zu entdecken.
Kohala ist ein öder und langweiliger Platz und liegt in der Mitte einer ganz reizlosen, welligen Stoppelgrasfläche, die sich langsam zu dem dritten und kleinsten Hauptvulkan der Insel, dem Hualalai, hinaufzieht. Eine grosse Zuckersiederei, eine Reihe von Wohngebäuden, an deren Ende eine Kapelle, und weitherumgestreut etliche Hütten von Eingeborenen setzen die ausgedehnte Ortschaft zusammen.
Es stellte sich nun heraus, dass die ganze Geschichte von dem Schuner, mit der man uns veranlasst hatte hierher zu reisen, Schwindel war, und auf alle Anfragen nach einer Fahrgelegenheit erhielten wir nur Achselzucken und unfreundliche Gesichter zur Antwort. Man lud uns ein, hier zu bleiben und auf unbestimmte Zeit zu warten. Für heute war allerdings nichts Besseres zu thun als auszuschlafen und das Weitere bis morgen zu verschieben. Wir nahmen deshalb bei dem Besitzer der Zuckersiederei Quartier.
Der nächste Tag war unglückseliger Weise ein Sonntag, und unser sonst sehr liebenswürdiger Wirth entpuppte sich als ein arger Mucker. Bats und ich hatten beschlossen, um jeden Preis nach Honolulu weiterzugehen, und sollte es auch in unserem offenen Walboot sein. Wir kollidirten damit aufs Heftigste mit den herrschenden Sabathgefühlen und nichts wurde unterlassen, gegen unser Vorhaben zu intriguiren. Auch die drei anderen Gefährten waren dagegen, wohl mehr aus Furcht vor der See als aus wahrer Religiosität. Schliesslich siegten wir aber doch, und gegen 65 Dollars und das Versprechen, Boot und Mannschaft von Honolulu nach Hilo mit dem nächsten Schuner oder auch mit dem Dampfer, falls er wieder ginge, zurückzuschicken, übernahm es der Kapitän, uns beide nach Honolulu zu bringen. Die anderen drei blieben zurück.
In Kohala war es unerträglich öde und feierlich. Den ganzen Morgen klimperte der blasse Backfisch des Hauses geistliche Melodien auf dem Klavier, während wir unten im Garten uns mit dem frommen Vater und unserer Bootsmannschaft herumdisputirten. Als wir bereits am Landungsplatz unten waren, um uns einzuschiffen, erhoben sich neue Schwierigkeiten. Wir wollten noch zwei Kalebassen Poi für die Mannschaft mitnehmen. Aber heute war Sonntag, und kein Mensch in Kohala getraute sich etwas zu verkaufen, und ohne den Poi erklärte die Mannschaft aufs Bestimmteste, nicht zu fahren. Zum Glück fanden wir doch noch einen Kanaka bereit, gegen das Fünffache des gewöhnlichen Preises den unumgänglichen Kleister heimlich zu liefern.
Endlich stiessen wir wirklich vom Lande und waren der peinlichen Ungewissheit ledig. Hinter uns die gottesfürchtige Sonntagslangeweile von Kohala zurücklassend ruderten wir in das offene Wasser hinaus, wo uns bald ein günstiger Wind ergriff. Das Wetter war Gutes versprechend. Passatwolken rings am Horizont, nur die Berge der Inseln dunkler verschleiert.
Unser Kapitän wollte rechts nach der Windseite von Maui steuern. Da wir jedoch seiner Navigation und der Takelage nicht viel zutrauen durften, bedeuteten wir ihm, dass wir in Lee um die Insel gehen wollten. Wir fürchteten die Wogen und die Brandung des freien Meeres, hatten aber entschieden Unrecht, da wir aussen herum viel schneller vorwärts gekommen wären.
Ein Fregattvogel zog seine Kreise hoch in den Lüften. Kleine fliegende Fische schwirrten neben uns aus dem Wasser und mehrere von ihnen fielen in unser Boot. Die See ging heftiger und eilig durchfurchte der Kiel die hüpfenden Wellen. Wir freuten uns die drei seekranken Reisegefährten los und im alleinigen ungeschmälerten Besitz des Matratzenverdecks zu sein.
Gegen Abend wurde die Luft verdächtig klar und die gewaltigen Formen des Haleakala traten uns immer näher entgegen. Scharfgeschnitten hoben sich seine ungeheuren Radienpfeiler aus dem Meere, strahlendes Sonnenlicht auf den Kanten und tiefe, warme Schatten in den riesigen Schluchten, so ergreifend schön und grossartig, wie ich niemals vorher Aehnliches gesehen.
Wie sehr verschieden sind doch diese Hawaiischen Inseln von den Viti-Inseln, obgleich beide ungefähr gleichweit vom Aequator entfernt sind, die einen südlich, die anderen nördlich. Während in der Landschaft von Viti das Anmuthige und die Ueppigkeit tropischer Vegetation vorherrscht, trägt hier Alles den Charakter des Wilden, Gigantischen. Noch viel mehr aber als sonst irgendwo auf der ausgedehntesten und jüngsten und südöstlichsten der Inseln, auf Hawaii, welche jetzt gleichfalls wie zum Abschied in ihrer ganzen Pracht sich entfaltete. Hoch über der Wolkenlinie schwammen duftig violett und bestreut mit glitzernden Schneefeldern die beiden Häupter Maunaloa und Maunakea, beide mehr als 4000 Meter hoch. Sie bestehen durchaus aus Lava. Und wenn man bedenkt, dass sie sich mit einer Basis von beinahe 60 Seemeilen oder 111 Kilometer im Durchmesser zu ihrer gewaltigen Höhe erheben, und dass ihre Konturen ohne Brechung in einer sanftabsteigenden geraden Linie aus den Wolken herabkommen, so kann man sich ungefähr einen Begriff machen, welche kolossale Massen hier durch Lavaeruptionen geschaffen wurden.