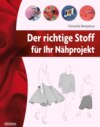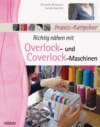Kitabı oku: «Der richtige Stoff für Ihr Nähprojekt», sayfa 3
Zellulosefasern
Zellulosefasern sind Kunstfasern pflanzlichen Ursprungs. Sie entstanden aus dem Traum, die Seide zu imitieren – so wurde nach vielen Jahren der Forschung ganz am Ende des 19. Jahrhunderts die Viskose entwickelt. Ausgangsmaterial war Zellstoff von Holz oder Bambus, doch zur Herstellung waren einige mehr oder weniger heftige und umweltschädliche chemische Prozesse erforderlich: Die Zellulose wird aufgelöst, sodass eine Art Gel entsteht, das anschließend durch feine Düsen zu langen oder endlosen Filamenten gepresst wird.
Viskose
Viskose kam Anfang des 20. Jahrhunderts als Kunstseide (durchgehender Faden) und Zellwolle (kurze Spinnfasern, die zu langen Fäden gedreht werden) auf den Markt. Sie ist eine Regeneratfaser aus natürlichen Stoffen. Produziert wird sie vorrangig in China. Das Rohmaterial ist ökologisch, doch die Umwandlung des Holz- oder Bambuszellstoffs in Viskosefasern ist ein umweltbelastender Prozess, für den viel Wasser benötigt wird.
Viskose hat die Eigenschaften von Baumwolle; sie fusselt nicht, knittert jedoch leicht und neigt zum Einlaufen. Da sie aus Holz- oder Bambuszellstoff besteht, lädt sie sich nicht statisch auf, und sie ist sehr weich.
Lenpur
Lenpur ist eine neuere Zellulosefaser, die der Viskose ähnelt. Ausgangsmaterial ist die Zellulose der Weymouth-Kiefer. Da es so weich und leicht ist, wird Lenpur auch pflanzliches Kaschmir genannt. In Japan wird eine vergleichbare Faser aus Zypressen hergestellt.

Woran erkennt man Zellulose?

Eine Zellulosefaser raucht beim Verbrennen kaum und riecht wie Baumwolle nach verbranntem Papier. Die zurückbleibende Asche ist gräulich, leicht und sehr krümelig.

Cupro
Cupro kam 1918 auf den Markt. Es fühlt sich seidig an (daher auch der Name Kupferseide) und wird hauptsächlich als Futterstoff verwendet. Es ist im Sommer sehr angenehm zu tragen, denn es trocknet schnell und eignet sich hervorragend für sommerliche Bekleidung.

Woran erkennt man Cupro?

Beim Verbrennen verströmt Cupro einen Geruch nach Ammoniak.

Modal
Modal ist eine Zellulosefaser, die meist aus Buchenzellulose hergestellt wird. Wie ihre Verwandten bleibt sie auch nach langem Gebrauch weich und fließend. Sie ist saugfähiger als Baumwolle und läuft nicht ein. Daher wird sie heute oft für Haushaltswäsche verwendet (Handtücher, Bettwäsche), aber auch für Morgenmäntel und Unterwäsche. Es gibt Stoffe aus reinem Modal mit Zusatz von Elasthan und auch Baumwoll-Modal-Mischungen. Der bekannteste Handelsname ist Lenzing-Modal.
Lyocell
Tencel ist der bekannteste Markenname der Lyocellfaser. Diese wird ebenfalls aus Zellulose hergestellt, dazu wird jedoch nur Wasser und ein recycelbares Lösungsmittel benötigt. Daher wird Lyocell oft als die ökologischste der Zellulosefasern präsentiert. Die Faser ist stabiler als Viskose, strapazierfähiger als Baumwolle und läuft nicht ein. Sie ist maschinenwaschbar, aber nicht trocknergeeignet. Lyocell ist knitterarm, trocknet schnell und lässt sich aufgrund seines fließenden Falles gut drapieren. Es lässt sich gut zusammen mit anderen Fasern (Natur- oder Kunstfasern) verarbeiten – so entstehen innovative Stoffe. Es ist eine sehr wandelbare Faser und kann sowohl eine glatte als auch eine gröbere Struktur haben.
In Zukunft dürfte Lyocell in unserem Alltag zunehmend an Bedeutung gewinnen. In der Herstellung ökologischer als Baumwolle oder Viskose, gut zu verarbeiten und pflegeleicht – dieser Stoff ist wirklich für alles Mögliche geeignet. Ich mag besonders seinen weichen Griff – beim Nähen wie beim Tragen.
ZELLULOSE UND SYNTHETIK
Zelluloseacetat ist ebenso wie Triacetat eine durch chemische Synthese hergestellte Zellulosefaser, ein Polymer. 1920 hat ein Fabrikant aus Lyon erstmals Acetat gewebt. Der Stoff ähnelt der Seide, trocknet schnell, knittert nicht und ist thermoplastisch (lässt sich also z. B. in dauerhafte Plisseefalten pressen). Er wird häufig als Futterstoff verwendet, da er nicht einläuft.

Synthetische Kunstfasern
Diese Fasern sind Produkte der Industrie und der chemischen Forschung. Sie werden durch Polymerisation von Erdölprodukten hergestellt. Die dabei entstehenden Fasern haben mit dem Rohstoff nichts mehr gemein. Ursprünglich wollte man mit ihnen die Natur imitieren bzw. übertreffen – die Fasern sollten alle Vorteile von Naturfasern besitzen, aber nicht deren Nachteile. Abgesehen von Zelluloseacetat (siehe oben) kann man fünf Kategorien unterscheiden: Polyester, Polyamid, Acryl, Chlorfasern und Elasthan.
Polyester
Polyester als Textilfaser wurde 1941 in Großbritannien patentiert und kam nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Bezeichnungen Tergal, Dacron oder auch Terylene (je nach Hersteller) auf den Markt. Er ist heute die meistproduzierte und gebräuchlichste Kunstfaser der Welt. Er ist strapazierfähig, pflegeleicht und trocknet schnell. Er läuft nicht ein, ist UV-beständig, feuchtigkeits-, schimmel- und mottenresistent. Dennoch hat er auch Nachteile: Wasser absorbiert er schlecht, Öl jedoch sehr leicht, er pillt und lädt sich statisch auf. Bei zu heißen Temperaturen kann er schmelzen.
Polyamid
Diese strapazierfähige, leichte Faser ist bekannter unter dem Namen Nylon. Als Stoff wurde sie erstmals für Fallschirme verwendet. Sie nimmt wenig Feuchtigkeit auf, ist knitterarm und trocknet schnell, lädt sich jedoch statisch auf. Polyamid ist pflegeleicht, feuchtigkeitsresistent, aber leicht entflammbar. In Arbeitskleidung für Berufe mit möglicher Brandgefahr ist das Material daher nicht zugelassen, denn wenn es brennt, schmilzt es zu Tropfen, die sich in die Haut fressen und schwere Verbrennungen verursachen können. Da es sehr weich und zudem antiallergen ist, wird es häufig für Kleidung verwendet, die direkt auf der Haut getragen wird. Aus Polyamid können Web- oder Strickstoffe hergestellt werden, und es ist gut recycelbar.

Woran erkennt man Polyamid?

Es schmilzt beim Verbrennen, bildet dabei kaum eine Flamme. Die zurückbleibende Asche ist hart und schwarz.

MIKROFASERN
Mikrofasern sind ultradünne Fädchen, aus denen man sehr dichte Web- oder Strickstoffe herstellen kann. Diese sind besonders weich, angenehm zu tragen und haben einen seidigen Glanz. Aufgrund ihrer Zusammensetzung sind Mikrofasergewebe wasserabweisend, lassen die Haut jedoch atmen. Diese in den 1980er-Jahren entwickelten Stoffe sind synthetisch: Sie bestehen aus Polyester, Acryl, vor allem aber aus Polyamid, das farbechter ist.

Acryl
Acryl wird allein oder mit anderen Fasern gemischt verarbeitet (Wolle, Baumwolle, Seide, Kunstfasern). Courtelle ist der bekannteste Handelsname von Polyacryl in Frankreich, wo es ab Anfang der 1960er-Jahre produziert wurde. Entwickelt wurde Acryl, um Wolle zu imitieren, und es ist tatsächlich weich, leicht, fühlt sich seidig an und hält warm. Es ist UV-beständig, trocknet schnell und ist bügelfrei. Dagegen neigt es zu Pilling, lädt sich statisch auf und kann bei zu heißen Temperaturen einlaufen. Dennoch ist es – ob als Web- oder Strickstoff – ein interessantes Material.
Chlorfasern
Chlorfasern sind synthetische Fasern, die auf der Basis von Polyvinylchlorid (besser bekannt als PVC) hergestellt werden. Handelsnamen sind z. B. Rhovyl und Thermovyl; vermarktet werden Stoffe aus Chlorfasern seit 1948. Sie können wasserdicht sein, sind pilzresistent und wärmen gut – aus letzterem Grund werden sie häufig für wärmende, aber weiche und dünne Unterwäsche verwendet.
Chlorfasern sind auch das Geheimnis von Thermolactyl, einer Faser der Firma Damart, die daraus seit Jahrzehnten mit Erfolg Wintersportbekleidung und -unterwäsche herstellt. Sie filzen und knittern nicht und sind mottenresistent. Sie können auch mit anderen Fasern (Seide, Baumwolle, Lyocell, Modal, Wolle etc.) gemischt werden, entweder beim Spinnen oder – für Jersey – beim Stricken. Dabei haben Chlorfasern die Fähigkeit, ihre Eigenschaften zu bewahren und zugleich die Besonderheiten der beigemischten Fasern zu integrieren.
Elasthan
Elasthan ist eine Elastomerfaser, die 1959 von DuPont de Nemours als Ersatz für Latex auf den Markt gebracht wurde. Der Markenname der Faser bei dieser Firma ist Lycra; es gibt auch die Bezeichnung Spandex. Elasthan wird u. a. aus Polyurethan hergestellt, ist enorm dehnbar (bis auf das Siebenfache seiner Länge) und doch formbeständig. Es ist weniger allergieauslösend als Latex, verträgt keine hohen Temperaturen, ist jedoch sehr chlorresistent.
Kein Stoff besteht ausschließlich aus Elasthan; diese Faser wird nur in kleinen Mengen beigemischt (immer unter 30 %) und verleiht den übrigen Fasern neue Eigenschaften: Durch Elasthan wird ein Stoff elastisch, strapazierfähiger, reißfester, und er trocknet auch schneller. Webstoffe werden dadurch bequemer, elastischer, formstabiler und haltbarer. Elasthan kann dabei in der Breite oder Länge eines Stoffes oder in beide Richtungen verwendet werden. Bei Strickstoffen verhindert es, dass sie mit der Zeit ausleiern. Je höher der Elasthananteil ist, desto formstabiler wird ein Stoff. In den 1970er-Jahren zunächst ausschließlich der Sportbekleidung vorbehalten, eroberte Elasthan im darauffolgenden Jahrzehnt die Konfektionskleidung und spielt heute in unserer gesamten Bekleidung eine bedeutende Rolle.
Vom Faden zum Stoff
Spinnen
Das Rohmaterial wird behandelt, um Fasern zu gewinnen, aus denen wiederum Fäden hergestellt werden, die Grundbestandteile des Stoffes. Diese Arbeit nennt man Spinnen.
Bei Naturfasern wird das Rohmaterial gewaschen, getrocknet und geschlagen, heute mit Metallstäben, die das Material auflockern und grob vorkämmen. Das anschließende Kardieren richtet die losen Fasern weitgehend parallel zu einem Flor oder Vlies aus, aus dem der Faden hergestellt wird. Beim Kämmen dagegen werden die Langfasern noch weiter entwirrt und kürzere Fasern ausgekämmt, sodass ein noch feinerer und leichterer Faden entsteht.

Bei Kunstfasern wird die zähflüssige Grundmischung durch Düsen gepresst. Durchmesser und Form der Öffnungen bestimmen die Stärke und Form des Fadens (kreuzförmig, gezahnt, rund oder abgerundet), woraus sich später wiederum Griff, Gewicht und Qualität des Stoffes ergeben. Die Fäden werden verstreckt, damit sie feiner werden, und anschließend miteinander zu einem Faden verdrillt.
Die Fasern, aus denen der Faden hergestellt werden soll, können lang sein (z. B. bei Wolle) oder recht kurz (wie bei Baumwolle). Um sie zu mischen, muss man die lange auf die Größe der kurzen zuschneiden. Zur Fadenherstellung werden mehrere Fasern zu einer Strähne zusammengenommen, die dann durch Verdrillen zum Faden gesponnen werden.
Das Verdrillen ist ein wichtiger Schritt. Je stärker verdrillt wird, desto stabiler wird der Faden. Wird zu stark verdrillt, zieht der Faden sich zusammen und wird kraus, und man kann daraus Crêpe weben; durch ihn erhält der Stoff seine körnige Struktur und seinen Fall.
Es können auch zwei oder mehr solcher Fäden zu einem stabileren Garn zusammengedreht werden; dies nennt man Verzwirnen. Es gibt beim Verdrillen zwei Drehrichtungen, die S-Drehung und die Z-Drehung. Meist werden Fäden in Z-Richtung gedreht und in S-Richtung verzwirnt.
Werden zwei oder mehr Zwirne miteinander verzwirnt, entsteht Mehrstufenzwirn (Cablégarn).

Z-Drehung und S-Drehung

Zwirnsfäden
Nach dem Spinnen kann der Faden noch weiterbehandelt werden, um eine andere Optik zu erhalten, die auch das Aussehen daraus gewebter Stoffe verändert: Er kann zu Tweedgarn, Flammégarn, Bouclégarn, Noppengarn etc. werden.

Noppengarn

Bouclégarn
TEXTURIERTES GARN
Bei der Texturierung wird ein meist synthetischer Faden (Polyester oder Polyamid) verändert: Er wird bauschig, erhält also mehr Volumen und Elastizität und wird weicher. Der Faden wird unter Hitzeeinwirkung hochgedreht und wieder zurückgedreht. Ferner gibt es das Blas- und das Stauchkräuselverfahren.

Links ein Zickzackstich mit texturiertem Polyestergarn, rechts der gleiche Stich mit klassischem Polyestergarn.
Weben
Ein Stoff entsteht durch Verkreuzen der Fäden miteinander oder durch Verflechten bzw. Verschlingen von Fäden zu einem Gestrick oder zu Spitze oder durch Filzen. Der Vorgang gibt dem Stoff seine Struktur: Es gibt verschiedene Webarten, durch die Stoffe mit ganz unterschiedlicher Optik entstehen.
Das Verkreuzen der Kettfäden (Längsrichtung des Stoffes) und der Schussfäden (Querrichtung) ergibt einen Webstoff. Auf einer Webmaschine werden die Fäden von Garnspulen auf eine große Rolle (den Kettbaum) gewickelt, um die Kettfäden parallel und korrekt gespannt anzubringen nach einer von zwei Methoden: Schären oder Zetteln.
Die Maschine führt den Schussfaden durch die Kettfäden, je nachdem, welche Bindungsart Stoff gewählt wurde. Dabei wird der Schussfaden immer hin und her geführt, und so entsteht nach und nach der Stoff.
Die Bindung ist die Art und Weise, auf der Kett- und Schussfäden sich kreuzen. Man unterscheidet drei Hauptbindungsarten.
Leinwandbindung
Dies ist die gebräuchlichste Bindungsart, denn sie ist am einfachsten herzustellen. Kett- und Schussfäden kreuzen sich regelmäßig: Jeder Schussfaden verläuft abwechselnd unter und über einem Kettfaden, in der Rückreihe dann umgekehrt. Vorder- und Rückseite eines solchen Stoffes sind oft nicht leicht zu unterscheiden. Batist, Flanell, Taft, Vichykaro und Perkal sind Stoffe in Leinwandbindung.

Leinwandbindung
Taftbindung wird die Leinwandbindung genannt, wenn es sich um Seiden- oder Viskosegewebe handelt (Taft ist ein Seidenstoff,).
Musselin, Organdy und Voile werden ebenfalls in Leinwandbindung gewebt. Sie sind zarte, matte Stoffe aus feinen und vor allem weit auseinanderliegenden Fäden, sodass sie durchscheinend wirken.

Leinengemisch für Tischdecken, champagner, auf einem Fadenzähler (Art.-Nr. 0000 4970).
Crêpestoffe sind Stoffe in Leinwandbindung, die eine körnige Struktur haben, keine glatte Oberfläche. Sie haben einen besonders weichen, fließenden Fall. Es gibt verschiedene Arten von Crêpe, darunter Crêpe de Chine, Crêpe Marocain und Crêpe Georgette, die Sie im Verlauf dieses Buches noch kennenlernen.
Panama-, Rips- und Cannelébindung sind Varianten der Leinwandbindung. Sie unterscheiden sich in der Anzahl, in der Kett- und Schussfäden bündelweise miteinander verwebt werden.

Seide in Cannelébindung, cremefarben, auf einem Fadenzähler (Art.-Nr. 0000 6964).
Köperbindung
Das Besondere an dieser Bindungsart sind die schräg verlaufenden Rippen. Auf feinen Stoffen sind diese Diagonalen kaum zu sehen, doch auf dickerem Stoff kann man sie gut erkennen. Sie entstehen, indem der Schussfaden jeweils über einen Kettfaden und dann unter drei (manchmal auch zwei, vier oder fünf) Kettfäden läuft, und zwar in jeder weiteren Webreihe um einen Kettfaden versetzt.

Köperbindung
Auf der linken Stoffseite ist dieser sogenannte Grat weniger ausgeprägt, daher kann man die linke und rechte Seite leicht unterscheiden.
Die bekanntesten Stoffe in Köperbindung sind Denim (Jeansstoff), Serge, Twill, Gabardine und Drillich (auch Drell). Auch Hahnentrittmuster, schottische Tartanstoffe und Fischgrätenmuster werden in Köperbindung gewebt.
Köpergewebe sind fester und strapazierfähiger als Stoffe in Leinwandbindung. Da Serge fließender fällt und sich besser drapieren lässt als Leinwandgewebe, schmiegen sich daraus genähte Kleidungsstücke besser an. Außerdem lassen sich diese Stoffe leicht bügeln.

Leichter Flanell, azurblau, auf einem Fadenzähler (Art.-Nr. 0000 2365)

Christelles Tipp

Ich liebe Köpergewebe. Ob fein wie Baumwolltwill für Hemden, mittelstark für einen Minirock oder dicker für einen legeren Mantel – diese Stoffe lassen sich für alles verwenden.

Atlasbindung (Satinbindung)
Satin erkennt man an seiner glatten, glänzenden oder schimmernden Oberfläche. Bei diesem dichten Gewebe verläuft jeder Schussfaden über vier Kettfäden. Da die Bindungspunkte (Kreuzungsstelle von Kette und Schuss, an der Ober- und Unterführung wechselt) sich nicht berühren, entsteht kein Diagonaleffekt, sondern diese glatte, makellose Oberfläche. Satin ist auf der rechten Seite glänzend, auf der linken matt. Atlasgewebe können etwas steif sein, es sei denn, sie werden aus sehr feinen Fäden gewebt.

Atlasbindung.

Duchessesatin, 100 % Seide (8-fädig), lagunengrün, auf einem Fadenzähler (Art.-Nr. 0000 5424).
Es gibt zahlreiche verschiedene Satins, unter anderem Duchessesatin, Satin de Lyon, Crêpesatin (Kreppsatin) und Charmeuse.
Samtbindung

Glatter Samt „Miracle“, rot, Ansicht der Schnittkante auf einem Fadenzähler (Art.-Nr. 0000 6611).
In Fernost, wo er vermutlich seinen Ursprung hat, wird der Samt „Schwanenflaum“ genannt. Er wird von einer Webmaschine mit zwei Kett- oder zwei Schusssystemen gewebt: Auf einem Grundgewebe aus Kette und Schuss bildet das zweite System Schlingen, die aufgeschnitten und geschoren werden und so den Samtflor ergeben.
Je nach Herstellung unterscheidet man zwischen Kettsamt und Schusssamt (z. B. Cordsamt).
SPEZIALTECHNIKEN: JACQUARD
Stoffe mit Jacquardmusterung werden mit speziellen Jacquardwebmaschinen hergestellt, deren Vorläufer der 1801 in Lyon von Joseph Marie Jacquard erfundene Jacquard-Webstuhl ist. Dieser ist dank eines Lochkartensystems programmierbar und von einem einzigen Arbeiter zu bedienen. Mit diesem System lassen sich allein durch Hochziehen einzelner Kettfäden die verschiedensten, teils sehr komplexen Muster weben. Es gibt auch Strickmaschinen mit Jacquardeinrichtung für aufwändigen Jacquard-Strick. Zu den Jacquard-Stoffen zählen Brokat und Damast. Damast wird in nur einer Farbe gewebt: Dadurch, dass abwechselnd z. B. Kettsatin und Schusssatin gewebt werden, entstehen große, einfarbige Reliefmuster. Brokat wird mit Metallfäden gewebt; er ist zeitaufwändiger in der Herstellung und daher kostspieliger.

Seidenbrokat „Colibri“, himbeerperlgrau, (Art.-Nr. 0001 0914).