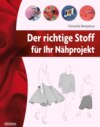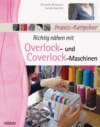Kitabı oku: «Der richtige Stoff für Ihr Nähprojekt», sayfa 4
Maschenware
Zur Maschenware (Strick- und Wirkware) gehören alle Textilien, die aus Maschen bestehen und mit einer Strick- oder Wirkmaschine hergestellt werden. Die Fäden werden nicht gewebt, sondern in Schlingen (Maschen) gelegt, die ineinandergeschlungen werden und so den Stoff bilden. Die meisten Faserarten (Natur- und Kunstfasern) eignen sich dafür. Das erste Unternehmen, das Maschenware für ein breites Publikum herstellte, war die Firma Rodier (1920).
Unter dem Begriff Trikotagen werden alle Prozesse zusammengefasst, die mit Herstellung und Verkauf von Maschenwaren zusammenhängen. Wenn Sie Strickstoff kaufen, schneiden Sie ihn zu und nähen die Teile zusammen wie beim Webstoff. Dieses Prinzip des „Zuschneidens und Nähens“ wird z. B. bei der Herstellung von T-Shirts, Tops, aber auch manchen Pullovern angewendet.
Man unterscheidet zwei Arten von Maschenware:
•Strickwaren: Die Maschen werden horizontal gearbeitet, d. h., der Faden verläuft waagrecht entlang einer Maschenreihe. Dabei werden zwei Maschenarten verwendet, rechte und linke Maschen. Zu den Strickwaren gehören Singlejersey und Doublejersey (Interlock, Rippjersey wie Bündchenware). Man erkennt Strickwaren daran, dass die Maschen auf der rechten Seite senkrechte Reihen kleiner „V“ bilden.
•Wirkware (Gewirke): Der Faden, der die Maschen bildet, verläuft senkrecht. Dadurch ist der Stoff in Richtung des Fadenlaufs weniger elastisch und kann nicht aufgezogen werden (laufmaschenfest). Netzjersey (Netztrikot), Raschelgewirke und andere (Pikeestrick, Charmeuse …) zählen zu den Gewirken. Sie sind weniger dehnbar als Strickstoffe, werden aber dank Elasthanzusatz dennoch häufig für Trikotagen verwendet.
MASCHENWARE UND WEBSTOFF UNTERSCHEIDEN
Gewebe und Maschenware sind nicht immer leicht zu unterscheiden.
Testen Sie, ob der Stoff ausfranst – Maschenware franst nicht leicht aus. Wenn es Ihnen also gelingt, einzelne Fäden abzuziehen, handelt es sich um einen Webstoff.
Sie können aber auch noch neugieriger sein und professionellere Methoden anwenden!
Dehnen Sie den Stoff in Querrichtung („Schuss“), dann in Längsrichtung („Kette“). Wenn er sich in eine oder beide Richtungen dehnt, handelt es sich um Maschenware. Dehnen Sie dabei nicht diagonal, denn in Schrägrichtung ist auch Webstoff dehnbar – dies hilft also nicht bei der Unterscheidung.
Allerdings kann ein Webstoff auch Elasthan enthalten und Sie so in die Irre führen. Die Elastizität unterscheidet sich jedoch von der einer Maschenware: Webstoff mit Stretchanteil ist meist nur querelastisch, und auch dies nicht so ausgeprägt wie Maschenware. Betrachten Sie auch die linke Stoffseite oder halten Sie den Stoff gegen das Licht, um seine Struktur zu erkennen. Wenn Sie kleine „V“ sehen, handelt es sich um Maschenware.

Filz
Filz ist eine nicht gewebte Textilie, die durch Verbinden, Verfilzen und Verdichten einzelner Fasern hergestellt wird. Filz kann aus 100 % Naturfasern bestehen, wird allerdings zunehmend aus Kunstfasern angefertigt. Ein Anteil von mindestens 30 % Naturfasern ist jedoch für einen ausreichenden Zusammenhalt erforderlich.
Filz ist ein weiches, anschmiegsames Material, das bereits in der Urgeschichte hergestellt wurde und heute noch geschätzt wird. Traditionell werden die Fasern mit heißem Wasser und Seife verfilzt (Nassfilzen). Bei industrieller Herstellung werden hierzu meist spezielle Filznadeln verwendet (Trockenfilzen).
Um das dichte, feste Flächengebilde zu erhalten, wird Filz hauptsächlich aus Wollfasern hergestellt, denen manchmal Fasern aus Viskose oder Polyester beigemischt werden.
Spitze
Von Italien aus, wo sie im 16. Jahrhundert erstmals gefertigt wurde, hat die Spitze bis heute ganz Europa erobert. Sie wird maschinell oder von Hand hergestellt. Dazu werden Fäden verkreuzt und verschlungen, sodass Motive entstehen, zwischen denen der Stoff durchbrochen ist.
Spitzengarn kann aus Leinen, Baumwolle, Seide, Nylon, Viskose oder Polyester bestehen, aus Gold oder Silber … Spitze ist ein Luxussymbol, das häufig in der Haute Couture verwendet wird und künstlerisches Geschick sowie Fingerfertigkeit erfordert.
Man unterscheidet drei Arten von Spitze:
•Nadelspitze: Auf Velinpapier oder Pergament wird ein Muster gezeichnet. Entlang der Linien wird mit Nadel und Faden ein Grundgerüst gespannt. Diese Trassierfäden werden umstickt und die Zwischenräume teils mit Spitzenstichen ausgestickt, teils unausgefüllt gelassen. Zum Schluss wird die fertige Spitze vom Trägerpapier abgenommen. Wie die Häkelspitze hat die Nadelspitze also keinen Trägerstoff als Grundlage. Die bekannteste Nadelspitze ist die Alençon-Spitze.
•Klöppelspitze: Mithilfe von Klöppeln, auf die Garn gewickelt ist, wird die Spitze nach einem vorgezeichneten und auf einem Klöppelkissen befestigten Motiv angefertigt. Die Chantilly-Spitze, eine der bekanntesten Klöppelspitzen, wird meist aus schwarzer Seide hergestellt, hauchzart und mit floralen Motiven. Auch die Cluny-Spitze ist eine Klöppelspitze, die auf der ganzen Welt angefertigt wird. Traditionell wird sie aus weißem Baumwollgarn oder cremefarbenem Leinengarn gearbeitet – ohne sogenannten Grund. Sie besteht hauptsächlich aus Formschlägen, die meist als Rosette oder längs angeordnet sind.

Chantilly-Spitze „Nestinne“, elfenbein (Art.-Nr. 0001 0554).
•Maschinenspitze: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Maschinen zur Spitzenherstellung entwickelt und begründeten den Ruf von Calais. Eine Maschine ist nach dem Engländer Leavers benannt: Bei der Leavers-Maschine wurde eine Tüllmaschine um eine Jacquardeinrichtung ergänzt und so die Spitzenherstellung perfektioniert. Calaisspitze ist fein, exakt gearbeitet und recht stabil. Es gibt noch eine andere Maschinenspitze, die Raschelspitze. Sie wurde in den 1950er-Jahren in Deutschland entwickelt und hat einen Tüllgrund, auf den Motive aufgestickt werden. Sie ist weniger fein und daher preisgünstiger.
Heute wird Spitze in allen Farben hergestellt und enthält oft einen geringen Elasthananteil. Damit eignet sie sich hervorragend für Wäsche und Dessous, für die sie sehr häufig verwendet wird.
GUIPURESPITZE
Die Guipurespitze ist eine gestickte Spitze ohne Grund; sie besteht allein aus verschiedenen Motiven, die durch die Stickfäden miteinander verbunden sind. Sie ist dicker als eine klassische Spitze und wird wie diese zur Verzierung von Stoffen verwendet.

Guipurespitze „Volutine“, elfenbein (Art.-Nr. 0000 5315).
Veredelungsverfahren
Das älteste Veredelungsverfahren für Stoffe ist das Färben. Schon seit Jahrtausenden verändern Menschen die natürliche Farbe von Stoffen, indem sie diese mit färbenden Substanzen tränken.
Doch außer dem Färben oder Bedrucken gibt es noch weitere Verfahren zur Behandlung oder Veredelung von Textilien. Manche davon sind mechanisch, andere sind chemische Behandlungen. Meist werden sie zum Abschluss der Herstellung eines Web- oder Strickstoffs angewendet. Manche haben keinen sichtbaren Einfluss, verändern aber die Eigenschaften eines Stoffes, andere verändern die Optik.
Färben
Zum Färben benötigt man ein Färbemittel, einen Fixierer und Wasser. Gefärbt werden kann zu verschiedenen Zeitpunkten der Textilherstellung:
•an Fasersträngen, Endlosfasern oder Garn. Diese Stoffe nennt man garngefärbt. Bei der jeweiligen Bindung können so verschiedene Farben verwendet werden wie bei Chambray-Stoff, Fil-à-fil, Jeansstoff etc.
•am fertigen Stoff. Diesen nennt man dann stückgefärbt.
•am fertigen Kleidungsstück.

Fil-à-fil-Stoff, reine Baumwolle, mandarine (Art.-Nr. 0000 0154).
Vor dem Färben muss das zu färbende Material vorbereitet werden. Sind leuchtende Farben gewünscht, muss es gebleicht werden; außerdem muss es von allen Substanzen befreit werden, die ein gleichmäßiges Annehmen der Farbe verhindern würden (Fett, Appretur, Stärke, Seidenleim der Seidenraupen etc.).
Die Farbechtheit ist die Widerstandsfähigkeit von Färbungen gegen verschiedene Einwirkungen, denen ein Stoff ausgesetzt ist: Licht (UV), Waschen, chemische Reinigung, Schweiß, Chlor, Abrieb, Pilling etc. Die Färbung muss also den späteren Anforderungen an den Stoff standhalten (die Farbe eines Vorhangs muss beispielsweise lichtecht/UV-beständig sein).
Stoff kann mit Naturfarben (Cochenille, Orseille/Färberflechte), Indigo, Färberwaid, Walnuss, Krapp/Färberröte …) oder chemischen Substanzen gefärbt werden.
INDIGO
Indigo ist das älteste zum Färben von Bekleidung verwendete Pigment. Es ergibt eine tiefblaue, ins Violett spielende Farbe. Der Farbstoff wird aus den Blättern der Indigopflanze gewonnen, einem Strauch, der in tropischen bis warmgemäßigten Zonen wächst. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Naturfarbstoff durch synthetisch hergestellten Indigo verdrängt.

Auch wenn heute zum Färben von Textilien überwiegend Chemiefarben verwendet werden, erleben die Naturfarben eine Renaissance. Färberwaid aus dem Südwesten Frankreichs und Krapp aus den Niederlanden sind wieder sehr gefragt.
Farbstoffe und Fixierer sowie die Färbetechniken variieren je nach zu färbendem Material: Leinen zu färben erfordert eine andere Vorgehensweise und andere Produkte als das Färben von Polyamid. Auch die Ergebnisse sind unterschiedlich: Polyamid nimmt z. B. besser Farbe an als Polyester, doch für einen melierten oder Moiréeffekt ist Polyester besser geeignet.
Zum Aufbringen des Farbstoffs gibt es verschiedene Verfahren:
•Direktfärbung: Der Stoff wird direkt in das Farbbad getaucht. Der Nachteil dieser Methode ist, dass die Farbe leicht ausblutet (keine waschechte Färbung).
•Beizenfärbung: Durch Vorbehandlung mit einer Beize werden die Fasern auf das Färben vorbereitet.
•Entwicklungsfärbung: eine Abfolge chemischer Reaktionen. Der Stoff wird nacheinander mit verschiedenen Komponenten behandelt, wodurch die Farbe auf dem Stoff erscheint und fixiert wird.
Textildruck
Beim Bedrucken wird mithilfe verschiedener Techniken ein Motiv auf die rechte Stoffseite aufgebracht.
•Handdruck: Die Farbe wird von Hand mit Pinsel, Schwamm, Spraydose etc. aufgetragen.
•Modeldruck: ebenfalls ein Handdruck, bei dem jedoch als Druckform ein (Holz-)Model dient, in das die Druckmotive als Relief geschnitzt werden. Das Model wird mit Farbe bestrichen und auf den Stoff gesetzt, sodass das Druckbild erscheint.
•Walzendruck (Rouleaudruck): die mechanisierte Variante des Modeldrucks. Das Druckbild wird in Kupferzylinder eingraviert oder -geätzt. Der Stoff wird über diese mit Farbe bestrichenen Walzen geführt, sodass das Motiv kontinuierlich aufgetragen wird.
•Siebdruck: Ein feinmaschiges Gewebe wird auf einen Rahmen gespannt und dem Druckbild entsprechend teils mit einer farbundurchlässigen Schablone bedeckt oder beschichtet. Die Farbe wird auf das Gewebe aufgetragen und dringt durch die durchlässigen Partien auf den Stoff durch.

Druck eines Liberty-Tana-Lawn-Stoffes („Mitsi“, Art.-Nr. 0363 1033).
•Rotationsfilmdruck: maschinelles Verfahren, bei dem die Farbe durch die dem Druckmotiv entsprechenden Öffnungen in einer mit der Farbe befüllten Hohlwalze auf den Stoff aufgetragen wird. Dies ist in der Textilindustrie heute noch das gängigste Verfahren.
•Transferdruck: Das Motiv wird mit Dispersionsfarben seitenverkehrt auf ein Spezialpapier gedruckt. Nach dem Trocknen wird es mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt. Durch Wärmeeinwirkung und Druck werden die Farben auf den Stoff übertragen.
•Digitaldruck (Textil-Direktdruck): Mit einem Tintenstrahldrucker wird die Tinte direkt auf den Stoff aufgetragen, sodass Zeile für Zeile das Motiv entsteht. Dieses Verfahren ermöglicht also den Entwurf von Motiven direkt am Computer – ohne vorherige Entwurfsskizzen auf Papier. Es können hochauflösende Drucke ohne Rahmenbegrenzung und in beliebiger Motivgröße angefertigt werden.
BATIK
Batik ist ein sehr altes Textildruckverfahren, das ursprünglich aus Indonesien stammt. Manchmal wird es als Färben durch Aussparen oder Färben mit Wachsreservage bezeichnet. Die Motive werden auf den Stoff gezeichnet und mit flüssigem Wachs bedeckt. Dann wird der Stoff in ein Farbbad getaucht, wobei nur die wachsfreien Partien die Farbe annehmen (Negativdruck). Der Vorgang des Wachsauftragens und Färbens kann für verschiedene Farben oder hellere und dunklere Farbtöne mehrfach wiederholt werden. Ist das Färben beendet, wird das Wachs durch Hitzeeinwirkung entfernt.

Optische Veredelung
Stickerei: Es gibt ganz unterschiedliche Stickstiche, mit denen ein Textil bzw. eine bestimmte Partie von Hand oder maschinell verziert werden kann. Farben und Umfang der Stickerei sind dabei variabel. Es können auch Perlen oder Pailletten auf Stoff gestickt werden, sodass dieser Struktur und glitzernde Effekte erhält. Mit der Applikationstechnik kann ein textiles Motiv durch Umsticken der Konturen auf einen anderen Stoff aufgebracht werden.
Stonewash-Verfahren: seit den 1980er-Jahren populäres, vor allem an Jeans angewendetes Verfahren, bei dem dunkler Jeansstoff zusammen mit Bimssteinen gewaschen wird. Auch die Behandlung einzelner Partien („Moustache-Effekt“ an den Oberschenkeln) ist möglich. Es gibt diverse, teils für Arbeiter (Sandstrahlen) und Umwelt (chemische Produkte und extremer Wasserverbrauch) sehr schädliche Methoden, aber auch innovative Verfahren wie die von Marithé und François Girbaud entwickelte Lasertechnik. Parallel dazu gibt es Verfechter des natürlichen Abtragens einer Jeans, durch das diese erst ihre richtige „Patina“ erhält. Dieser Prozess dauert zwar sehr lange, respektiert dafür aber die Arbeiter und die Natur.
Crashen und Plissieren: Durch diese Verfahren wird ein Textil elastischer und engt beim Tragen weniger ein. Um diesen Effekt bei Synthetikstoffen zu erzielen, benötigt man Wärme und Druck (Polyester und Acetat eignen sich dafür besonders). Bei Naturfasern benötigt man Wärme, Wasser und bestimmte chemische Stoffe. Der fertige Stoff wird mit Plisseeschablonen aus Karton (tiefe und sehr scharfe Falten) oder maschinell (feinere Plisseefalten oder willkürlich verteilte Crashfalten) bearbeitet. Fortuny-Plissee ist ein Seidenstoff mit unregelmäßigen Plisseefalten. Dieser Stoff und das Delphos-Kleid, revolutionierten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Mode, doch Mariano Fortuny nahm das Geheimnis der Herstellung dieses einzigartigen Plisseestoffs mit ins Grab. Anfang der 1990er-Jahre brachte Issey Miyake mit seiner Linie Pleats Please frischen Wind in die Mode – fertige Kleidungsstücke aus Polyester, die mittels Hitze und Druck in besonders gleichmäßige und haltbare Plisseefalten gelegt werden.

Crêpe de Chine „Mini plissé crayon“, elfenbein (Art.-Nr. 0001 0772).
Beschichtung und Laminierung: Beschichtete Stoffe sind Textilien, auf die eine Kunststoffschicht aufgetragen wurde. Nach dem Trocknen bildet diese dünne Schicht aus PVC oder Polyurethan einen undurchlässigen Film, der alle „Poren“ des Stoffes verschließt (wenn man gegen den Stoff bläst, geht keine Luft hindurch). Beim Laminieren dagegen werden mehrere Textilschichten miteinander verklebt, meist unter Hitzeeinwirkung. Technische Textilien, Doubleface- oder mehrlagige Stoffe oder auch die Körbchen von BHs und Bademoden werden durch Laminierung hergestellt.
Ausbrennen: Diese Technik wird an Stoffen angewendet, die aus zwei verschiedenen Fasern bestehen. Ein chemisches Produkt, die Ätzpaste, entfernt in bestimmten Bereichen die eine Faser, während die andere unbeschädigt bleibt. So können teilweise transparente Stoffe oder auch Samtausbrenner hergestellt werden.
Funktionale Veredelung
Das gebräuchlichste Verfahren ist hier ein leichtes provisorisches Stärken, das einem Web- oder Strickstoff Festigkeit verleiht. Es gibt jedoch zahlreiche weitere Methoden, mit denen die Funktionalität eines Stoffes und die ursprünglichen Eigenschaften der Fasern verbessert werden können.
Aufrauen: Damit ein Stoff flauschiger wird, kann eine (oft die linke) Seite mit Kratzen (mit Metalldornen bestückte Walzen) aufgeraut werden. Die so aufgerichteten Fasern verleihen dem Stoff Volumen und einen weicheren Griff. Er hält auch besser warm (weil er mehr Luft speichern kann), wird allerdings weniger haltbar. Baumwollflanell und Sweatshirtstoff sind aufgeraute Stoffe.

Detail eines aufgerauten Sweatshirtstoffs, Spitzenqualität, khaki (Art.-Nr. 0000 3294).
Walken: ein Verfahren zum Verfilzen, das aber im Unterschied zum Filzen an gewebten Wollstoffen angewendet wird, um sie wasserabweisend zu machen. Unter Einwirkung von Wärme und Seifenwasser sowie durch Kneten, Pressen und Schlagen schrumpft der Stoff, wird fester und voluminöser.
Geruchshemmende, antibakterielle, antistatische, milbenabweisende, fungizide und UV-blockende Appreturen sowie Fleckschutz, Antipilling- und Bügelleichtausrüstung werden in Form chemischer Produkte und durch Wärmeeinwirkung auf die Textiloberfläche aufgebracht.
Stoffauswahl
Zur Auswahl des geeigneten Stoffes für ein Nähprojekt muss man die Beschaffenheit des Stoffes verstehen, d. h. wissen, wie der Stoff bei Verarbeitung und Verwendung reagiert. Nur so kann man vorab beurteilen, wie er sich nach dem Zuschneiden und Nähen verhält.
Die Haupteigenschaften, die das Verhalten und die Optik eines Stoffes bestimmen, sind seine Dichte, sein Fall und seine Struktur. Bei der Stoffauswahl spielen jedoch auch Fragen nach der Qualität der Herstellung und – falls möglich – nach seiner Herkunft eine Rolle.
Die Grammatur
Grammatur heißt das Stoffgewicht, bezogen auf eine bestimmte Fläche – entweder auf einen Quadratmeter (dann wird sie in g/m² ausgedrückt) oder auf einen laufenden Meter (g/lfm). Bei jedem Stoff, der mehr als einen Meter breit liegt, ist die Grammatur pro laufendem Meter also zwangsläufig höher als die Grammatur pro Quadratmeter (Beispiel: Bei einer Stoffbreite von 147,5 cm beträgt die Grammatur eines Cordsamts 215 g/m² und 317 g/lfm).
Je nach verwendeter Faser, Garnbeschaffenheit und Bindungsart (Gewebe) bzw. Strick- oder Wirkart (Maschenware) ist ein Stoff schwer oder leicht.
Die Grammatur ist eine interessante Angabe für die Stoffauswahl, denn sie informiert über die Dichte und Dicke eines Stoffes, aber auch über seine mehr oder weniger große Transparenz. Je niedriger die Grammatur, desto dünner, leichter bzw. transparenter ist der Stoff und umgekehrt: Je höher die Grammatur, desto dicker und dichter ist der Stoff.
Zur Orientierung hier einige Beispielangaben für verschiedene Stofftypen:
•Voile: 38 g/m2 oder 53 g/ml
•Batist: 75 g/m2 oder 109 g/ml
•Leinen: 185 g/m2 oder 296 g/ml
•Denim: 233 g/m2 oder 350 g/ml
•Walkstoff: 520 g/m2 oder 780 g/ml
Der Fall
Der Fall bezeichnet die natürliche Form, die ein Stoff beim Aufhängen oder Tragen (Kleidungsstück) annimmt.

Links: Seidenmusselin, uni, stahlgrau (Art.-Nr. 0000 1004). Fließender Fall. Der Stoff ist leicht, weich und geschmeidig und lässt sich sehr gut drapieren.

Rechts: Doppelte Georgette-Seide, uni, elfenbein (Art.-Nr. 0000 3010). Lebhafter, dynamischer Fall voller Sprungkraft.

Crêpe Marocain, uni, granatrot (Art.-Nr. 0000 3736). Schwerer Fall. Der Stoff ist schwer, aber fließend.

Popeline, 59 Fäden/cm, uni, koralle (Art.-Nr. 0001 0783). Steifer Fall. Der Stoff ist sehr strapazierfähig, leicht zu verarbeiten und eignet sich für sehr strukturierte Modelle mit klaren Konturen.

Merino-Walkstoff, uni, waldveilchen (Art.-Nr. 0000 0927). Satter Fall. Der Stoff ist dicht mit etwas Stand und eignet sich gut für klar strukturierte Modelle.

Molton-Frotteejersey, uni, perlgrau (Art.-Nr. 0000 3046). Geschmeidiger Fall. Der Stoff ist weich und flauschig und eignet sich für kuschelige, anschmiegsame Modelle.

Seidentaft, 59 g/m², feldstein (Art.-Nr. 0000 4807). Steifer, raschelnder Fall. Der Stoff ist fest und hat Stand, sodass er sich zu üppig gebauschten Kreationen verarbeiten lässt.
FALL UND ABFALL (VERSCHNITT)
Abfall (Verschnitt) ist etwas ganz anderes als der Fall eines Stoffes – es ist ein Stoffrest, der beim Zuschneiden eines Modells entsteht. Diese Reste werden meist weggeworfen, doch ich rate Ihnen, einige aufzuheben, um Stichproben anzufertigen und die Nähmaschine oder Overlockmaschine einzustellen. Auch für Applikationen kann der Verschnitt aufbewahrt werden.