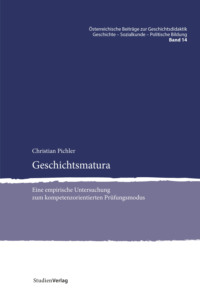Kitabı oku: «Geschichtsmatura», sayfa 13
Geschichte-Reifeprüfungen fanden im Beobachtungszeitraum an 19 der 22 AHS Kärntens (86,32 %) statt, an drei Schulen wurde das Fach von Schüler*innen nicht gewählt. Die meisten Prüfungen (37 Examen) wurden am BG/BRG „Ingeborg Bachmann“ in Klagenfurt abgehalten (19,89 %), gefolgt vom BG Tanzenberg und dem BG/BRG St. Veit an der Glan mit jeweils 17 Prüfungen (9,14 % aller Prüfungen). Die geringste Zahl gab es am BORG „Auer von Welsbach“ in Treibach-Althofen mit 2 Prüfungen (1,08 % aller Prüfungen) und am BRG Spittal an der Drau mit 1 Prüfung (0,54 %). Keine Geschichte-Matura gab es am BG für Slowenen in Klagenfurt, am RG St. Hemma in Gurk und am BORG Wolfsberg. 160 der 185 GSPB-Prüfungen erwuchsen aus dem Pflichtgegenstand (86,49 %) und 25 (13,51 %) aus dem WPG (Tabelle 3).650
| Note | Zahl | Anteil |
| Sehr gut (1) | 110 | 59,46 % |
| Gut (2) | 47 | 25,41 % |
| Befriedigend (3) | 19 | 10,27 % |
| Genügend (4) | 7 | 3,78 % |
| Nicht genügend (5) | 2 | 1,08 % |
| Summe | 185 | 100,00 % |
Tabelle 4: Prüfungsleistungen der Kandidat*innen der Geschichts- und Politikprüfungen 2015 nach dem staatlichen Leistungsbeurteilungssystem (Quelle: Statistik des LSR für Kärnten 2015).
Betrachtet man die Leistungen der Kandidat*innen nach den amtlich festgesetzten Beurteilungen der Prüfungskommissionen (Tabelle 4), zeigt sich, dass 110 Kandidat*innen (59,46 %) mit „Sehr gut“ beurteilt wurden, 47 mit „Gut“ (25,81 %). Somit haben knapp 85 % der Maturant*innen „[…] eine über das Wesentliche hinausgehende […]“651 Prüfungsleistung attestiert bekommen. Nur zwei Kandidat*innen haben die Reifeprüfung aus GSPB nicht bestanden und wurden eingeladen, sie zum ersten Nebentermin (September 2015) zu wiederholen. Der Notendurchschnitt ergibt den Wert 1,62.
Ergebnis und Analyse: Der statistische Befund über den ersten Durchgang der kompetenzorientierten Reifeprüfung zeigt, dass das Fach GSPB im Jahr 2015 in Kärnten zu den beliebten Prüfungsfächern gehört. Es wird in 86 % aller Schulen gewählt und repräsentiert 6,8 % aller mündlichen Examen.652 Drei Schulen liegen über dem Durchschnitt, in drei Schulen wird es nicht belegt. Die Leistungen der Kandidat*innen nach Schulzensuren sind als hervorragend einzustufen. Von den Grunddaten aus gesehen ist Geschichte ein geschätztes Reifeprüfungsfach mit ansprechenden Resultaten.
7.2 Auswertungsinstrumente
7.2.1 Entwicklung des Leitfadens zur Kompetenzanalyse
Da sich das Design der Reifeprüfung an der EPA orientiert, ist es naheliegend erschienen, die Auswertungsmethode zur Identifizierung von Kompetenzen der Studie von Schönemann et all. zum Vorbild zu nehmen.653 Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Unterschiede zwischen den Prüfungsformaten eine identische Anwendung der Verfahren nicht erlauben. Trotz ähnlicher Aufgabenmuster divergieren die Performanzen stark. Ein Grund dafür ist das Prüfungssystem. Kompetenzmessung in einem zentral gesteuerten Prüfungsvorgang führt zu vergleichbaren Ergebnissen, relativ frei gestaltete Aufgabenformate fördern das nicht. Dazu treten unterschiedliche Bedingungen für die Kandidat*innen bei der Suche nach Lösungen und deren Darstellung. Schönemann et all. haben Performanzen (Klausuren) ausgewertet, für deren Konzeption und Verschriftlichung die Kandidat*innen über vier Stunden Zeit gehabt haben. Die Produkte sind konzipierte, strukturierte, ausführliche Fließtexte, aus denen Kategorien ohne allzu große methodische Hemmnisse deduktiv ableitbar gewesen sind.654 Solche Bedingungen unterstützen die Untersuchung des Zusammenhangs von Aufgabenstellung, Lösungserwartungen und Leistungen. Die Reifeprüfung sieht demgegenüber eine halbstündige Vorbereitungszeit mit anschließendem mündlichem Examen vor. Die Narration entwickelt sich aufgrund des dialogischen Charakters der Prüfung grundlegend anders als bei geschriebenen Texten. Die relativ kurze Prüfungszeit (10–20 Minuten) und das Gesprächsformat655 bedingen knappe und segregierte Performanzen, deren Kompetenzausprägung mitunter stark von der Gesprächsführung durch die Prüfungspersonen abhängt. Ein weiterer Unterschied betrifft den Adressatenkreis. Zielgruppe des Zentralabiturs sind primär Schüler*innen, die einen Leistungskurs besuchen. Der Entschluss, zum Abitur anzutreten, folgt daher vermutlich entschiedener fachlichen Interessen als es bei der Reifeprüfung der Fall ist, weil er bereits während des Besuchs der Sekundarstufe II getroffen wird. Im Gegensatz dazu wählen österreichische Schüler*innen erst knapp fünf Monate vor der Prüfung ihre mündlichen Fächer. Deren Bestimmung erfolgt, so die Annahme, zwar ebenfalls nach fachlicher Neigung, die Entscheidung kann aber durch andere Faktoren (z. B. Lehrperson) beeinflusst sein.656 Schließlich unterziehen sich dem deutschen Prüfungsverfahren Kollektive, sodass Erkenntnisse sowohl über den Unterricht als auch über den Ausprägungsgrad von Kompetenzen eines Jahrgangs möglich sind. In Österreich treten demgegenüber Individuen zur Kompetenzüberprüfung an, was generalisierende Aussagen ausschließt. Dieser Umstand beeinträchtigt die Reliabilität der Ergebnisse.
Trotz Varietäten finden sich bei Schönemann et all. Kriterien, die für die Konzeption eines Leitfadens zur Reifeprüfungsanalyse genutzt werden können. Bei den Aufgabenstellungen sind das die Untersuchung des Materials (Passung zur Aufgabenstellung, Relevanz, Repräsentativität, editorische Korrektheit) und die didaktische Konzeption. Auch die Analyse der Kandidat*innen-Leistungen kann grundsätzlich Schönemann et all. folgen. Die Forscher orientieren sich an den Maßstäben der EPA, weil diese eine Verbindlichkeit aufwiesen, der sich alle Beteiligten verpflichtet fühlen. Die Texte werden nach Kategorien (deduktiv und induktiv) strukturiert. Für den AFB I (Reproduktion) sind es folgende Kriterien: (a) die Fähigkeit zur Unterscheidung von Quelle und Darstellung; (b) die formale Textbeschreibung; (c) die Textwiedergabe. Für den AFB II (Transfer) sind es: (a) das Vermögen der Textanalyse und -interpretation, (b) das Herstellen eines Bezugs zwischen Arbeitsauftrag und Text, (c) die Fähigkeit zur historischen Kontextualisierung, (d) zum Gebrauch fachlicher Begriffe und Kategorien und (e) zur historischen Sachurteilsbildung. Die Kriterien des AFB III (Reflexion und Problemlösung) umfassen das (a) Vermögen zur historischen Werturteilsbildung und (b) zur Reflexion (bewusste Abkehr von Alltagskonzepten und Simplifizierungen).657 Sie prinzipiell auf die Reifeprüfungsanalyse anwendbar, bedürfen aber einer Adaptierung auf die Verhältnisse des mündlichen Examens. Die Entscheidung, die Konzeption des analytischen Leitfadens für die Reifeprüfung an Schönemann et all. auszurichten, wird getroffen, weil beide Abschlussprüfungen auf der Grundlage der Kompetenzdefinition von Weinert und der Bedingungen von Klieme verordnet worden sind. Die amtlich festgesetzten Leistungserwartungen (historisch-politische Kompetenzen) erscheinen kongruent, das Prüfungsdesign ist verwandt und die Schüler*innen entstammen einigermaßen vergleichbaren Schultypen. Die Konzeption des Rasters für die Reifeprüfung wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
7.2.1.1 Kriterienraster zur inhaltlichen Analyse österreichischer Performanzen
Weil individuelle Denkoperationen nicht quantifizierbar sind, werden die Performanzen einer Inhaltsanalyse unterzogen.658 Der Analyse-Raster ist das zentrale Auswertungsinstrument. Mit seiner Hilfe gilt es zu erkunden, ob die Performanzen historisches Denken in erwarteter Weise evident machen. Die im Raster angeführten Kriterien bieten die methodische Orientierung. Grundsätzlich wird der Korpus der Prüfungen nach deduktiv gesetzten Kategorien analysiert. Es sind aber auch Kandidat*innen-Äußerungen zu erwarten, die induktiv berücksichtigt werden müssen, weil das Prüfungsverfahren vermutlich individuelle Phänomene sichtbar macht, die die Leistungen der Kandidat*innen signifikant beeinflussen. Es wurde vom Studienautor entschieden, den Raster entlang der Vorgaben für die kompetenzorientierte Reifeprüfung zu entwickeln, weil zu erwarten gewesen ist, dass sich Aufgabenersteller*innen und Prüfende an ihnen orientieren.659
7.2.1.2 Schritt 1: Aufgabenprüfung
Schönemann et all. folgend ist zu klären, ob Thema, Aufgabe und Performanz in einem Verhältnis zueinanderstehen, das die Ermittlung historisch-politischer Kompetenzen ermöglicht.660 Aufgabenstellungen, die fachliche Kompetenzen evident machen, sind ohne zu bearbeitende Materialien661 wenig funktional. Daher hat sich die AG dazu entschlossen, die Bindung der Aufgabe an Material dringend zu empfehlen. „Jede Aufgabenstellung muss sich an einer Quelle oder einer Darstellung und am Unterrichtsgeschehen orientieren! Es muss also zu jeder Frage eine Quelle vorgelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese nicht nur illustrativen Charakter hat, sondern deutlich in die Aufgabenstellung einbezogen wird.“662 Die Materialprüfung umfasst die Aspekte Relevanz und Repräsentativität der ausgewählten Quellen, Darstellungen und Produkte der Geschichtskultur. Sie kontrolliert, ob Eingriffe (z. B. sinnverändernde Kürzungen, Änderungen u. dgl.) vorgenommen worden sind, die die Kontextualisierung der Inhalte bzw. Aussagen beeinträchtigen oder die Lösung der Aufgabe erschweren. Zu prüfen ist die Passung von TA und Materialien,663 denn sie ist für die Konzeption einer Narration ebenso relevant wie das Arrangement der TA, durch das ein schrittweises Erarbeiten der Lösung angeleitet werden soll.664 Das Material muss bearbeitbar sein. Das bedeutet, die Aussagen sollen Positionen erkennen lassen und ausreichend Parteilichkeit aufweisen (Kontroversialität), um unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen. Der schüler*innengerechte Gehalt der Materialien (Schwierigkeitsgrad) ist ebenso zu untersuchen wie die Angemessenheit des Umfangs, damit eine analytische Durchdringung zu bewältigen ist (Menge). Problematisch für die Sicherung der Qualität der Aufgaben ist die weiche Regelung ihrer Konzeption in den rechtlich verbindlichen Texten. Die RPVO spricht lediglich davon, dass den Kandidat*innen „[…] eine kompetenzorientierte Aufgabenstellung, welche in voneinander unabhängige Aufgaben mit Anforderungen in den Bereichen der Reproduktions- und Transferleistungen sowie der Reflexion und Problemlösung gegliedert sein kann, schriftlich vorzulegen“665 ist. Sörös weist ausdrücklich darauf hin, dass die AG darunter materialgebundene Arbeitsaufträge versteht, weshalb die Konferenz der Schulaufsicht beschlossen hat, die Beachtung der Bestimmungen des Leitfadens österreichweit allen Prüfungsorganen aufzutragen.666 Nicht geregelt ist die Zahl der TA. Aus der RPVO lässt sich zwar ableiten, dass alle drei AFB zu berücksichtigen sind. Das muss nicht bedeuten, dass pro AFB eine TA formuliert zu werden hat. Folgt man Weymar und Jeismann sowie den Zielen von Narrativität, ist die Aufgabe so zu konzipieren, dass Sinnbildungen ermöglicht werden. Das setzt aufeinander abgestimmte Arbeitsaufträge voraus, damit ein Thema idiographisch erarbeitet werden kann. Radikale Sequenzierungen (quasi abzuarbeitende Prüfungslisten) behindern das Erreichen dieses Ziels. Daher ist eine in sich geschlossene Aufgabenstellung, die miteinander verknüpfte Arbeitsaufträge beinhaltet, ein Qualitätsmerkmal einer gelungenen Prüfungsaufgabe. Zu klären ist somit, ob die Aufgabenstellung den Vorgaben der RPVO (Berücksichtigung der AFB, Einsatz von Operatoren) entspricht und inwiefern den Empfehlungen der Fachdidaktik Folge geleistet wird.667 Resümee: Die Aufgabenprüfung umfasst folgende Kriterien: (1) Relevanz, Repräsentativität, analytische Bearbeitbarkeit des Materials und dessen Passung zu Thema und Aufgabe; (2) rechtliche Konformität der Aufgabenstellung; (3) didaktische Konformität der Aufgabenstellung.
7.2.1.3 Schritt 2: Deduktive Analyse der Performanzen
Die kriteriengeleitete Identifizierung historischer Kompetenzen in den Performanzen folgt methodisch Schönemann et all.668 und inhaltlich den Interpretationen der EPA-Kriterien durch die AG. Gegliedert wird der Raster entlang der AFB, weil zu erwarten ist, dass sich die Ersteller*innen der Arbeitsaufträge an den Bestimmungen der Vorgaben orientieren. Die Kompetenz-Kriterien werden aus der FUER-Theorie abgeleitet und den AFB zugeordnet.
Der AFB I („Reproduktion“) verlangt nach der EPA den Nachweis von „Verfügungswissen“, i. e. die Fähigkeit der Wiedergabe deklarativen Fachwissens (geschichtswissenschaftliches Kontextwissen), die Anwendung der Kenntnisse analytischer Arbeitstechniken im Umgang mit Materialien (prozedurales Wissen) zum Zweck der Entnahme und Wiedergabe von Inhalten und die Identifizierung der Materialgrundlage. Die Überprüfung des Umgangs mit diesen Kriterien wird als Sachkompetenz-Analyse verstanden. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Aspekt Fachwissen. Die KMK spricht explizit von „[…] fundierte(m) Wissen über Vergangenes, das sowohl in seiner Eigenwirklichkeit als auch unter der Perspektive der Vorgeschichte wahrgenommen wird. […]. Die Prüflinge verfügen über umfangreiche Kenntnisse über historische Ereignisse, Personen, ideengeschichtliche Vorstellungen, Prozesse und Strukturen sowie vom Leben der Menschen in unterschiedlichen Gesellschaften und zu unterschiedlichen Zeiten. […].“669 Dieses „sichere Fachwissen“ muss reproduziert werden können, weshalb es laut EPA ein Deskriptor für Sachkompetenz ist.670 Nach FUER wird Fachwissen als Voraussetzung kompetenten Umgangs mit Geschichte gesehen. Körber meint, dass „(…) die Fähigkeit zur Reproduktion von ‚Fachwissen‘ und konventionell gültiger Deutungen nicht in ein Kompetenzmodell gehört. ‚Wissen‘ ist für historische Kompetenzen zwar konstitutiv, […], findet seinen – unbestritten wichtigen – Platz also nicht […] innerhalb eines Kompetenzmodells, sondern daneben, in einem zweiten Instrument – dem ‚Kerncurriculum‘„.671 Trotz der Annahme, dass an den österreichischen Gymnasien eine maßgebliche Gruppe der Lehrenden Bildung mit Wissenserwerb gleichsetzt672 und obwohl der österreichische Gesetzgeber mit der Verordnung des AFB-Systems auch die Vorstellung der deutschen KMK von Fachwissen als integrativem Bestandteil der Sachkompetenz übernommen zu haben scheint, differenziert die vorliegende Studie, FUER folgend, zwischen „Faktenwissen“ und „konzeptionellem Wissen“ (Kategorien, Konzepte).673 Sie sieht in der bloßen Reproduktion erlernter Daten, Fakten, Ereignisse und Fachtermini, ohne Nachweis der Kenntnis der Konzepte, zwar eine Basis zur Entfaltung domänenspezifischer Kompetenzen, erkennt jedoch erst in der Anwendung prozeduralen Wissens zum Zweck der Generierung fachlichen Wissens eine Fähigkeit im Weinert’schen Sinn.674 Die AG formuliert dazu im Leitfaden: Im AFB I stehe „[…] die Reproduktion im Mittelpunkt. Das Wiedergeben von Sachverhalten […] sowie ein rein reproduktives Nutzen von Arbeitstechniken […].“675 Laut Öhl handelt es sich dabei um Operationen „[…] mit dem Ziel, zu Verfügungswissen zu gelangen. Dabei stehen zunächst konkrete Ereignisse im Vordergrund, die sowohl methodisch als auch inhaltlich untersucht werden, um […] bei folgenden Anwendungen Wissen zur Verfügung zu haben.“676 Die Fähigkeit bestehe nicht im Bewältigen der (selbstständigen) Aneignung von Wissen und dessen Wiedergabe, sondern in der zielgerichteten Anwendung im Zuge der Sinnbildung. Laut Buchsteiner et all. ist analytisch zu erheben, ob mentale Vorgänge so funktionieren, dass Kandidat*innen „die Selektion von Informationen“ gelingt, die Entnahme von Inhalten und Aussagen aus Materialien und deren korrekte Wiedergabe. Es sei „[…] eine zusammenhängende Formulierung notwendig, um die zwischen den Informationen hergestellten Beziehungen erkennbar werden zu lassen“.677 Daher differenziert die Studie bei der Ermittlung der Wissensbestände zwischen deklarativem Wissen (reproduzierte Begriffe, Daten, Fakten) und konzeptionellem. Letzteres wird als Fähigkeit der Sachkompetenz überprüft (Kriterium 1). Es wird Nachschau gehalten, ob es gelingt, Wissen im Sinne von FUER zu strukturieren (Strukturierungskompetenz). Außerdem wird die Fähigkeit der bewussten und sachgerechten Anwendung fachlicher Termini (Begriffskompetenz) beleuchtet.
Das theoretische Fundament des zweiten Kriteriums („Kenntnis der Materialgrundlage“) bilden die Differenzierung des Quellenbegriffs (Ermöglichung authentischer Zugänge zur Vergangenheit) von dem einer Darstellung (Produkte der Geschichtskultur) und das Bewusstsein, dass Materialien perspektivisch sind.678
Das dritte Kriterium beschreibt die Fähigkeit, die Inhalte bzw. Aussagen von Materialien erschließen zu können. Die Basis dafür bilden Kenntnisse über Adressatenorientierung, Datierung und über den*die Autor*in. Die Operationen umfassen das Erkennen der Gliederung, die Beschreibung der wesentlichen Inhalte bzw. Aussagen (z. B. Argumentationen) und das Vermögens, diese zu belegen. Dazu ist eine analytische Distanz zur Position und zur Sprache des*der Autors*in des Materials erforderlich.679 Die Empfehlungen der AG stellen die zentralen Aspekte der Sachkompetenz nach FUER verknappt dar. Im Leitfaden heiß es: „Darunter versteht man die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft historische Konzepte, Kategorien und Begrifflichkeiten in bestehende Wissensbestände einzubeziehen und verfügbar zu halten. Sachkompetent ist nicht bereits jene/r, der/die Wissen hat, sondern erst wer Inhalte kategorisieren, vergleichen und anwenden kann.“680 Eine Erläuterung der Deskriptoren epistemologische Prinzipien, subjektbezogene Konzepte, inhaltsbezogene Kategorien, methodische Verfahrensscripts etc. gibt es nicht, obwohl eine klare Vorstellung davon für den Vorgang der Kontextualisierung unumgänglich ist. Resümee: Der Leitfaden umfasst die Kriterien kategoriales Wissen (1), Kenntnis der Materialgrundlage (2) und Fähigkeit zur inhaltlichen Erschließung der Materialien (3). Faktenwissen wird zwar erhoben und nach dem Modus richtig, ansatzweise korrekt und falsch differenziert, nicht aber zur Ermittlung der Sachkompetenz herangezogen. (Tabelle 17).
Der AFB II („Reorganisation und Transfer“) widmet sich nach der EPA und nach FUER dem Nachweis des Verfügens über Methodenkompetenz. Erwartet wird ein selbstständiges, verfahrensgeleitetes, analytisches Bearbeiten des Materials samt Deutung der Inhalte. Damit wird die De- und Re-Konstruktionsfähigkeit überprüft. Dies geschieht, indem sowohl die Qualität der Interpretation der identifizierten Inhalte bzw. Aussagen der Materialien untersucht wird als auch das Vermögen, die Ergebnisse mit dem deklarativen Fachwissen zu einer sinnbildenden Erzählung zu verbinden. Erwartet wird die Fähigkeit zur empirischen Überprüfung und korrekten Einordnung der extrahierten und beurteilten Fakten in den historischen Kontext und das Vermögen, die Ergebnisse der Interpretation plausibel zu begründen. Mit der Bewältigung des AFB II wird der Nachweis erbracht, Kategorien, Konzepte, Begriffe und deren Deutungen in einen Sinnzusammenhang zu bringen, der problemorientiert (leitende Fragestellung) sein kann und der Orientierung dient.681 Resümee: Kriterien des Leitfadens sind Interpretation (1), Sachurteilsbildung (2) und Kontextualisierung (3). (Tabelle 17).
Der AFB III („Reflexion und Problemlösen“) verlangt, laut der EPA, einen „[…] reflexiven Umgang mit neuen Problemstellungen, den eingesetzten Methoden und gewonnenen Erkenntnissen, um zu Begründungen, Folgerungen, Beurteilungen und Handlungsoptionen zu gelangen“.682 Zu diesem Zweck sind zwei mentale Operationen zu überprüfen: die Fähigkeit, Urteile zu bilden und das Vermögen, die eigenen Vorstellungen von Geschichte kritisch zu reflektieren. Wertend zu urteilen meint, anhand gegenwärtiger ethischer Systeme (anerkannte gesellschaftliche, ethische, erkenntnistheoretische oder normative Maßstäbe, z. B. Menschenrechte, religiöse, psychologische, philosophische Überzeugungen etc.) historisch-politische Phänomene zu taxieren, dazu einen Standpunkt einzunehmen und diesen plausibel zu begründen. Sie sind im Zuge der Darstellung der Bewertung offenzulegen. Unter Reflexionsfähigkeit wird das Vermögen verstanden, mittels kritischer mentaler Prozesse (ausgelöst durch Erkenntnisvorgänge) die vorhandenen Vorstellungen über Geschichte und Politik entweder bewusst zu festigen oder zu verändern. Das Vermögen, das eigene Geschichtsbewusstsein zu reorganisieren, steht somit im Zentrum der Anforderung. Die Bildung plausibler Hypothesen kann eine Manifestation der Reflexionsfähigkeit darstellen.683 Hier treffen sich die Intentionen der EPA und von FUER. Beide Kriterien sind Elemente der Orientierungskompetenz nach FUER, decken aber nur einen Teil dieses Bereichs ab.684 Resümee: Kriterien des Leitfadens sind Werturteilsbildung (1) und Reflexionsfähigkeit (2). (Tabelle 5).
| AFB | Kriterien |
| REPRODUKTION (Sachkompetenz) | Fachwissen: Verfügen über kategoriales, konzeptionelles historisch-politisches Wissen und über die Fähigkeit, Wissen mittels Arbeitstechniken erwerben • Konzeptionelles Fachwissen (Kategorien, Konzepte) • Historische Begriffskompetenz • Historische Strukturierungskompetenz Materialgrundlage: Grundkenntnisse • Beschreibung der Art des Materials Wiedergabe: Verfahrensgeleitete Reproduktion • Relevante Informationen, Aussagen, Inhalte erkennen, • sie dem Material entnehmen und • darstellen können |
| TRANSFER (Methodenkompetenz) | Interpretation: Analysefähigkeit • Deutung der Aussagen bzw. Inhalte der Materialien Sachurteilsbildung: Analysefähigkeit • Triftigkeitsprüfung der Aussagen bzw. Inhalte der Materialien Kontextualisierung: • Inhaltliche Verknüpfung der Analyse-Resultate mit den Erkenntnissen der Fachwissenschaft zu einer sinnbildenden Erzählung |
| REFLEXION/PROBLEMLÖSEN (Orientierungskompetenz) | Werturteile: Urteilsbildung und deren begründende Erläuterung • Darstellung der Maßstäbe für Werturteile • Begründung der Urteile (empirische Triftigkeit) Reflexion: • Fähigkeit zur Re-Organisierung der Geschichtsbilder • Hypothesenbildung |
Tabelle 5: Analytischer Kriterienraster zur Analyse mündlicher Reifeprüfung (Eigendarstellung).
Der Kriterienraster stellt das Analyse-Instrument dar, um Daten deduktiv zu erheben und nachfolgend zu beschreiben und zu analysieren.