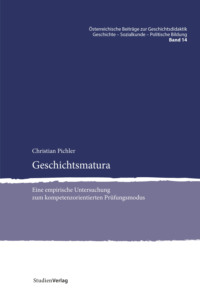Kitabı oku: «Geschichtsmatura», sayfa 14
7.2.1.4 Schritt 3: Induktive Analyse der Performanzen
Vermutet wird, dass durch das mündliche Prüfungsformat Phänomene sichtbar werden, die Hinweise auf jene Kompetenzen ermöglichen, die die drei AFB nicht abdecken (z. B. historische Fragekompetenz) sowie auf Alltagsbezüge. Zudem wird angenommen, dass das dialogisch ausgerichtete Verfahren Spezifika der mündlichen Kommunikation sichtbar macht, die Narration bedingen, deren Charakteristika von der essayistischen Form schriftlicher Prüfungen signifikant abweichen. Sie werden erhoben, beschrieben und dahingehend überprüft, ob sie die Manifestation von Kompetenzen unterstützen, ergänzen oder behindern.
7.2.2 Entwicklung des Leitfadens zur Graduierung historischer Kompetenzen
Es herrscht in Pädagogik und Didaktik weitgehend Konsens darüber, dass Lernprogressionen evident werden müssen, um den Grad des Bildungsvorhabens zu erkennen.685 Die Mess-Ergebnisse von Kompetenzentwicklungen liefern Daten, die die Konzeption von Progressionsmodellen zum Aufbau und zur Förderung von Kompetenzen unterstützen und damit historisches Lernen fördern. Am Beginn der Theoriearbeit zur Graduierung der Kompetenzen stand die Gruppe FUER vor der Herausforderung, Parameter zu finden, die eine Stufung mentaler Prozesse auf verschiedenen Dimensionen erlauben. Gängige probabilistische Messverfahren686 wurden ebenso für wenig geeignet befunden wie diverse Graduierungsmodelle der Fachdidaktik, die auf spezielle Phänomene abzielen. Während die einen die Untersuchung von Lösungshäufigkeiten standardisierter Aufgaben oder deren Aufgaben-Eigenschaften in den Fokus nahmen und nehmen, sind die anderen entweder zu vage oder zu spezifisch, um die Basis für Verfahren zu bilden, die das ganze Kompetenzmodell betreffen. Von einer „[…] allgemeine(n) Vorstellung, worin sich elaborierte Formen dieses Denken-Könnens unterscheiden,“687 erwartete FUER die Richtschnur, nach der eine „[…] Logik der Unterscheidung von Niveaus […]“688 zu erarbeiten war. Fündig wurde man bei Dagmar Klose,689 deren entwicklungspsychologisch-konstruktivistische Geschichtsdidaktik einer von Lawrence Kohlberg abgeleiteten Stufungsidee folgt. Kohlberg hatte Studien zur Genese moralischer Urteile bei jungen Menschen durchgeführt und ein Drei-Phasen-System (präkonventionelles, konventionelles, postkonventionelles Denken) kreiert.690 Dieses Konzept adaptierte Klose auf historische Lernprozesse. Den Wissenschaftler*innen von FUER schien die Vorstellung lebenslanger Kompetenzprogression entwicklungspsychologisch plausibel.691 Daher entschied man, die Struktur des Systems in das eigene Modell zu transferieren. Angelpunkt der nötigen Modifikation war die Auffassung der Art der Erzeugung von Sinn. Während Klose von genetisch bedingter Sinnbildung und naturgegebener Stufung historischen Denkens ausgeht, sieht FUER in Anleitungen von Lernprozessen das wesentliche Movens für Denkprogression. Entwicklungen der historischen Bewusstseinsbildung werden nicht ausschließlich als psychologisch-anthropologisch determiniert gesehen, sondern primär als kulturell formbar. Es galt demnach, das von Klose deduzierte System um eine konstruktivistische Komponente zu erweitern und auszudifferenzieren. Das Produkt ist ein fünfstufiges Graduierungsmodell (Tabelle 6).692 Aus der Beschreibung der Niveaustufen werden in der Folge Kriterien abgeleitet, die zur Analyse der Niveaus der Fähigkeiten und Fertigkeiten herangezogen werden. Dargestellt werden sie in einem analytischen Leitfaden, dem Auswertungsinstrument.
| Formale und didaktische Bezeichnung | Inhaltsskizze |
| „Maximalniveau“ (M) | Abgrenzungskriterium |
| Elaboriertes Niveau (E) (trans-konventionell) | Reflektierter, (selbst-) reflexiver Umgang mit Geschichte: Konventionen werden thematisiert, beurteilt, überschritten |
| Intermediäres Niveau (I) (konventionell) | Üblicher Umgang mit Geschichte samt Kenntnissen von Kategorien, Konzepten, Methoden, Vorstellungen etc…: Kenntnis von Konventionen; Anwendung von konventionellen Kategorien, Konzepten, Methoden, Vorstellungen; idealtypische Verwendung der Konventionen |
| Basales Niveau (B) (a-konventionell) | Keine Kenntnis von Konventionen; Kompetenzen in Ansätzen erkennbar: spontanes, nicht systematisches, auf Konventionen zurückgreifendes Denken |
| „Nullniveau“ (N) | Abgrenzungskriterium |
Tabelle 6: Niveaubeschreibungen (Quelle: Körber: Niveaustufen, S. 416, 457, 465 f).
Damit Kompetenzentwicklungen beschrieben werden können, ist es zweckmäßig, an markanten Schwellen der Bildungsbiografie Halt zu machen, um den bis dahin erreichten Kompetenzgrad zu evaluieren. Die Reifeprüfung bietet sich zur Markung an, da mit ihr die Schulbildung endet. Die Theorie hat eine Vorstellung davon, wohin Geschichtsunterricht führen soll. Das Graduierungsmodell schlägt für diese Schwelle zum tertiären Sektor bzw. zum Berufseinstieg das Erreichen intermediären Niveaus (I) vor. „Intermediär“ bedeutet das Verfügen über gesellschaftlich übliche („konventionelle“) Formen der Nutzung von Konzepten, Kategorien, Operationen und Verfahren historisch-politischen Denkens. Sie sollen es ermöglichen, idealtypische Konzepte zu verstehen, zu gebrauchen und sich bei mentalen Vorgängen auf sie zu beziehen. Das Erreichen dieser Stufe zum Zeitpunkt der Reifeprüfung ist sowohl entwicklungspsychologisch (Alter) als auch konstruktivistisch (Unterricht) begründbar. Die nachzuweisende Kompetenz besteht darin, dass Denkende durch kundige Anwendung der Konventionen selbstständig Aussagen und Deutungen nachvollziehen können und ein persönliches Orientierungsbedürfnis autonom und souverän zu befriedigen vermögen.693 Komplikationsfaktor bei der Entwicklung eines Messverfahrens ist die Gestaltung der Messgrößen. Aus der Sicht von FUER stellen die AFB keine zufriedenstellende Graduierung sicher. Zwar fragen sie nach Kompetenzen,694 sind aber nicht auf deren Progression (vertikale Ebene) ausgerichtet, sondern stufen Schüler*innen-Leistungen durch Gewichtung der Bereiche (horizontale Ebene). Reproduktionsleistungen werden als niederschwelliger angesehen als Transfer. Reflexion stellt die höchste Stufe dar.695 Obwohl die KMK die AFB integrativ verstanden wissen will,696 zeigt die Studie von Schönemann et all., dass das Prüfungsverfahren nicht Entwicklungsstände von Fähigkeiten und Fertigkeiten testet, weil Aufgabenstellung und Bewertungsschlüssel außer Acht lassen, dass jeder AFB von mehrere Kompetenzbereiche erfassen sollte.697 Gemessen am FUER-Modell bleibt etwa Fragekompetenz ausgeblendet und Orientierungskompetenz wird in einer Reduktionsform berücksichtigt. Unter diesen Bedingungen galt es nach einem Weg zu suchen, der das an FUER-Kompetenzen misst, was Prüfungsdesign und Aufgabenstellungen sichtbar zu machen vermögen. Da FUER von einem lebenslangen Kompetenzaufbau ausgeht, unabhängig von potenziellem Schulunterricht, ist es durch die Theorie begründbar, in jedem Lebensabschnitt und aus unterschiedlichen Anlässen (z. B. Aufgaben) heraus menschliche Äußerungen zu historischen oder politischen Fragen nach Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang damit zu untersuchen. Wegen des amtlich vorgegebenen österreichischen Prüfungsformats ist zwar ein fragmentiertes, aber für einzelne (Teil-)Kompetenzen dennoch einigermaßen aussagekräftiges Bild davon erwartbar, welche Niveaus Kandidat*innen erreichen. Eine vollständige Kompetenzüberprüfung nach FUER oder gar direkte Rückschlüsse auf den vorgelagerten Unterricht sind unter diesen Bedingungen unmöglich. Angenommen wird, dass es gelingen sollte herauszufinden, ob das Prüfungsverfahren eine Validierung des Erreichens von Kompetenzniveaus ermöglicht. Ist das der Fall, können in der Folge treffsichere und praktikable Mess- und Beurteilungsinstrumente entwickelt werden, die Prüfenden helfen würden, während der Examina präzisere Beurteilungen auf der Basis der Kompetenz-Vorstellungen zu finden. Solche Bewertungsverfahren sollten den Anspruch auf Zuverlässigkeit erfüllen und die derzeit gängige Praxis persönlicher Leistungseinschätzung durch professionelle Kompetenzanalyse ersetzen. Das ist von Bedeutung, weil die Reifeprüfung derzeit keine kompetenzbezogene Leistungsgraduierung vorsieht, sodass willkürliche Leistungsbeurteilung gefördert wird. Sollte die Untersuchung eine Inkompatibilität des Prüfungsverfahrens mit dem Erfordernis einer Messung von FUER-Kompetenzen ergeben, ist die Sinnhaftigkeit eines Systems in Frage zu stellen, das seinen Bildungsplänen eine Wissenschaftstheorie zu Grunde legt, deren Prämissen in der abschließenden Prüfung nicht adäquat erhoben werden kann. Für diesem Fall ist eine Diskussion anzuregen, ob die Geschichtsdidaktik nicht auf eine genuin domänenspezifische Prüfungsmodalität in der Matura drängen sollte, und es wären entsprechende Prüfungsverfahren zu überlegen und zu diskutieren.
Der Autor dieser Studie hat sich dazu entschlossen, die Niveaus der Teilkompetenzen entlang der AFB zu untersuchen, weil diese Vorgangsweise Konformität zum Prüfungssystem aufweist. Sie hat zum Ziel, Erkenntnisse über den Grad des Verfügens von Kompetenzen des FUER-Modells zu gewinnen. Um das zu gewährleisten, wurde als Auswertungsinstrument zur Einschätzung der Niveaus der Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Leitfaden entwickelt (vertikale Ebene). Die Beschreibungen der Niveaustufen folgen der Graduierungstheorie von FUER. Sie werden gestrafft und auf jene zentralen Kriterien fokussiert, deren Beachtung in einem relativ kurzen mündlichen Prüfungsformat erwartbar ist. Die detaillierte und elaborierte Vorlage aus der Theorie erscheint dafür ungeeignet, weil Erzählungen nach der Funktionsweise der Kommunikationsform Mündlichkeit nicht derart ausgereift und in aller Komplexität durchdacht sein können, wie das durch die Konstruktion von Sachtexten, die einem Schreibprozess unterzogen werden, ermöglicht wird. Prüfungsgespräche evozieren spezielle Formen historischer Narrationen, deren Determinanten der dialogische Charakter, die relative Kürze der Aussagen, der Hang zur Spontaneität und Probleme sprachlichen Ausdrucks sind.698 Tendenziell sequenzierte Narrationen sind die Folge. Um einen praktikablen Leitfaden dafür zu entwerfen, ist eine Vereinfachung nötig gewesen. So wird z. B. aus Gründen der Ökonomität auf die Beschreibung von Zwischenniveaus verzichtet. Die Intervalle werden zwar nicht mit eigenen Kriterien versehen, aber in der Skalierung sichtbar gemacht, um deutlich zu machen, dass die Messungen keine Plateau-Sprünge, sondern sukzessive voranschreitende Entwicklungen zeigen. Die Stufung erfolgt als begründete Einschätzung. Um Validität sicherzustellen, kommt ein Double-Rating-Verfahren zur Anwendung. Der Cohen-Kappa-Wert wird erhoben. Während bei Schönemann et all., abhängig vom Kriterium, zwischen zwei und fünf Niveaustufen differenziert wird,699 orientiert sich der Leitfaden für die Reifeprüfung bei allen Kriterien an den fünf Niveaus des Graduierungsmodells. Die Niveaus werden mit Zahlenwerten versehen (0–4) und die Intervalle rund um den Wert der jeweiligen Niveaustufe definiert.700 Für das Zielintervall „I“ wird beispielsweise die Bandbreite 1,75 bis 2,24 angesetzt. Die Festlegung folgt mathematischen Überlegungen, die der Graduierungslogik von FUER inhärent sind. Die Niveau-Intervalle werden nebst den Zahlenwerten für die Beschreibung mit Siglen versehen. Somit entsteht eine durchgängige Zehner-Skala (Tabelle 7).
| Wert | Niveau | Intervall | Sigle |
| Null (0) | Nullniveau | Abgrenzung | N |
| Null+ (0+) | über null | Ausgangsbereich | N+ |
| 0+ – 0,74 | null – basal | Zwischenniveaubereich | N – B |
| 0, 75–1,24 | basales Niveau | Präkonventionelles historisches Denken | B |
| 1,25–1,74 | basal – intermediär | Zwischenniveaubereich | B – I |
| 1,75–2,24 | intermediäres Niveau | Konventionelles historisches Denken | I |
| 2,25–2,74 | intermediär – elaboriert | Zwischenniveaubereich | I – E |
| 2,75–3,24 | elaboriertes Niveau | Postkonventionelles historisches Denken | E |
| 3,25–3,74 | elaboriert – maximal | Zwischenniveaubereich | E – M |
| 3,75 ff | Maximalniveau | Abgrenzung | M |
Tabelle 7: Zahlenwerte und Siglen der Niveaustufen (Eigendarstellung).
Die vorab identifizierten Fähigkeiten und Fertigkeiten werden für das Rating zur Einpassung in die Systematik der Graduierung herangezogen. Graduiert werden die Kriterium nach den (Teil-)Kompetenzen des Strukturmodells, aber entlang den AFB. Der Vorgang ergibt Beschreibungen, die begründet in Zahlenwerte übergeführt werden. Aus den Einzelwerten lassen sich Durchschnittswerte pro Kompetenz bestimmen, die das Niveau-Intervall eines Kompetenzbereichs anzeigen. Das Zielintervall wurde vom Studienautor rund um den Wert 2 (Intermediäres Niveau) angesetzt und reicht von 1,75 bis 2,24. Es wurde festgelegt, dass bereits das Überschreiten des basalen Niveauintervalls (i. e. eine Einschätzung ab 1,25) als annäherndes Erreichen des Zielintervalls zu bewerten ist. Daher wurde die untere Grenze der Kompetenzerwartung mit 1,25 definiert (siehe Einfärbung in Tabelle 19).701 Das Überschreiten intermediären Niveaubereichs (2,25 ff) ist als fortgeschrittene Stufe der Kompetenz-Entwicklung zu sehen und gilt als Indikator dafür, dass sich ein*eine Kandidat*in auf dem Weg zum Elaborieren der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Geschichte befindet. Sollten mehrere (Teil-)Kompetenzen 2,25 ff ergeben, kann das als Hinweis auf spezielle Befähigungen bzw. auf fachliche Begabung interpretiert werden. Die Entscheidung, ein Kriterienraster auf der Basis des Prüfungsdesgin mit Blick auf die Kompetenzbeschreibungen von FUER zu entwickeln, wurde getroffen, weil der interessante Zugang, die Performanzen entlang zweier Raster (AFB und FUER) zu untersuchen und die Ergebnisse vergleichend miteinander Beziehung zu setzen, die Möglichkeiten einer Monografie übersteigt. Da zu erwarten ist, dass sich die Schüler*innen-Leistungen zwischen dem Nullniveau und dem elaborierten Niveau bewegen, werden in der Folge die Intervalle drei Stufen 0–2 beschrieben.
Kriterien der Graduierung des AFB I:
Das Prüfungsdesign sieht den AFB I als Überprüfung der Sachkompetenz an. Es ist die Entscheidung getroffen worden, ihm die Kriterien konzeptionelles Wissen, Kenntnis der Materialgrundlage und Fähigkeit zur Wiedergabe der Inhalte bzw. Aussagen der Quellen, Darstellungen oder Produkte der Geschichtskultur zu Grunde zu legen und diese gemäß der Graduierungstheorie von FUER zu stufen. (Tabelle 8).
| Kompetenz | Kriterium | Stufung |
| Sachkompetenz | Konzeptionelles Fachwissen (Verfügungs- oder Kontextwissen) | 0: Nicht vorhanden 1: Fehlerhaft vorhanden 2: Ausreichend vorhanden 3: Umfassend vorhanden |
| Sachkompetenz | Kenntnis der Materialgrundlage | 0: Keine Kenntnis 1: Unpräzise Kenntnis 2: Korrekte Kenntnis 3: Detaillierte Kenntnis |
| Sachkompetenz | Wiedergabe der Inhalte/Aussagen der Materialien | 0: Kein Erkennen der Information 1: Implizites Erfassen der Information und deren amorphe Wiedergabe 2: Erfassen der Hauptaussagen und deren adäquate Wiedergabe 3: Erfassen relevanter Details und deren passende Wiedergabe |
Tabelle 8: Graduierungsraster AFB I (Eigendarstellung).
Die Theorie beschreibt das Kriterium „konzeptionelles Wissen“ als ein grundlegendes Element der Fähigkeit zur Re-Konstruktion von Geschichte und als einen zentralen Aspekt der Sachkompetenz. Voraussetzung dafür sind fachwissenschaftliche Kenntnisse zum Forschungsstand (deklaratives Fachwissen) und Anhaltspunkte die Fähigkeit, Wissensbestände selbstständig zu erwerben und sie in Sinnbildungen zielgerichtet und triftig anzuwenden (Narrationen) sowie das Produkt kritisch zu reflektieren. Dazu tritt das Verfügen über Strukturelemente Strukturierungs- und Begriffskonzepte, Kategorien.702 Graduierungskriterien:
Nullniveau (0): Es gibt kein Bewusstsein darüber, dass Informationen zeit- und raumgebunden sind und es fehlt die Fähigkeit zur kategorialen Unterscheidung von Quellen und Darstellungen. Allfällige Narrationen sind bruchstückhaft und ohne zielgerichtete Aussage.
Basales Niveau (1): Die Ergebnisse der Analyse der Materialien werden als Aussagen über Vergangenes erkannt, aber nicht kategorial eingeordnet und bewertet (Es fehlt z. B. das Erkennen der Ursprünglichkeit von Aussagen aus Quellen versus deren Interpretation in Darstellungen). Informationen aus Quellen, Darstellungen und von Äußerungen von Personen haben denselben Stellenwert. Es zeichnet sich aber allmählich die Fähigkeit ab (unter Anleitung und in kleinen Schritten) einzelne Inhalte der Materialien in eine vorhandene Narration einzufügen.
Intermediäres Niveau (2): Es gibt ein Bewusstsein von der Notwendigkeit, Erkenntnisse aus der Quellenanalyse mit Informationen über den Forschungsstand (deklaratives Fachwissen) zu einer Narration zu verknüpfen und darüber, dass es Varianten der Erzählung geben kann. Es ist die Fähigkeit und die Bereitschaft vorhanden, kategoriale Konzepte selbstständig zu nutzen und die Ergebnisse einer Sachurteilsbildung zuzuführen. Und es gibt die Fähigkeit und Bereitschaft, die Auswahl der zu kontextualisierenden Erkenntnisse aus den Materialien auf ihre Triftigkeit hin zu prüfen.703
Elaboriertes Niveau (3): Es ist das Bewusstsein vorhanden, dass Narrationen triftig sein müssen und dass es, abhängig von der Fragestellung, Varianten triftiger Narrationen geben kann. Die Kontextualisierung der Erkenntnisse aus der Analyse von Materialien erfolgt mit Bezug auf eine Fragestellung und aus theoretischen sowie kategorialer Erwägungen, vor allem des Selbst- und Weltverständnisses.704
Um Inhalte aus Materialien kontextualisieren zu können, bedarf es der Kenntnis fachlicher Begriffskonzepte (Begriffsinhalt und Begriffsumfang), epistemologischer Prinzipien (Retro-Perspektivität, Partikularität, Konstruktivität), subjektbezogener Konzepte (Identität, Alterität), inhaltsbezogener Kategorien (z. B. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur u. dgl. und deren historische Wendung), methodischer Verfahrens-Scripts (Heuristik, Quellenkritik, Analyseverfahren) sowie der Fähigkeit, anhand dieser Kenntnisse Strukturen von Phänomenen, Ereignissen und Entwicklungen zu erkennen bzw. eigenständig Narrationen zu systematisieren. Diese Strukturelemente sind bei FUER ein Teil der Sachkompetenz.705 Graduierungskriterien:
Nullniveau (0): Es fehlt jede Form der Ausprägung der Fähigkeit. Es gibt kein Verfügen über historisch-politische Termini und deren Begriffslogik, stattdessen den Gebrauch lebensweltlicher Ausdrücke zur Bezeichnung historischer Phänomene. Es fehlt die Bereitschaft, historische Begriffe zu erlernen und anzuwenden.706 Es gibt kein Verfügen über historisch-politisches Strukturierungswissen und dessen Logiken, sodass alltagsweltliche Strukturen nicht historisch gewendet werden können. Und es gibt keine Bereitschaft, sich dieses anzueignen.707 Es gibt kein Verfügen über die historische Kategorie „Zeit“708 und über zeitliche Konzepte (z. B. Epochen).709 Es gibt kein Verfügen über Fachwissen (z. B. von Kategorien) als Basis zur Kontextualisierung von Informationen aus Materialien.710
Basales Niveau (1): Regeln fachspezifischer Konventionen sind nicht bewusst. An ihre Stelle tritt isoliertes, sporadisches, situatives, unsystematisches, ich-bezogenes und ansatzweises Verwenden historischer Begriffe und von Strukturierungselementen. Es gibt eine vage Kenntnis einzelner fachspezifischer Termini samt sporadischem Wissen um Begriffskonzepte und situatives Verfügen über deren Merkmale. Die Fähigkeit zur historischen Wendung der Begriffe ist gering ausdifferenziert. Stattdessen dominieren lebens- und alltagsweltliche Ausdrücke. Bekannte Fachbegriffe werden als gegeben und objektiv angesehen. Strukturierungselemente werden unsystematisch und fallbezogen verwendet. Sie erscheinen wenig entwickelt. Es gibt zwar die Kenntnis einfacher domänenspezifischer Strukturen, aber kaum Wissen um deren Kategorialität. Stattdessen herrscht die Annahme vor, dass bekannte Strukturen „objektiv“ und kohärent sind. Daraus resultiert eine limitierte Fähigkeit zur Vernetzung.711 Es besteht ein ansatzweises Verständnis für zeitliche Anordnungen und ein fragmentarisches Wahrnehmen von Veränderung, punktuell verbunden mit Wertvorstellungen. Deutungen sind affirmativ, spontan und gehen von der Qualität der Gegenwart aus.712 Der Gebrauch von Fachwissen zur Kontextualisierung ist fehlerhaft. Lebens- und alltagsweltliche Kenntnisse von Kategorien (z. B. über Herrschaft, Gesellschaft, Kultur, Gender etc.) sind vorhanden.713
Intermediäres Niveau (2): Fachspezifische Konventionen können adäquat, routiniert und selbstständig genutzt werden. Es gibt ein Verfügen über ein konventionelles Begriffskonzept, das die wesentlichen Merkmale erschließt, die semantischen Felder (Ansätze von Triftigkeitsprüfungen) und die Pragmatik der Begriffsverwendung (adressaten-, medien- und kontextspezifische Anwendung) beherrscht und ansatzweise die Perspektivität von Begriffen kennt. Noch dominieren klare Definitionen und ein schematischer Umgang mit Begriffen. Es gibt ein Verfügen über konventionell als relevant angesehene Strukturierungen, die routiniert, aber schematisch angewendet werden. Die Kenntnis von unterschiedlichen Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen ist vorhanden, es wird jedoch angenommen, dass innerhalb einer Kategorie die Struktur dauerhaft und passend ist. Andere Strukturen werden wahrgenommen. Es zeigt sich ein entstehendes Bewusstsein über die Diversität historisch-politischer Strukturen und die Erkenntnis von deren kategorialem Nutzen.714 Es gibt ein Verfügen über konventionelle Merkmale von Epochenbegriffen, die Kenntnis von deren Geschichte und Relationen. Alternativen werden gesehen, aber nicht angenommen, und es dominiert eine eurozentristische Sicht des Zeitverlaufs mit einer eschatologischen Komponente zum Besseren (Fortschritt als Gesetzmäßigkeit) hin. Noch fehlt eine temporale und lokale Ausdifferenzierung der Verläufe. Ansätze zu einer bewussten Reflexion der Prinzipien in Richtung Differenzierung zeichnen sich ab. Die Fähigkeit zur Periodisierung ist da, mit der Tendenz, Konventionen absolut zu setzen.715 Es gibt ein Verfügen über konventionelle Vorstellungen von Kategorien (z. B. Herrschaftsformen: Funktionen, Risiken, Chancen, Ambivalenzen) und die Fähigkeit, sie angemessen zu nutzen. Erste Schritte einer kritischen Auseinandersetzung damit sind feststellbar.716
Elaboriertes Niveau (3): Konventionen werden als Hilfsmittel (Konstrukte) erkannt, die zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern sind (Metaperspektive). Es gibt das Bewusstsein, dass konventionelle Begriffssysteme idealtypische Konstrukte (Werkzeuge) sind, die anlassbezogen verändert und interpretiert werden können. Die Bereitschaft, deren Triftigkeit zu überprüfen und sie adressaten- und kontextspezifisch anzuwenden, ist vorhanden. Es gibt die Kenntnis der Multidimensionalität von Strukturierungssystemen und deren prinzipieller Gleichberechtigung, die Fähigkeit, vorhandene Strukturen auf ihre Triftigkeit hin zu überprüfen und kritisch zu reflektieren und zu begründbaren alternativen Strukturierungen zu finden (Innovationsaspekt).717 Zeitverläufe werden als standortgebundene Konstrukte erkannt und deren Deutung hinterfragt (Triftigkeitsüberprüfung). Es gibt das Bewusstsein, dass Periodisierungen Hilfsmittel sind. Deren Gebrauch erfolgt souverän und ist einer überlegten Entscheidung geschuldet.718 Es gibt das Verfügen über Konzepte von Kategorien und die Fähigkeit, sie weiterzuentwickeln (Innovationsbereitschaft). Der Wille zur Reflexion der Verwendung eigener kategorialer Schemata ist da.719
Ein weiteres Kriterium der Sachkompetenz ist die „Kenntnis der Materialgrundlage“. Das Verfügen über die Fähigkeit zwischen Quellen und Darstellungen unterscheiden zu können, ist eine unabdingbare Voraussetzung einer gelingenden De-Konstruktion. FUER hat einen Graduierungsvorschlag zum Umgang mit Quellen erarbeitet, der das Verfügen über die Charakteristika, die Operationen zu ihrer Nutzung, die Fähigkeit der Relativierung und Differenzierung der Aussagen und der Prüfung der Relevanz für das Orientierungsinteresse als Parameter der Niveaustufung vorsieht. Diese Aspekte gelten auch für Darstellungen. Graduierungskriterien:
Nullniveau (0): Es gibt kein Verfügen über die gattungsspezifischen Merkmale der Quelle (Darstellung) und damit keine Erwartung, dass durch deren Nutzung Erkenntnisse über die Vergangenheit möglich sind.
Basales Niveau (1): Ein unpräzises Verfügen über die gattungsspezifischen Merkmale der Quelle (Darstellung) ist vorhanden, es gibt aber keine Unterscheidung von Quelle und Darstellung. Außerdem können Widersprüche zwischen Quellen bzw. bei Aussagen über Quellen nicht aufgelöst werden. Medien werden als Träger von Informationen erkannt, ihre Rolle aber nicht kritisch wahrgenommen.
Intermediäres Niveau (2): Ein korrektes Verfügen über die gattungsspezifischen Merkmale der Quelle (Darstellung) und die Fähigkeit, sie zu differenzieren, ist gegeben. Auf Grund der Vielzahl möglicher Charakteristika von Quellen und Darstellungen ist die Art des Umgangs mit ihnen ein Indikator für das erreichte Niveau. Quellen als authentisch zu erfahren und das zu begründen, wäre das Ziel dieser Niveaustufe.
Elaboriertes Niveau (3): Ein detailreiches Verfügen über die gattungsspezifischen Merkmale der Quelle (Darstellung) ist vorhanden, weiters die Fähigkeit, die Konzepte kritisch zu reflektieren, sodass eine Bestimmung des Quellenwerts möglich ist.720
Das Kriterium „Text-, Bild-, Grafik- und Filmwiedergabe“ meint die analytische Fähigkeit des Erkennens relevanter Informationen und deren Darstellung in Form einer sachlogischen und sinnstiftenden narrativen Schilderung. Die Graduierung beruht auf folgenden Kriterien:
Nullniveau (0): Es gibt kein Erkennen der Information im Material und keine Fähigkeit, eine Narration mit erkennbarer Aussage zu konstruieren (Sinnbildung). Allfällige Informationen werden lose und zufällig aneinandergereiht (keine Ausrichtung an einer leitenden Frage, keine bewusste Adressatenorientierung).
Basales Niveau (1): Es gibt ein implizites Erfassen der Information und eine amorphe Wiedergabe. Der Aufbau des Arbeitsmaterials wird nicht erkannt. Daher werden Aussagen daraus punktuell und willkürlich als relevant für die eigene Narration eingestuft und herangezogen. Im positiven Fall ist (sind) es die Hauptaussage(n). Nicht erfasst wird zudem deren Kontextualität. Die Narration ist weder auf eine Fragestellung hin orientiert noch gibt es eine Ausrichtung an Kategorien und eine bewusste Hinwendung zum Adressaten.
Intermediäres Niveau (2): Die Hauptaussagen aus dem Material werden erfasst und adäquat wiedergegeben. Die Gliederung des Materials findet Berücksichtigung und wird nachvollzogen. Es wird die Fähigkeit nachgewiesen, mit Hilfe des Materials eine Geschichte zu erzählen, die Fragen beantwortet und sich an Adressaten wendet. Es gibt ein Bewusstsein der Notwendigkeit der Verwendung von Fachbegriffen, der Nutzung von Strukturen und Kategorien und die Fähigkeit, verfahrensgeleitet Erkenntnisse der Materialanalyse mit Inhalten der Forschung zu verbinden (Kontextualisierung). Die Triftigkeit der Narration wird geprüft und ihre Sinnbildung begründet. Voraussetzung dafür ist ausreichendes Sprachvermögen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.