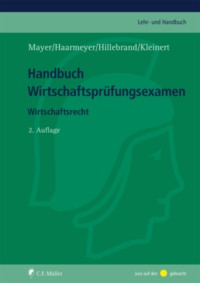Kitabı oku: «Handbuch Wirtschaftsprüfungsexamen», sayfa 63
d) Gemeinsamkeiten in den Anwendungsbereichen der §§ 987 ff.
aa) Sachlicher Anwendungsbereich
1051
Gemeinsame Voraussetzung der §§ 987 ff. ist das Bestehen der Vindikationslage, die durch den Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen einen Besitzer ohne Recht zum Besitz nach §§ 985, 986 bestimmt ist. Das steht zwar nicht im Gesetz, ergibt sich aber daraus, dass bei bestehendem Recht zum Besitz jede Unterscheidung nach der subjektiven Qualität des Besitzerwerbs (gut-, bösgläubig, deliktisch) sinnlos wäre.
1052
Kraft Verweisung in den §§ 1065, 1227 gelten die §§ 987 ff. bei Beeinträchtigungen des Rechts eines Nießbrauchberechtigten oder eines Pfandgläubigers; nach § 1007 Abs. 3 S. 2 außerdem im Verhältnis eines früheren Besitzers zu einem Nachfolger im Besitz, wenn dieser den Mangel eines Rechts zum Besitz jenem gegenüber kannte oder die Sache jenem abhanden gekommen war. Außerdem verweisen die §§ 818 Abs. 4, 819 Abs. 1 durch die Bezugnahme auf die „allgemeinen Vorschriften“ und damit § 292 ebenfalls auf §§ 987 ff. Dadurch wird auch der bösgläubige oder verklagte Bereicherungsschuldner wie ein unrechtmäßiger Besitzer behandelt, obwohl er entsprechend dem Abstraktionsprinzip trotz nichtigen Kausalgeschäfts ggf. dennoch etwa durch Leistung Eigentümer geworden ist. Die Vindikation besteht insoweit gerade nicht, die Rückabwicklung erfolgt nach Bereicherungsrecht, die §§ 987 ff. finden jedoch entsprechende Anwendung.
bb) Zeitlicher Anwendungsbereich
1053
Der sachliche Anwendungsbereich muss im Zeitpunkt des die jeweilige Klagebefugnis aus §§ 987 ff. auslösenden Ereignisses, also der Ziehung von Nutzungen, der Schädigung oder Vornahme von Verwendungen, vorliegen. Der berechtigte Besitzer (vgl. § 986) haftet im Rahmen seines Schuldverhältnisses, ggf. auch deliktisch, jedoch nicht nach §§ 987 ff.: Der rechtmäßige Mieter hat den gewöhnlichen Mietgebrauch mit der Miete entgolten und haftet für Verschlechterungen der Mietsache nach §§ 280 ff., 538, 548, was sich auch auf die Haftung nach § 823 Abs. 1 auswirkt. Aufwendungsersatz kann der Mieter im laufenden Mietverhältnis nach § 539 erlangen, nicht aber nach §§ 994 ff.
Beispiel:
Nach BGHZ 34, 122 soll u.U. ein Fremdbesitzer Verwendungen auf die Sache aus der Zeit des Bestehens seines Rechts zum Besitz nach dessen Beendigung dennoch auch gem. §§ 994–1003 vom Eigentümer ersetzt verlangen können. So z.B. der ein Fahrzeug reparierende Werkunternehmer, der von einem Eigentumsvorbehaltskäufer dieses Pkw beauftragt worden war und damit ein von diesem abgeleitetes Recht zum Besitz für die Reparaturdauer erwarb, aber mit Rücktritt des Veräußerers nach § 449 Abs. 2, etwa in Folge Zahlungsverzugs des Eigentumsvorbehaltskäufers, zum unrechtmäßigen Besitzer wird. Wie der Auftraggeber das Recht zum Besitz durch den Rücktritt verliert, so auch der Werkunternehmer sein von ihm abgeleitetes Recht zum Besitz. Mangels eines Werkunternehmerpfandrechts (vgl. § 647; zur Problematik des gutgläubigen Erwerbs eines solchen s. Rn. 310) kann der Eigentümer sodann das Fahrzeug vindizieren.
Dieser Vindikation soll der Werkunternehmer die Reparaturkosten entgegensetzen können, unabhängig davon, dass im Zeitpunkt ihrer Entstehung keine Vindikationslage gegeben war und deshalb strenggenommen nur Werklohnansprüche gegen den Auftraggeber bestanden hätten. Insoweit ist dem BGH zwar zuzugeben, dass der Eigentümer den wirtschaftlichen Nutzen zieht, als er anderenfalls z.B. ein verunfalltes, unrepariertes Fahrzeug zurückbekommen hätte. Aber außer, dass eine wirtschaftliche Betrachtungsweise methodologisch nicht zur Auslegung rechtlicher Fragestellungen zulässig ist, stand der Eigentümer dem Wert der Verwendungen[81] entgegen der Ansicht des BGH auch gar nicht näher, sondern war gegenüber dem gemeinsamen Schuldner lediglich besser gesichert als der Werkunternehmer. Im Ergebnis ist deshalb die Ausweitung des zeitlichen Anwendungsbereichs auf eine erst im Zeitpunkt des Herausgabeverlangens bestehende Vindikation abzulehnen.[82]
1054
Mit Beendigung eines schuldrechtlichen oder dinglichen Rechts zum Besitz entsteht eine Vindikationslage. § 985 konkurriert insoweit mit etwaigen vertraglichen Rückabwicklungsregeln (z.B. § 546). Auf danach eintretende Ereignisse sind die §§ 987 ff. anwendbar, soweit nicht den speziellen Fall regelnde und damit vorrangige Vorschriften bestehen; so z.B. § 546a oder § 280 für Fälle, dass der Mieter die Mietsache verspätet zurückgibt oder sie nach Ablauf der Mietzeit beschädigt. Hiergegen kann er nicht den Ausschluss einer Schadensersatzpflicht durch § 993 Abs. 1 HS. 2 einwenden, etwa mit der Begründung, er habe den Ablauf der Mietzeit allenfalls leicht fahrlässig übersehen und sei deshalb jetzt unrechtmäßiger aber redlicher Besitzer und müsse als solcher nicht haften. Umgekehrt gilt hierfür die kurze Verjährung des § 548.
1055
Fällt ein Recht zum Besitz etwa durch Anfechtung des ihm zugrundeliegenden Vertrags nach § 142 Abs. 1 rückwirkend weg, folgt daraus eine von Anfang an bestehende Vindikationslage, so dass die §§ 987 ff. bereits anfänglich anwendbar sind. Für die Kenntnis des Besitzers vom Mangel seines Rechts zum Besitz gilt § 142 Abs. 2, wonach es auf die Kenntnis von der Anfechtbarkeit ankommt.
cc) Persönlicher Anwendungsbereich
1056
§§ 987 ff. unterscheiden verschiedene Arten des Besitzers. Sie privilegieren den unrechtmäßigen Besitzer, der hinsichtlich seines Rechts zum Besitz redlich ist (vgl. § 993 Abs. 1 HS. 2). Dem redlichen stellen sie den unredlichen Besitzer (vgl. so §§ 990 Abs. 1 i.V.m. 987 bzw. 989 bzw. 994 Abs. 2) oder auf Herausgabe verklagten (so vgl. §§ 987, 989, 994 Abs. 2) und den im Verzug mit der Sachherausgabe befindlichen Besitzer (vgl. § 990 Abs. 2) gegenüber.
Besonderes gilt für denjenigen, der den Besitz unentgeltlich erlangt hat. Eine darüber hinausgehende Haftung trifft schließlich den deliktischen Besitzer (vgl. §§ 992, 1000 S. 2).[83]
(1) Deliktischer Besitzer
1057
Deliktischer Besitzer ist, wer sich den Besitz durch verbotene Eigenmacht oder durch eine Straftat verschafft hat (vgl. § 992). Im Fall der Besitzverschaffung durch unerlaubte Handlung (Straftat) haftet er nach § 848 stets für jede nachfolgend zufällig (verschuldensunabhängig) eintretende Verschlechterung oder Unmöglichkeit der Herausgabe der Sache (insoweit also strenger als der nur bösgläubige Besitzer, der nur verschuldensabhängig haftet, vgl. § 989). Noch weitergehender haftet der Deliktsbesitzer unter den Voraussetzungen der §§ 992, 823 ff. (verschuldensabhängig) insb. für den Vorenthaltungsschaden, also Schäden, die dem Eigentümer als Folge davon entstehen, dass ihm die Sache nicht zur Verfügung steht, dies jedoch nur, sofern die Eigentumsverletzung schuldhaft verursacht wurde. Dazu gehört auch der Ersatz aller nicht gezogenen Nutzungen, welche der Eigentümer (im Gegensatz zum Fall des § 987 Abs. 2 auch unabhängig von den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft) gezogen hätte.
1058
Die Voraussetzungen der §§ 992, 823 liegen im Fall der Besitzverschaffung durch Straftat begriffsnotwendig stets vor[84], sind aber im Falle verbotener Eigenmacht (vgl. § 858 Abs. 1) nicht notwendigerweise bereits durch die Besitzverschaffung gegeben. Bezüglich seiner Gegenansprüche auf Verwendungsersatz steht der deliktische Besitzer dem bösgläubigen gleich (vgl. § 994 Abs. 2).
(2) Redlicher Besitzer
1059
Redlicher Besitzer ist, wer beim Erwerb seines Besitzes in gutem Glauben an ein (vermeintliches) Recht zum Besitz ist (Umkehrschluss aus § 990 Abs. 1 S. 1). Die Formulierung gleicht der in § 932 (vgl. die Legaldefinition in § 932 Abs. 2), bezieht sich dort aber auf das Eigentum des Veräußerers, für den Haftungsausschluss in § 993 Abs. 1 HS. 2 jedoch auf das durch den Besitzer erlangte eigene (schuldrechtliche oder dingliche) Rechte zum Besitz. Unredlich ist danach erst, wer beim Besitzerwerb weiß oder in Folge grober Fahrlässigkeit[85] nicht weiß, dass er nicht zum Besitz berechtigt ist; ebenso wer nachträglich positive Kenntnis hiervon erlangt (vgl. § 990 Abs. 1 S. 2: nachträgliche auch grobe Fahrlässigkeit reicht insoweit nicht).
Beispiel:
Erwirbt ein Besitzmittler (vgl. § 868) die tatsächliche Gewalt über eine Sache, können sich die Nutzungs- und Schadensersatzansprüche der §§ 987 ff. dann sowohl gegen den unmittelbaren wie gegen den mittelbaren Besitzer richten. Die Zurechnung der Kenntnis bzw. grob fahrlässigen Unkenntnis beim Besitzerwerb an den mittelbaren Besitzer erfolgt analog § 166.[86] Gleiches gilt beim Erwerb durch Besitzdiener (vgl. § 855). Von solcher Wissenszurechnung unabhängig, schadet dem Besitzherrn bzw. mittelbaren Besitzer eigene Bösgläubigkeit nach dem Wortlaut des § 990 Abs. 1 stets.
Für den Besitzerwerb durch Minderjährige genügt ein natürlicher, nicht-rechtsgeschäftlicher Besitzwille. Unredlichkeit des Minderjährigen im Anwendungsbereich der §§ 987 ff. setzt jedoch analog § 828 die Einsichtsfähigkeit in die fehlende Besitzberechtigung und deren Bedeutung voraus, so dass es besonders bei Kindern auf die Kenntnis der gesetzlichen Vertreter ankommt. Ausschließlich deren Kenntnisstand soll maßgeblich sein bei der Rückabwicklung von nach §§ 107 ff. unwirksamen Verträgen, weil nur so die Schutzwirkung des Minderjährigenrechts auch im Rahmen einer dabei bestehenden Vindikationslage erreicht werden kann.
1060
Der redliche Besitzer haftet sodann weder auf Schadensersatz wegen Verschlechterung der Sache oder Unmöglichkeit der Herausgabe, noch muss er im Rahmen ordnungsgemäßer Wirtschaft gezogene Nutzungen herausgeben (vgl. § 993 Abs. 1 HS. 2); lediglich Übermaßfrüchte hat er herauszugeben (vgl. § 993 Abs. 1 HS. 1) und auch das nur, soweit er durch sie noch bereichert ist. Weitergehend ist er zur Herausgabe von Nutzungen nur verpflichtet, wenn er das vermeintliche Besitzrecht zudem unentgeltlich erlangt hätte (vgl. § 988).[87]
1061
Eine Ausnahme von der Sperrwirkung des § 993 Abs. 1 a.E. besteht beim sog. Fremdbesitzerexzess. Überschreitet der gutgläubige unrechtmäßige Fremdbesitzer sein vermeintliches Besitzrecht, so greifen die allgemeinen Vorschriften, v.a. § 823 Abs. 1. Wer z.B. als Mieter schädigende Handlungen in Bezug auf die Mietsache nicht vornehmen dürfte, kann auch bei nichtigem Mietvertrag und Vindikationslage insoweit nicht haftungsfrei sein.
1062
Umgekehrt kann der redliche Besitzer stets notwendige, also zum Erhalt der Sache erforderlichen Verwendungen ersetzt verlangen (vgl. § 994 Abs. 1 S. 1; lediglich jedoch nicht die gewöhnlichen Erhaltungskosten für die Zeit, für welche ihm die – der ordnungsgemäßen Wirtschaft entsprechenden – Nutzungen verbleiben. Insoweit findet eine pauschale Verrechnung von Gesetzes wegen statt). Ebenfalls werden dem redlichen Besitzer alle nützlichen, also wertsteigernden Verwendungen ersetzt, § 996.
(3) Bösgläubiger Besitzer
1063
Bösgläubiger Besitzer ist entsprechend, wer bei Besitzerwerb nicht in gutem Glauben hinsichtlich seines Rechts zum Besitz war (vgl. § 990 Abs. 1 S. 1: bereits grobe Fahrlässigkeit schadet in Anlehnung an § 932 Abs. 2) oder wer späterhin hierüber positive Kenntnis erlangte.
1064
Als bösgläubiger Besitzer gilt nach der sog. Aufschwungtheorie des BGH auch derjenige, der ursprünglich als (rechtmäßiger) Fremdbesitzer einer Sache sich plötzlich als Eigenbesitzer geriert. Typischerweise liegt dabei eine veruntreuende Unterschlagung (§ 246 Abs. 2 StGB) vor, indem z.B. ein Entleiher die geliehene Sache unberechtigt an einen gutgläubigen Dritten veräußert. Er haftet ab diesem Zeitpunkt wie ein bei Besitzerwerb bösgläubiger Besitzer. Zwar geht § 990 Abs. 1 beim Besitzerwerb von der erstmaligen Begründung von Besitz aus, wegen des qualitativen Unterschieds zwischen dem zuerst begründeten Fremd- und dem anschließend angemaßten Eigenbesitz steht dieser Vorgang jedoch gleich.
Beispiel:
Veräußert ein Entleiher die geliehene Sache unberechtigt an einen gutgläubigen Dritten, kann dieser nach §§ 929 S. 1, 932 Eigentum erwerben (es liegt kein Abhandenkommen beim Eigentümer nach § 935 vor). Neben Schadensersatz nach §§ 990 Abs. 1, 989 (arg.: Aufschwung zum bösgläubigen Eigenbesitzer) bestehen parallele Ansprüche gegen den Entleiher nach §§ 280 Abs. 1, 3, 283 S. 1, 604 Abs. 1 (Schadensersatz statt der Rückgabe); nach §§ 285 Abs. 1, 604 Abs. 1 (Surrogatanspruch); nach §§ 687 Abs. 2 S. 1, 678 und §§ 687 Abs. 2 S. 1, 681 S. 2, 667 Alt. 2 (Schadensersatz bzw. Herausgabe des Erlangen aus der Eigengeschäftsführung); nach §§ 992 Alt. 2, 823 Abs. 1 sowie 823 Abs. 2 und 826; nach § 816 Abs. 1 (vgl. Rn. 689). Die Begründung der Aufschwungtheorie beruht auf einem bloßen Begriffsargument. Nach § 854 ist Besitz (Eigen- wie Fremdbesitz) die tatsächliche Innehabung der Sache, eine anschließende nochmalige Ergreifung des Besitzes durch den bereits (Fremd)Besitzenden ist damit an sich unvereinbar.
1065
Der bösgläubige Besitzer wird durch § 990 Abs. 1 S. 1 dem auf Herausgabe der Sache verklagten Besitzer (vgl. §§ 987, 989) gleichgestellt. Er hat deshalb wie dieser alle tatsächlich gezogenen Nutzungen unabhängig davon herauszugeben, ob er insoweit noch bereichert ist (der redliche Besitzer nach § 993 hingegen nur die Übermaßfrüchte und auch diese nur, soweit er noch bereichert ist), außerdem nach § 987 Abs. 2 schuldhaft nicht gezogene Nutzungen. Er haftet außerdem wie der Prozessbesitzer nach § 989 für schuldhafte Verschlechterung und schuldhaften Untergang der Sache auf Schadensersatz. Darüber hinaus haftet der bösgläubige Besitzer (nur) im Falle seines Verzugs mit der Herausgabe der Sache nach § 990 Abs. 2 für jeden darauf beruhenden Schaden des Eigentümers, insb. (über § 987 Abs. 2 hinaus) auf schuldlos nicht gezogene Nutzungen, die aber der Eigentümer hätte ziehen können (vgl. §§ 280 Abs. 1, 2, 286). Außerdem trifft dem bösgläubigen Besitzer im Verzug die Zufallshaftung nach § 287 S. 2.[88]
1066
Umgekehrt kann der bösgläubige wie der Prozessbesitzer (nur) seine notwendigen Verwendungen ersetzt verlangen (§ 994 Abs. 2) und auch dies nur nach den Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag. Es handelt sich um eine partielle Rechtsgrundverweisung; der für die Geschäftsführung ohne Auftrag konstitutive Fremdgeschäftsführungswille fehlt in den Fällen des § 994 Abs. 2 stets. Einschlägig sind bei berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag § 683 S. 1 oder §§ 683 S. 2, 679; § 683 S. 1 ggf. auch infolge Genehmigung über § 684 S. 2. Für notwendige Verwendungen, die dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Eigentümers widersprachen (unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag), gelten dagegen §§ 684 S. 1 mit §§ 812 ff., insb. 818 Abs. 3. Verwendungen, die zum Erhalt der Sache nicht objektiv erforderlich waren, aber dennoch wertsteigernd wirken (sog. nützliche Verwendungen, vgl. § 996) kann der bösgläubige Besitzer gar nicht ersetzt verlangen.
e) Anspruch des Eigentümers auf Nutzungen
aa) Vorbemerkung
1067
Die Darstellung der nachfolgenden Anspruchsgrundlagen systematisiert nach Inhalten, was vorstehend anhand der Qualitäten des Besitzes (persönlicher Anwendungsbereich) erläutert worden war.
bb) Nutzungsersatz des unredlichen Besitzers (§§ 987, 990)
1068
Der unredliche Besitzer haftet dem Eigentümer einer Sache für alle Nutzungen, die er während des Bestehens einer Vindikationslage zieht oder zu ziehen schuldhaft unterlässt, §§ 990 Abs. 1, 987. Unredlich ist der unrechtmäßige Besitzer, der beim Besitzerwerb seinen Mangel im Recht zum Besitz kannte oder ihn von Anfang an grob fahrlässig verkannt hat. Gleiches gilt für den, der erst nach Besitzerwerb von seinem Mangel im Recht zum Besitz in einer Weise erfuhr, dass „ein redlich Denkender, der vom Gedanken an den eigenen Vorteil nicht beeinflusst ist, sich der Überzeugung seiner Nichtberechtigung nicht verschließen würde“ (BGHZ 32, 76, 92). Der bösgläubige Besitzer weiß oder müsste jedenfalls wissen, dass er (mit ziemlicher Sicherheit) fremdes Gut bewirtschaftet, weshalb ihn eine gesteigerte Verantwortung gegenüber dem Eigentümer trifft. Sein Verschulden ist nicht nur „gegen sich selbst“ gerichtet, sondern darf ihm als solches gegen einen anderen angerechnet werden. Er wirtschaftet faktisch als Treuhänder auf fremde Rechnung.
Beispiel:
Die Pflicht zur „Herausgabe“ passt wörtlich nur auf die gezogenen und noch unverbraucht vorhandenen Früchte der Sache und entspricht für Sachfrüchte dem Anspruch aus § 985. Eigenständige Bedeutung hat die Vorschrift der §§ 990 Abs. 1, 987 v.a. für Rechtsfrüchte (Einnahmen aus Vermietung oder Verpachtung der Sache durch den Besitzer). Außerdem greift die Anspruchsgrundlage für verbrauchte oder schuldhaft nicht gezogene Früchte und die nach § 100 ebenfalls zu den Nutzungen gehörenden Gebrauchsvorteile (z.B. aus der Benutzung der Gegenstände außerhalb wirtschaftlicher Zwecke oder als Hilfsmittel im Arbeitsprozess), die aufgrund §§ 990 Abs. 1, 987 und entgegen dem Wortlaut „Herausgabe“ nach ihrem Wert zu vergüten sind.
Im Fall des Verbrauchs von Sachfrüchten durch den bösgläubigen Besitzer liegt zudem meist eine Eigentumsverletzung vor, für die er auch nach §§ 989, 990 schadensersatzpflichtig ist, sofern der Verbrauch seinerseits schuldhaft, zumindest leicht fahrlässig, war und er also das fremde Eigentum hätte kennen müssen. Verschulden fehlt z.B. bei zufälligem Untergang und entschuldbarem Rechtsirrtum über das Eigentum an Früchten. Das Eigentum an den Sachfrüchten richtet sich dabei nach §§ 953 ff. Danach hätte ein im Zeitpunkt der Trennung der Früchte (noch) gutgläubiger Eigenbesitzer Eigentum nach § 955 erworben ebenso, wie ein Fremdbesitzer im Falle persönlicher Aneignungsgestattung nach § 956 (z.B. als Pächter). Die Unwirksamkeit eines solchen Pachtvertrags beseitigt dabei die Aneignungsgestattung als Verfügungsgeschäft nach h.M. nicht von selbst, sondern gibt dem Verpächter-Eigentümer im Regelfall lediglich ein Widerrufsrecht.
Darüber hinaus ist der unredliche Besitzer nur bei Verzug für den zufälligen Untergang gezogener Früchte auf Schadensersatz haftbar (vgl. §§ 990 Abs. 2, 287 S. 2).
cc) Nutzungsersatzanspruch gegen den redlichen Besitzer nach Eintritt der Rechtshängigkeit (§ 987)
1069
Dem bösgläubigen Besitzer wird der redliche, aber auf Herausgabe verklagte Besitzer hinsichtlich Herausgabe und Wertersatz für Nutzungen gleichgestellt. Eine Schadensersatzpflicht wie eine Verzugshaftung tritt durch die Rechtshängigkeit des Herausgabeanspruchs nicht (automatisch) auch ein, weil der in Bezug auf sein vermeintliches Besitzrecht bislang Redliche wegen bloßer Klageerhebung noch nicht zu umgekehrter Gewissheit gelangen muss (letztlich eine Frage der Qualität des Tatsachenvortrags der Klagebegründung). Die treuhänderische Wertersatz- und Herausgabepflicht hinsichtlich gezogener und (nach § 987 Abs. 2) schuldhaft nicht gezogener Nutzungen rechtfertigt sich gegenüber dem Prozessbesitzer jedoch daraus, dass dieser jedenfalls ab Rechtshängigkeit mit dem Fehlen seines Rechts zum Besitz in formalisierter Weise rechnen musste.
Beispiel:
„Herausgabe“ von Sachfrüchten umfasst gegenüber dem redlichen (verklagten) Besitzer nicht nur die Besitzübertragung, sondern die Übereignung, da der gutgläubige Eigenbesitzer nach § 955 Abs. 1 ebenso wie der gutgläubige Erwerber eines dinglichen Nutzungsrechts (Nießbrauch nach § 1030 Abs. 1 oder Nutzungspfand nach § 1213) nach § 955 Abs. 2 das Eigentum an Sachfrüchten erlangt.