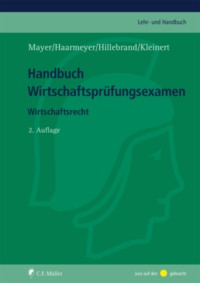Kitabı oku: «Handbuch Wirtschaftsprüfungsexamen», sayfa 64
dd) Prüfungsschema: Nutzungsersatz gem. §§ 987 Abs. 1, 990 Abs. 1
1070
| 1. | Vindikationslage zur Zeit der Nutzungsziehung |
| 2. | Nutzungsziehung gem. § 100 BGB i.V.m. § 99 BGB |
| 3. | Rechtshängigkeit (§§ 253, 261 ZPO) oder Bösgläubigkeit (Bezugspunkt der Bösgläubigkeit = eigenes Recht zum Besitz) |
| 4. | Kein Dreipersonenverhältnis i.S.d. § 991 Abs. 1 (§ 991 Abs. 1 sonst vorrangig) |
ee) Prüfungsschema: Nutzungsersatz gem. §§ 987 Abs. 2
1071
| 1. | Vindikationslage zur Zeit der Nutzungsziehung |
| 2. | Rechtshängigkeit (§§ 253, 261 ZPO) |
| 3. | Keine Nutzungsziehung (§§ 100, 99) nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft trotz Möglichkeit dazu |
| 4. | Verschulden |
ff) Nutzungsersatz des redlichen unentgeltlichen Besitzers vor Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs (§ 988)
1072
Der unrechtmäßige aber redliche Besitzer wird in den §§ 987 ff. privilegiert. Soweit er den Besitz unentgeltlich erlangt hatte und ein Recht zum Besitz auch nicht gutgläubig erwerben konnte (vgl. §§ 932 ff., 935), muss er die tatsächlich gezogenen Nutzungen (Früchte und Gebrauchsvorteile, § 100) nur nach Bereicherungsrecht herausgeben oder ersetzen (vgl. § 988). Es handelt sich um eine Rechtsfolgenverweisung, die den Ausgleich darauf begrenzt, dass der Besitzer um den Wert der Nutzungen noch bereichert ist (vgl. § 818 Abs. 3). Eine verschärfte Haftung nach §§ 818 Abs. 4, 819 ist aufgrund seiner Redlichkeit kaum denkbar, allenfalls in den Ausnahmefällen nach § 819 Abs. 2. – § 988 ist dabei eine konsequente Ergänzung zu § 816 Abs. 1 S. 2, wonach der unentgeltliche Erwerber-Eigentümer dem früheren Eigentümer gutgläubig erworbenes Eigentum einschließlich gezogener Nutzungen (vgl. § 818 Abs. 1 Alt. 1) herausgeben muss.
In Anwendung der sog. Saldotheorie kann der nach § 988 ersatzpflichtige unentgeltliche redliche Besitzer dabei seine Aufwendungen als eigene Entreicherung von dem gegen ihn gerichteten Bereicherungsanspruch in Abzug bringen (vgl. dazu Rn. 717–719). Insoweit sind dann auch nach den §§ 994 nicht ersatzfähige Verwendungen abzugsfähig und zwar ohne Rücksicht auf das ansonsten nach § 1001 bestehende Erfordernis, dass der Eigentümer die Sache zurückerlangt oder die Verwendungen genehmigt hätte.
1073
Gleiches soll nach § 988 auch für den „rechtsgrundlosen“ redlichen Besitzer gelten, wenn nämlich dem Besitzer nicht nur sachenrechtlich ein Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer von vornherein fehlt (Vindikationslage der §§ 985, 986), sondern auch das der Besitzeinräumung zugrundeliegende schuldrechtliche Kausalgeschäft unwirksam ist.
Beispiel:
Eigentümer E leiht dem L eine Sache, die L an den redlichen M weitervermietet. Ist der Mietvertrag unwirksam, fragt sich, ob E von M Nutzungen ersetzt verlangen kann, § 988.
M ist hier unrechtmäßiger Besitzer, weil L zur Überlassung an M nicht berechtigt war (§ 603 S. 2) und M deshalb kein gegenüber E wirksames Recht zum Besitz erwerben konnte. Als redlicher Besitzer ist M durch § 993 Abs. 1 HS. 2 geschützt. Ausnahmen bestehen lediglich nach § 991 Abs. 2, 989 für Beschädigungen und nach § 998 für Nutzungen. Allerdings erlangte M den Besitz nicht unentgeltlich, sondern beabsichtigte, an L Miete zu zahlen. Aus der Nichtigkeit des Mietvertrags folgt kein Wille zur Unentgeltlichkeit, lediglich fallen die Mieten weg. M bräuchte die Nutzungen (Gebrauchsvorteile) daher E weder herauszugeben, noch zu vergüten. Vielmehr müsste M nach §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, 818 Abs. 1 Alt. 1 dem L solche Nutzungen ersetzen. L wiederum haftete dem E (zur bereicherungsrechtlichen Haftung insoweit vgl. Rn. 687). – Ein Durchgriff des E gegen L analog § 988 hätte hier nur hinsichtlich des sonst von E zu tragenden Insolvenzrisikos bei L Vorteile.
1074
Anders sieht das im Zwei-Personen-Verhältnis aus.
Beispiel:
Veräußert E an K und ist nur der Kaufvertrag unwirksam, sind die ausgetauschten Leistungen samt gezogener Nutzungen zu kondizieren. Hatte E die Sache aber bereits K übergeben, aber (noch) nicht wirksam übereignet, wird K gegenüber E wiederum durch § 993 Abs. 1 S. 1 privilegiert. Schließt das auch den Bereicherungsausgleich aus, schuldete er danach gar keine Nutzungsvergütung. Dieses unbefriedigende Ergebnis ist nun parallel zum vorangegangenen Beispiel entweder durch Rückgriff auf die Leistungskondiktion zu korrigieren, die nach hiesiger Ansicht stets von der Sperrwirkung unberührt bleibt (vgl. Rn. 703). Oder man nimmt mit der st. Rspr. eine Regelungslücke an, zu der die Sperrwirkung in § 993 Abs. 1 HS. 2 führt, wenn sie auch die Leistungskondiktion betreffen soll. Diese Regelungslücke würde dann die Analogie zu § 988 rechtfertigen.
Eine gänzlich andere Lösung schlagen Brehm/Berger, Sachenrecht Ziff. 8.31–33 vor und wenden weder die condictio indebiti noch § 988 analog an. Vielmehr soll der redliche Besitzer stets alle Nutzungen behalten dürfen (Ausnahme nur § 988 für den unentgeltlichen Besitzerwerb). Das Missverhältnis zum ersten Beispiel oben wird vielmehr dadurch aufgelöst, dass § 818 Abs. 1 Alt. 1 weithin unangewendet bleiben solle. Soweit das anhand eines Vergleichs mit dem Erwerb einer abhanden gekommenen Sache vom Nichtberechtigten bei zudem (Abweichung vom sog. Jungbullenfall, s. Rn. 1032) nichtigem Kaufvertrag begründet wird, ist diese Lösung auch zur hiesigen Ansicht konsequent, weil insoweit eine Direktkondiktion als Eingriffskondiktion an § 993 Abs. 1 HS. 2 scheitert (Nutzungen sind dem redlichen Besitzer zugewiesen und nicht „auf Kosten“ des Eigentümers erlangt).
Durchgängig identische Lösungen für alle Fallgestaltungen des „rechtsgrundlosen“ Besitzes werden einzig mit der Analogie zu § 988 erreicht, die ggf. mit der Leistungskondiktion des Eigentümers konkurriert.[89]
gg) Prüfungsschema: Nutzungsersatz gem. §§ 988, 812 ff.
1075
| 1. | Vindikationslage zur Zeit der Nutzungsziehung |
| 2. | Nutzungsziehung gem. §§ 100, 99 |
| 3. | Keine Bösgläubigkeit/keine Rechtshängigkeit (sonst §§ 987, 990 Abs. 1) |
| 4. | Unentgeltliche Besitzerlangung (beachte: Gleichstellung des rechtsgrundlosen Erwerbs (h.M.)) |
| 5. | Rechtsfolgenverweisung auf §§ 812, 818 |
hh) Anspruch auf Übermaßfrüchte gegen den redlichen entgeltlichen und unverklagten Besitzer (§ 993 Abs. 1)
1076
Greift keine der schärferen Haftungsvorschriften der §§ 987, 988 oder 990 i.V.m. § 987, darf der hinsichtlich seines Rechts zum Besitz redliche Besitzer die vor der Rechtshängigkeit des Herausgabeanspruchs gezogenen Nutzungen ersatzlos behalten, sofern sie den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen. Dies gilt auch dann, wenn sie noch unverbraucht vorhanden sind. Lediglich darüberhinausgehend gezogene „Übermaßfrüchte“ sind als ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben (vgl. § 993 Abs. 1).
ii) Haftung des deliktischen Besitzers nach § 992
1077
Der Deliktsbesitz folgt, wie bereits erörtert, aus den Umständen des Besitzerwerbs, so dass ein solcher Besitzer hinsichtlich seines Besitzrechts zwar wohl meist unredlich sein wird, u.U. aber doch auch redlich sein kann. Wer sich z.B. im Vertrauen auf ein gültiges Testament, das sich erst später als nichtig herausstellt, als vermeintlicher Erbe in den Besitz des Nachlasses setzt, begeht dem wahren Erben gegenüber verbotene Eigenmacht (vgl. zum Erbenbesitz Rn. 933), ist selbst aber durchaus redlich.
1078
Der Deliktsbesitzer haftet auf Nutzungen nach §§ 823 ff., die er selbst gezogen hat oder hätte ziehen können sowie solche, die der Eigentümer ohne die Entziehung der Sache gezogen hätte (z.B. Mieteinnahmen, die der gewerblich tätige Eigentümer hätte erzielen können, der Besitzer etwa mangels entsprechender Geschäftsverbindungen aber nicht). Während § 987 lediglich eine Rechtsfolgenverweisung auf Bereicherungsrecht enthält, handelt es sich in § 992 beim Verweis auf das Recht der unerlaubten Handlungen um einen solchen auch auf die Deliktsvoraussetzungen (Rechtsgrundverweis). Dies deswegen, um denjenigen zu schützen, der schuldlos verbotene Eigenmacht beging und deshalb nicht nach §§ 823 ff. haften soll, sofern ihm nicht zusätzlich doch ein Verschulden vorwerfbar ist. Solches Verschulden muss sich auf die verbotene Eigenmacht beziehen.[90]
jj) Ausnahme: Eingeschränkte Haftung des bösgläubigen Besitzmittlers (§ 991 Abs. 1)
1079
Richtet sich der Nutzungsersatz gegen einen Besitzmittler (z.B. ein Kommissionär), so haftet dieser trotz, dass er selbst eventuell unredlich ist (weil er die wahre Provenienz des Kommissionsguts und die Umstände des Besitzverlusts beim Eigentümer kennt), dem Eigentümer nicht weitergehender, als sein Oberbesitzer (Kommittent). Ist also der mittelbare Besitzer redlich und unverklagt, haftet auch der unredliche Besitzmittler nur nach § 993 Abs. 1 HS. 2 Dass dadurch der bösgläubige unmittelbare Besitzer von der Redlichkeit des anderen profitiert, für den er den Besitz ausübt, dient nicht seinem Schutz, sondern dem des Oberbesitzers. Dieser wäre ansonsten ggf. Regressansprüchen des Besitzmittlers aus dem zwischen ihnen bestehenden Schuldverhältnis ausgesetzt. Der redliche Oberbesitzer hätte einen Nachteil daraus, dass er die zu vindizierende Sache einem unredlichen Besitzmittler überlässt, obwohl er als redlicher Besitzer an seine freie Rechtsmacht glauben durfte.
1080
Ist das Besitzmittlungsverhältnis jedoch ein Mietverhältnis, schließen § 536b Sätze 1, 2 entsprechende Regressansprüche des bösgläubigen Mieters aufgrund der §§ 536, 536a aus, so dass in diesem Fall, ebenso wie aufgrund § 581 Abs. 2 im Fall der Pacht, § 991 Abs. 1 doch nicht zur Anwendung kommt (Rückausnahme).
kk) Prüfungsschema: Nutzungsersatz gem. § 991 Abs. 1 (Dreipersonenverhältnis)
1081
| 1. | Vindikationslage zur Zeit der Nutzungsziehung |
| 2. | Nutzungsziehung gem. §§ 100, 99 |
| 3. | Bösgläubigkeit/Rechtshängigkeit bzgl. Anspruchsgegner (unmittelbarer Besitzer) |
| 4. | Anspruchsgegner steht in mittelbarem Besitzverhältnis als Besitzmittler a) Besitzmittlungsverhältnis b) Fremdbesitzerwille des Besitzmittlers c) Herausgabeanspruch des mittelbaren Besitzers |
| 5. | Bösgläubigkeit/Rechtshängigkeit auch bzgl. mittelbarer Besitzer |
f) Anspruch des Eigentümers auf Schadensersatz
1082
Vergleichbar zur Herausgabe der Nutzungen sind die Klagebefugnisse auf Schadensersatz aufgebaut.
aa) Sperrwirkung des § 993 Abs. 1 HS. 2
1083
§ 993 Abs. 1 HS. 2 schließt eine Schadenshaftung des redlichen Besitzers vor Rechtshängigkeit des Herausgabeanspruchs hinsichtlich einer Beschädigung oder Zerstörung der Sache aus. Von diesem Ausschluss nicht umfasst sind sonstige Eingriffe in die Substanz der Sache, so deren Verbrauch, Verarbeitung oder Veräußerung. In diesen Fällen muss auch der redliche Besitzer das Erlangte nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 (bei Verarbeitung über die Verweisung in § 951 Abs. 1) oder (bei wirksamer Veräußerung) nach § 816 Abs. 1 S. 1 herausgeben bzw. schuldet er Wertersatz nach § 818 Abs. 2 Alt. 2 (damit korrespondiert die Pflicht zur Herausgabe von Übermaßfrüchten in § 993 Abs. 1 HS. 1).
Beachte:
Die Problematik solcher Fälle liegt sodann im Bereicherungsrecht bei Mehrpersonenverhältnissen und zwar im Hinblick auf eine erbrachte Gegenleistung. Im Zwei-Personen-Verhältnis stehen sich auch in der Rückabwicklung Bereicherung durch die Sachleistung und erbrachte Gegenleistung stets verrechenbar gegenüber. Umgekehrt scheiden Bereicherungsansprüche von vornherein aus, soweit der Verarbeitende oder Verbrauchende die fremde Sache von einem Zwischenmann gutgläubig erworben hatte (Kondiktionsfestigkeit des gutgläubigen Erwerbs).
Ist also Verarbeitender nicht derjenige, der seinen Besitz unmittelbar vom Eigentümer ableitet, sondern ein Dritter (z.B. sog. Jungbullen-Fall, s. Rn. 1032), und erwirbt der Dritte aufgrund der Verarbeitung das Eigentum (sog. Einbaufälle, vgl. Rn. 674 ff.), ist die Eingriffskondiktion des verlierenden Eigentümers ausgeschlossen, weil sich der Vorgang nach §§ 946 oder 950 als (fiktive) Leistung des Zwischenmannes darstellt. Begründung ist der Vorrang der Leistungskondiktion (bzw. dass der Erwerb dann nicht „auf Kosten“ des früheren Eigentümers erfolgte, der die Sache vielmehr „in Verkehr gebracht“ hatte, vgl. Rn. 676). Regelmäßig wird ein solches Leistungsverhältnis sogar nur zu verneinen sein, wenn die Sache dem früheren Eigentümer abhanden gekommen war (oben Rn. 675: Eigentum hätte wegen § 935 auch nicht rechtsgeschäftlich geleistet werden können). Anderenfalls geht dann der frühere Eigentümer gegenüber dem Erwerber aus der Verarbeitung leer aus. – Diese Konsequenz vermeidet BGHZ 40, 272 (Direktkondiktion), indem für die Einbaufälle eine Leistung des früheren Eigentümers direkt an den Dritten, also den Erwerber aus der Verarbeitung, angenommen wird (arg.: Verarbeitung erst ermöglicht durch Lieferung) und außerdem für § 951 auch eine Verweisung auf die Leistungskondiktionen bestehen soll.
Trotz Vindikationslage gehen also § 816 (bei Veräußerung), die Eingriffskondiktion (mit § 818 Abs. 2) bei Verbrauch und (über § 951 auch) bei Verarbeitung der Sache der Sperrwirkung vor. Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ist insoweit nicht abschließend, weil Einwirkungen auf die Sachsubstanz dort nicht privilegiert werden.
bb) Schadensersatz des redlichen Fremdbesitzers nach §§ 991 Abs. 2, 989
1084
Ist der redliche Besitzer Fremdbesitzer, gilt seine Privilegierung in Schadensfällen nur, soweit er sich im Rahmen seines vermeintlichen Besitzrechts hält (beim Eigenbesitzer ist dies notwendigerweise stets der Fall, da er vermeinen darf, mit der Sache nach Belieben verfahren zu können). § 993 Abs. 1 HS. 2 wird deshalb durch § 991 Abs. 2 dahin eingeschränkt, dass der Fremdbesitzer dem Eigentümer stets insoweit haftbar ist, wie er einem Dritten, dem er den Besitz vermittelt, haftet. Der redliche Mieter vom dazu unberechtigten Nichteigentümer z.B., der den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache überschreitet, haftet nicht nur seinem Vermieter, sondern nach §§ 991 Abs. 2, 989 gleichermaßen auch dem ihm unbekannten Eigentümer. – Nota bene: Ersetzt er nun entsprechende Schäden seinem Vermieter, wird er dadurch analog § 851 auch gegenüber dem Eigentümer frei. Dieser kann seinerseits die Beträge nach § 816 Abs. 2 vom nichtberechtigten Vermieter herausverlangen, unbeschadet ggf. weiterer Ansprüchen gegen diesen nach §§ 987 ff.
cc) Prüfungsschema: Schadensersatz gem. §§ 991 Abs. 2, 989
1085
| I. | Vindikationslage zur Zeit des schädigenden Ereignisses |
| II. | Gutgläubigkeit bei Besitzerwerb |
| III. | Verschlechterung/Unmöglichkeit der Herausgabe wie in § 989 |
| IV. | Schaden |
| V. | Haftung des Besitzers gegenüber einem mittelbaren Besitzer 1. Bestehen eines mittelbaren Besitzverhältnisses a) Besitzmittlungsverhältnis b) Fremdbesitzerwille des Besitzmittlers c) Herausgabeanspruch des mittelbaren Besitzers 2. Haftungsanspruch des mittelbaren Besitzers gegen Besitzer Beachte: Haftungsprivilegierungen, z.B. §§ 599, 690 i.V.m. § 277 |
dd) Sog. Fremdbesitzerexzess
1086
Über § 991 Abs. 2 hinaus haftet auch der redliche Fremdbesitzer im Exzess bei unwirksamen Besitzmittlungsverhältnis und zwar davon unabhängig, ob er den exzessiv gebrauchten Besitz vermeintlich dem Eigentümer oder einem Dritten vermittelt. Schädigt z.B. ein Nießbraucher oder Mieter die ihm überlassene Sache, ist er dem Eigentümer nach § 823 Abs. 1 und zugleich wegen Verletzung schuldrechtlicher Pflichten (auch der Nießbrauch begründet ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Eigentümer und Nießbraucher) nach § 280 Abs. 1 haftbar. Sind sodann Nießbrauch bzw. Miete unwirksam und der Besitzer deshalb ein unrechtmäßiger (vgl. §§ 985, 986) muss die Haftung aus § 823 Abs. 1 trotz der Sperrwirkung des § 993 Abs. 1 HS. 2 greifen, obwohl das Gesetz diesen Fall übersehen hat. Diese Schadenshaftung besteht nach §§ 823 Abs. 1, 991 Abs. 2 analog. Denn wären Miete oder Nießbrauch wirksam, aber mit einem nichtberechtigten Nichteigentümer geschlossen, wäre der Mieter bzw. Nießbraucher ebenfalls unrechtmäßiger Besitzer, hafte aber dem wahren Eigentümer trotz Redlichkeit für Besitzexzesse nach § 991 Abs. 2. Die Haftung tragen aber auch §§ 989, 990. Denn hinsichtlich des Exzesses ist auch der ansonsten redliche unrechtmäßige Besitzer gleichsam bösgläubig (Ähnlichkeit zum „Aufschwungbesitz“).