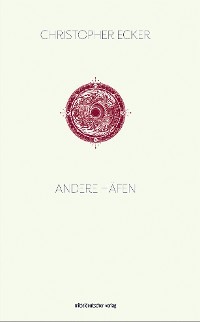Kitabı oku: «Andere Häfen», sayfa 2
DAS MUSEUM ZU KNOSSOS
Er hatte die Geschichte nie niedergeschrieben. Oh, wie gut hätte sie in den Band Der Garten der Pfade, die sich verzweigen gepasst! Diese Geschichte nicht niederzuschreiben, war für ihn, wie eine Wanderung zu einem reizvollen Ort so lange aufzuschieben, bis man auf einmal feststellen muss, dass es diesen Ort seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Trotzdem kam es ihm vor, als hätte er die Geschichte irgendwann einmal geschrieben, in einem Traum, einem anderen Leben, als ein anderer, der doch er selbst war. Motivisch hätte sie sich nahtlos und nicht ohne Eleganz zwischen Die Lotterie in Babylon (nichts als Zufall gestaltet unser Dasein) und Die Bibliothek von Babel (die Welt ist eine Bibliothek) eingefügt. Es ist hier leider nicht der Ort, über die Gründe zu spekulieren, weshalb er nie Das Museum zu Knossos schrieb, einen im sachlichen Ton gehaltenen Bericht über jenes riesige Museum, von dem schon der Bildhauer Apollodoros in einem Fragment berichtet. Das Museum, erfährt man dort, „stellte Verschiedenes mit dem Anspruch der Vollständigkeit aus“. Offenbar kennzeichneten Tontäfelchen die Exponate. Eines Tages jedoch beschloss ein Fürst oder eine Gruppe von Fürsten, die erklärenden Tontäfelchen zu entfernen, damit „das Staunen ohne Grenzen“ sei. Von nun an war für die Besucher nicht mehr ersichtlich, wie die Künstler hießen, die für die Ausstellungsstücke verantwortlich zeichneten. Und auch das, was die Kunstwerke darstellten, befand sich von nun an im Bereich der Mutmaßung. Dennoch erfreute sich das Museum eines großen Zustroms von Besuchern, die zum Teil von weither angereist kamen. So erwähnt Apollodoros beispielsweise einen König mit Haut wie Lavagestein oder einen Krieger mit einem Bart, der „als lodernde Flamme“ vom Kinn auf den Brustpanzer hing, „ohne das Metall zu schmelzen“. Wie es zu der zweiten großen Veränderung des Museums kam, ist hingegen ungewiss. Jedenfalls tauchten plötzlich zahlreiche neue Ausstellungsstücke auf, über die niemand zu sagen vermochte, ob sie der Fürst oder ein geheimes Konsortium angekauft oder ob sie einige der Wärter absichtlich oder unabsichtlich platziert hatten. Der Gang durch das Museum war, so Apollodoros, „wie vor der Sphinx zu stehen und sie reden zu hören“, womit er bildhaft ausdrückt, dass es für den Besucher nicht mehr klar begreiflich war, ob er überhaupt ein Exponat bewunderte, wenn er staunend vor etwas innehielt. Des ungeachtet erfreute sich das Museum zu Knossos auch weiterhin größter Beliebtheit. Wir wissen von Aristoteles, dass er sich erst nach einer Reise nach Kreta reif dazu fühlte, seine Gedanken vor Publikum zu äußern. Doch die Geschichte ist hiermit noch nicht zu Ende. Ob die Wärter mit ihren Familien in die Räume des Museums einzogen und dort offene Feuer entfachten, um die sie allabendlich saßen und sangen, ist ungewiss. Ungewiss ist auch, ob das Konsortium eines Tages tatsächlich beschloss, die Mauern einzureißen. Vermutlich war es eher so, wie es bei Raimundus Lullus heißt: Die Mauern des Museums stürzten ein, die Räume wurden endlos. Was war die Folge? Der Besucher des Museums konnte seitdem nie sicher sein, ob er sich noch im Museum befand und, weitaus bedeutender, ob das, vor dem er andächtig staunend verharrte, ein Exponat war oder „etwas anderes“ (Robert Louis Stevenson). Und Reiche vergingen, Paläste wurden zu Trümmern, zu Staub, den der Wind davontrieb, dann vergessen, aber das Museum blieb bestehen. Dachte er als alter Mann an die nie aufgeschriebene Geschichte, sah er stets den letzten Satz, sah ihn so deutlich vor Augen, als hätte er ihn seiner Sekretärin diktiert: An jenem Abend im Jahr 1939 stieg ich aus der Straßenbahn, flanierte in der Müßigkeit des Ortsfremden durch die Stadt und blieb sinnend vor etwas stehen, von dem ich nicht wusste, ob es ein Mülleimer oder eine Zierurne oder etwas anderes war.
MAGST DU MICH?
Die Wahl zum Präsidenten der Insel veränderte meinen Tagesablauf in einigen wenigen, entscheidenden Punkten. Kostümierte Lakaien weckten mich um 6.30 Uhr, wuschen mich mit in warme Kokosmilch getauchten Schwämmen, applaudierten bei der Verrichtung des Morgenstuhls (6.45 Uhr), parfümierten mich, kleideten mich an und reichten mir um 6.49 Uhr die Maske, hinter der ich mich ab 7.15 Uhr allmählich wohlzufühlen begann. Nach einem kleinen Frühstück am Schreibtisch brachte man mich in der Sänfte zum Richtplatz. Richten bis 10.30 Uhr. Kopulation. Regierungsgeschäfte am Schreibtisch. Reichhaltiges Mittagessen mit anschließendem Stuhlgang um 12.15. Danach lange Gespräche mit der Maske bis zum Sonnenuntergang.
„Bist du glücklich?“
„Ja“, sagte ich.
„Magst du mich?“, fragte die Maske.
„Natürlich“, sagte ich – aber was hätte ich denn anderes sagen sollen? Ich war doch Präsident der Insel! Abends trennten sich gegen 21.45 im Sommer und 22.45 Uhr im Winter unsere Wege. Ich las die Klassiker oder dilettierte in allegorischer Dichtung, und die Maske begann ihren Streifzug durch die übel beleumundeten Viertel der Hauptstadt, um in Kontakt zu meinen Untertanen zu bleiben.
Um Punkt 24 Uhr ging ich zu Bett.
DAS AUGE DER SPHINX
„Was sind wir?“, fragte er mit diesem überlegenen Lächeln, das seine Reden begleitete, sobald er sicher war, nicht mehr verstanden zu werden. Nichtsdestotrotz sahen wir ihn erwartungsvoll an, hörten wir ihn doch nach wie vor gerne sprechen und schätzten ihn für all das, was er glaubte, nicht zu sein – und dennoch für uns war. „Was sind wir denn anderes“, fuhr er lächelnd fort, „anderes“, wiederholte er, „als eine Sammlung von Eindrücken, ein Album voller Collagen, die man staunend betrachtet: Das weiche Polster, auf dem ich sitze. Das Abteil, aus dessen geöffnetem Fenster ich hinausschaue. Die Dackel auf dem Bahnsteig – oder sind das da draußen Ratten? Der Mann mit dem Bowler und dem Vogelgesicht. Die Silhouette des Mont-Saint-Michel am Horizont. Die bloßen Beine der Schlafenden, unter deren zu kurzen Rock man, wie ihr sicher selbst schon bemerkt habt, sehen kann. Meine Schuhe auf dem schraffierten Boden.“ – Wir warteten geduldig, dass er weitersprach, doch anstatt die Lektion fortzuführen, hob er die rechte Hand und spreizte die Finger. Dann ballte er die Hand zeitlupenlangsam zur Faust und schüttelte sie, als wollte er ein gefangenes Insekt benommen und fluchtunfähig machen. Erst dann entließ er uns mit einem Kopfnicken. Es war, wussten wir, höchste Zeit, ins Bett zu gehen und darauf zu warten, dass der Schlaf Seite um Seite des Albums umblätterte, dessen Bilder so stark mit Bedeutung aufgeladen waren, dass jedes Blatt aus sich selbst heraus zu leuchten schien.
DIE ERSTE GESCHICHTE
Am zweiten Tag auf dem Dach stießen wir auf einen anderen Trupp, eine Gruppe zerlumpter Frauen und Kinder, die im Schatten eines Schornsteins lagerte. Als sich Johann, der damals unser bester Späher und Fährtenleser war, den Lagernden näherte, hoben sie die Hände, als wollten sie einen bösen Zauber abwehren. Hinter mir drängten sich die Kinder zusammen wie aus dem Nest gefallene Vögel.
„Johann!“, rief ich. „Frag sie, wie lange sie schon unterwegs sind!“
„Sie reden nicht mit mir“, rief Johann über die Schulter. Er hatte uns den Rücken zugekehrt, die Fremden sahen ihn ausdruckslos an und streckten ihm die Handflächen entgegen. Nach einer Weile spuckte Johann zur Seite aus und kehrte zu uns zurück.
„Die Kinder sind müde“, klagte die Frau mit dem Kropf, die sich uns am späten Vormittag angeschlossen hatte.
„Gehen wir weiter!“, sagte ich, hob die Standarte und hörte, wie der Trupp sich hinter mir murrend in Bewegung setzte.
In den folgenden Tagen begegneten wir niemandem mehr auf unserem Marsch über die Dachschrägen und Betonflächen. Manchmal stießen unsere Vogeljäger auf die Reste von Lagerfeuern. Einmal fanden wir einen ausgeweideten Leichnam, der sich allerdings in einem so fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand, dass man nicht sagen konnte, ob die Verstümmelungen das Werk anderer Wanderer oder das der allgegenwärtigen Raben waren. Einige in unserem Trupp hatten bereits damals, was mich mit Sorge erfüllte, begonnen, die Raben um Hilfe zu bitten und ihnen, wenn sie glaubten, ich sähe es nicht, kleinere Opfergaben darzubringen. Als wir dem Trupp mit den zerlumpten Gestalten ein zweites und möglicherweise letztes Mal begegneten, hatten die Kinder, die uns begleiteten, ihrerseits Kinder bekommen. Johanns Ältester, der nach dessen Absturz das Amt des Spähers und Fährtenlesers innehatte, näherte sich den Gestalten, die im Sonnenlicht über das Ziegeldach verteilt lagen wie vom Himmel gefallene Seesterne, und streckte ihnen dabei abwehrend oder vielmehr beschwörend die Handflächen entgegen, wie es ihn die Raben gelehrt hatten.
IM KELLER DES UHRMACHERS
Es war einmal ein kleines Märchen, das lebte mit seinen Eltern in einem prächtigen Haus in der Hauptstadt des Reiches. Wie bei allen jungen Märchen war seine Handlung verworren: Es handelte, so viel war gewiss, von einer schönen Prinzessin, die sich in zahlreichen Prüfungen bewähren muss, um als Belohnung einen tapferen Prinzen zum Gemahl nehmen zu dürfen. Allerdings war die Art der einzelnen Prüfungen unklar (das Märchen war ja noch sehr klein) und der tapfere Prinz war nicht einmal aufgetreten. Aber die Zeit, wussten die Eltern des Märchens, würde alles zum Guten wenden, denn so war das immer schon gewesen. Das Haus, in dem das kleine Märchen lebte, hatte keine Fenster (so wohnen Märchen am liebsten, weil sie so ganz bei sich sind), doch aus einem Grund, den keiner kannte oder kennen wollte, gab es gleichwohl ein Zimmer mit einem Fenster zur Straße. Natürlich war die Tür dieses Zimmers stets verschlossen. Der Vater des Märchens, ein sehr strenges Märchen mit religiöser Moral, und seine Mutter, ein eher weitschweifiges Märchen voller unlogischer Wendungen und alberner Rätsel, liebten ihr Kind so sehr, dass sie ihm verboten hatten, den Raum mit dem Fenster zu betreten. Aber eines Tages, als die Eltern Mittagsschlaf hielten, nahm das kleine Märchen den Schlüssel vom Haken, schlich sich hinauf, öffnete die Tür und sah aus dem Fenster. Draußen kämpften zwei Bettelknaben um eine Rübe. Erst schubsten sie sich, dann schlug der eine den anderen nieder, entwand ihm die Rübe und schritt triumphierend von dannen, wobei er mit Genuss das Diebesgut verzehrte. Am nächsten Tag schlich sich das Märchen erneut hinauf, um aus dem Fenster zu schauen: Draußen fuhr gerade ein Karren vorbei, auf dem mehrere in Lumpen gekleidete Gestalten lagen. Sie schliefen nicht, begriff das Märchen plötzlich, sondern sie waren tot und der Schinder brachte sie zum Anger. „Was ist denn mit unserer Kleinen los?“, fragten sich die Eltern beim Tee. „Sie wirkt noch verworrener als sonst.“ Und Tag für Tag schlich sich das kleine Märchen von nun an zum Fenster und allmählich begann es sich zu verändern. Erst wuchs der schönen Prinzessin eine lange Nase, dann wurde sie dick und unförmig und schließlich war sie so hässlich, dass keiner sie mehr heiraten wollte. Nur ein entfernter Verwandter machte ihr noch den Hof, denn er war habgierig und wollte die Mitgift. Nach vielen weiteren Besuchen in dem verbotenen Raum mit dem Fenster zur Straße wurde die Prinzessin jähzornig und trat nach dem greisen Freier, der vor ihr kniete, und hatte nur Augen für den bösen Zauberer, der mit listigem Frettchenblick hinter dem Thron des Vaters hervorspähte. Und Tag für Tag schaute das kleine Märchen aus dem Fenster und schließlich wurde die Prinzessin sehr krank und lief lauthals Lieder singend, deren Texte allen Angst machten, durch das baufällige Schloss, in dem allerorten der Schimmel wucherte. Den Eltern blieb die Veränderung nicht unverborgen. „Was ist denn mit unserer Kleinen los?“, fragten sie sich beim Tee. „Findest du nicht auch, dass sie immer weniger wie ein echtes Märchen aussieht?“ Doch als die Eltern das kleine Märchen zur Rede stellen wollten, floh es mit dem Schlüssel die Treppe hinauf und sprang, als man an die Tür des verbotenen Raums klopfte, mit einem Satz hinunter auf die Straße, um nicht ausgeschimpft zu werden. Beim Sprung brach es sich beide Beine. Zum Glück kam ein betrunkener Uhrmacher vorbei, nahm es mit zu sich nach Hause, schiente notdürftig die Schenkel und kettete es im Keller an. Hier musste es Tag und Nacht schwerste Arbeiten verrichten: Kartoffeln schälen, Kessel polieren und noch vieles andere, worüber ich hier nicht sprechen möchte. Längst hatte das kleine Märchen keine erkennbare Handlung mehr. Eine fette, böse Frau (wohl die ehemalige schöne Prinzessin) prügelt sich mit einem fetten, bösen Mann (wohl der ehemalige tapfere Prinz) um eine gestohlene Rübe, ein dunkler Zauberer reitet auf seinem Mantel durch die kochende Zeit, ein Schloss oder eine Scheune stürzt ein, Blut strömt statt Wasser in den Flüssen des Reiches – und Kartoffeln wurden geschält und Kessel wurden poliert und noch vieles andere wurde getan, worüber ich hier nicht sprechen möchte. Fast jeden zweiten Abend war der Uhrmacher so betrunken, dass er zügellos auf das Märchen einprügelte und es wegen seiner schief und krumm zusammengewachsenen Beine verhöhnte, auf denen es sich kaum zum Wassereimer schleppen konnte. Und so vergingen die Jahre. Längst hatten die Eltern das Märchen vergessen – und noch schlimmer: Keiner wusste, dass es angekettet im Keller des Uhrmachers sein kärgliches Dasein fristete. Und weitere Jahre vergingen. Als der Uhrmacher sich endlich totgesoffen hatte, blieb das Märchen weiterhin angekettet im Keller und wurde von Tag zu Tag dünner und dünner. „Wäre ich doch bloß nicht aus dem Fenster gesprungen“, sagte es mit schwacher Stimme und rang die Hände, „dann wäre ich heute ein schönes Märchen und man würde mich erzählen, aber nun kennt mich keiner und es ist mein Schicksal, hier in diesem Kellerloch elendigst zu verhungern und zu verdursten. Ach, hätte ich doch nie aus dem Fenster geschaut!“ Kaum hatte es das gesagt, kam der Tod und breitete mit einem Lächeln seinen Mantel aus. Und so starb das Märchen. Aber hätte es jemand gelesen oder erzählt bekommen, es wäre ohnehin nicht mehr verstanden worden.
VOM FAGARÖM
Zu einem Zeitpunkt meines Lebens, als ich die Vergeblichkeit allen Strebens erkannt zu haben glaubte und mir redliche Mühe gab, mich mit diesem Gedanken anzufreunden, wodurch, ich verhehle es nicht, eine durchaus wohltuende Ruhe über mich kam, widerfuhr mir etwas, das, obwohl es die Vergeblichkeit, ja Nutzlosigkeit allen Strebens mehr als nur bestätigte, widerfuhr mir also etwas, das mich, meine Nachbarn und einige entfernte Bekannte, mit denen ich damals unregelmäßig zu korrespondieren pflegte, bis heute in eine dem Irrsinn nahe aufgepeitschte Unruhe stürzte. Dass die Wahrnehmung der Dinge durch unsere Sinne rein gar nichts mit den Dingen selbst zu tun hat, wie sie wirklich sind, ist eine Binsenweisheit, doch vergisst sie ein jeder allzu gerne, um ein betuliches, fast vergnügtes Leben in einer Dingwelt zu führen, die dadurch in eine Asservatenkammer verwandelt wird, inmitten der wir stehen und mal diesen, mal jenen Gegenstand aus den Regalen nehmen, um ihn prüfend zu begutachten. Das wusste ich und hatte mich, wie gesagt, damit (wie auch mit manchem anderen, über das zu sprechen hier nicht der rechte Ort ist) abgefunden, doch da stieß ich an einem sonnigen Märztag auf das Fagaröm und von nun an gab es einen Punkt in der Welt, der fest war, ein Ding, von dem ich guten Gewissens sagen konnte: Dieses Ding ist wirklich so, wie ich es mit meinen Sinnen wahrnehme. So und nicht anders! Ein Nebel, der entfernt einem vor vielen Jahren verstorbenen Studienfreund glich, offenbarte mir besagtes Objekt, zeigte es mir jedoch nur kurz und verschwand damit, nicht ohne einen erdigen Geruch nach Roter Bete im Hörsaal zurückzulassen, wo ich gerade über Raumzeit oder, ich bin mir nicht sicher, Zeitraum las. Im Grunde genommen verabscheue ich Banalitäten, und diese hastig hingeworfene Notiz vor meiner Abreise ähnelt verdächtig den Banalitäten, die ich normalerweise verabscheue, und wahrscheinlich hat sich, es ist eine gottverdammte, grässliche, ohne Rezept heillos zusammengerührte Scheiße dieses Leben, hat sich, verfluchte Kacke, hat sich also in meinem verfickten Leben niemals etwas geändert, nichts ändert sich jemals, auch wenn mir dieser, wie mir nun auffällt, grenzenlos blöde aussehende Gegenstand mitten in einer mitreißenden Vorlesung von einem meiner dümmsten und zudem seit Jahren mausetoten Studienkollegen dergestalt präsentiert wurde, als sollte ich vor diesem idiotischen Götzen aus einem Material, das nicht einmal irdisch war, jubilierend auf die Knie fallen. Ich breche nun wohl besser ab und gebe, um mich nicht gänzlich hirnverbrannt zu fühlen, an dieser Stelle ein Gespräch wieder, das ich vor kurzem mit dem Dekan führte, als wir uns in seinem Büro den einen oder anderen Cognac zu Gemüte führten.
„Nichtstun“, sagte er, „ist die schlimmste Form der Rache.“
„Wie meinen Sie das?“, fragte ich.
„Nichts zu tun, zeigt mehr als alle denkbaren Taten die Geringschätzung, die man für jemanden empfindet, der einen einst gequält oder erniedrigt hat.“
„Finden Sie?“
„Nichtstun sagt: Du bist es nicht wert, Opfer meiner Rache zu sein. Ich hasse und verachte dich so sehr, dass ich nichts tun werde.“
„Aber dennoch wünschen Sie, dass derjenige, an dem Sie sich rächen wollen, weiß, dass Sie sich nicht rächen, um ihn dadurch zu strafen.“
„Das ist richtig.“
„Sehen Sie den Denkfehler?“
„Wir befinden uns nicht in einem Seminar über Logik, mein Bester.“
„Da mögen Sie recht haben, aber ich finde, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn die, an denen man sich rächen will, wissen, wer sich an ihnen rächt.“
So weit, so gut. Aber, und jetzt merkt fein auf, warum ich mich an Euch räche, wisst Ihr nicht, ahnt Ihr nicht und werdet es nie erfahren.
AUF GLÜHENDEN KOHLEN
Natürlich hatten es mir meine Eltern verboten. Natürlich machte ich es trotzdem. Jürgens Eltern hatten es ihm auch verboten, aber auch ihn scherte das nicht die Bohne: Wir waren beste Freunde, saßen in der Grundschule nebeneinander und konnten uns nichts Aufregenderes vorstellen, als die Schlangenhöhle zu erkunden. In Schwarzenacker, dem Dörfchen, wo wir beide wohnten, befand sich im Wald hinter dem Römermuseum ein verzweigtes, sich über mehrere Ebenen erstreckendes Höhlensystem – die Schlangenhöhle. Hier hatten bereits die Römer den rötlichen Buntsandstein gebrochen, dessen Staub allen Besuchern Schuhe und Kleider färbte, verräterisch färbte, denn die Zugänge waren aus Sicherheitsgründen zugemauert. Beim Spielen im Wald hatten wir jedoch ein Loch im Hang entdeckt, kaum größer als ein Dachsgang und doch ein Schlupfloch, das uns mageren Zweitklässlern Einlass in das labyrinthische System gewährte. Da gab es Tunnel, kapellenartige Räume, Teiche, da gab es Kriechgänge, in denen man sich flach auf den Bauch pressen musste, und Röhren gab es da, die noch schmaler waren und hinab in tiefere Etagen führten, wo die Luft nach faulen Eiern roch. Eines Samstags kam Jürgen, dessen Eltern sich nicht sonderlich um ihn kümmerten, nach der Schule zu mir nach Hause, aß mit uns zu Mittag und danach zog es uns nach draußen. „Hast du die Kerzen?“, fragte ich. – „Klar!“, sagte Jürgen. – „Hast du die Streichhölzer?“, fragte ich. – „Klar!“, sagte er, denn seine Mutter rauchte, und schnurstracks ging es in den Wald zum Schlupfloch. An diesem Tag waren wir mutiger als sonst und erkundeten einen Bereich der Höhle, wohin wir uns nie zuvor gewagt hatten. Hinter einem absteigenden Stollen, in dem mehrere Ballen aufgerollten Stacheldrahts lagen, führte eine enge Röhre steil in die Tiefe. Jürgen kroch voraus, ich folgte ihm, die Nase an seinen Schuhsohlen. Das Licht der Kerzen erhellte den roten Boden, die mit nassem Moos bewachsenen Wände und eine von Meißelschlägen schartige Decke, aus der Wurzelfäden hingen wie Indianerhaare. Plötzlich begann Jürgen zu keuchen. „Was’n los?“, fragte ich. – „Asthma!“, kam die gepresste Antwort. Und kurz darauf ergänzte er: „Ich steck fest!“ Sein Atem rasselte eine Weile blechern und nach einem heftigen Zucken der Füße fuhr er fort: „Ich krieg kaum Luft!“ – „Dann nimm halt dein Zeugs!“, sagte ich. – „Würd ich ja, aber das ist in meinem Ranzen.“ – „Scheißdreck!“, entfuhr es mir, denn der lag zu Hause auf meinem Bett. Rasch schmiedeten wir einen Plan: Ich musste nach Hause rennen, mit dem Inhalator zurückkommen, dann würde Jürgen sofort zwei Sprühstöße nehmen und käme danach sicherlich wieder frei. „Wenn ich wieder atmen kann, ist alles in Ordnung“, japste er. Also kroch ich rückwärts aus der Röhre, verließ die Höhle, klopfte den roten Sand von meinen Kleidern und rannte durch den Wald nach Hause. Dort angekommen, zog ich im Flur die Schuhe aus und wollte gerade in mein Zimmer schleichen, doch wir hatten Besuch. „Schau mal, wer da ist!“, sagte Vater und ich musste ins Wohnzimmer und Tante Almut und Onkel Heiner die Hand geben. Mutter stellte einen frischen Teller auf den Tisch und verkündete: „Tante Almut hat Erdbeerkuchen mitgebracht!“ Und da jeder wusste, wie sehr ich Tante Almuts Erdbeerkuchen mochte, blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu den Erwachsenen zu setzen und ein Stück Kuchen zu essen. „Bist du krank?“, fragte Tante Almut. „Normalerweise isst du doch mindestens zwei! Und wieso ohne Sahne?“ Und schon hatte ich das zweite Stück auf dem Teller, dann das dritte. „Lernst du auch fleißig?“, fragte Onkel Heiner, kaum dass ich das dritte Stück Erdbeerkuchen aufgegessen hatte, und fing damit an, mich über die Schule auszuhorchen. Ob das Fräulein streng sei. Ob es nette Mädchen in meiner Klasse gebe. Wie viel denn sieben mal neun machten und, er lachte verschwörerisch, ob ein Kamel ein oder zwei Höcker habe. Auf einmal stand Vater, der kurz den Raum verlassen hatte, in der Wohnzimmertür und sah mich streng an. „Du warst in der Höhle!“ – „Nein“, log ich, aber da hielt er meine Schuhe hoch, die rot vom Sand waren, und brüllte: „Ins Bett! Sofort ab ins Bett! Ohne Nachtessen!“ Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, denn rot waren die Schuhe, die er hielt, rot vom Sand der Schlangenhöhle. Also ging ich zu Bett. Erst weinte ich, dann las ich ein wenig. Irgendwann schlief ich ein. Am nächsten Tag war Sonntag und wir machten einen Ausflug in den Deutsch-Französischen Garten. Wir fuhren mit der Seilbahn. Wir fuhren Tretboot. Ich aß Spaghettieis und meine Eltern tranken Kaffee aus winzig kleinen Tassen. Abends schob ich Jürgens Ranzen unters Bett. Montags kam er nicht zur Schule und der Platz neben mir blieb frei. Natürlich wurden mir Fragen gestellt. An diesem Tag und an den Tagen danach, aber ich behauptete stets stur und steif, wir hätten im Wald „Cowboy und Indianer“ gespielt, Jürgen habe dann schlimme Probleme mit seinem Asthma gehabt und sei nach Hause gegangen. Einige Tage später vergrub ich seinen Ranzen an der Brombeerhecke bei den Bahngleisen. Ich war nie wieder in der Schlangenhöhle. Und heute? Heute trinke ich selbst Kaffee aus winzig kleinen Tassen, kenne keine Eisdiele, die noch Spaghettieis anbietet, und weiß mit Sicherheit nur dies: Einen besseren Erdbeerkuchen als den von Tante Almut habe ich nie wieder gegessen. Aber es war ja auch Sommer und die Erdbeeren waren frisch aus ihrem Garten.