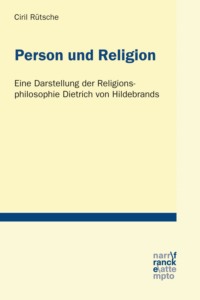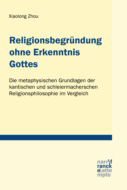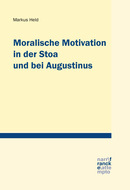Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 13
4.6 Was spricht eigentlich dafür, dass die WerteWerte in GottGott gründen, ja brauchen die Werte überhaupt einen SeinsgrundSeinsgrund? – Einige Gedanken zum werttheoretischen GottesbeweisGottesbeweis
Wenngleich von HildebrandHildebrandDietrich von GottGott als „die GüteGüte, die WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit, die GerechtigkeitGerechtigkeit, die LiebeLiebe“1 bezeichnet und er Gott sogar als „Inbegriff aller WerteWerte, vor allem der Gerechtigkeit, Liebe und HeiligkeitHeiligkeit“2 versteht, wo liegen die Wurzeln dieser Begriffe? „Begriffe sind an sich ‚Medien‘, durch die unser GeistGeist auf das Seiende sinnvoll abzielt.“3 Was im vorliegenden Zusammenhang besagen will, dass die oben genannten Begriffe – der Güte Gottes, seiner Gerechtigkeit, seiner unendlichen Liebe usw. – meinend auf das Sein Gottes abzielen. Doch welche Argumente sprechen eigentlich dafür, dass sich das Vermeinte auch in WirklichkeitWirklichkeit so verhält, dass v.a. die moralischen Werte in Gott ihr letztes Fundament und ihre letzte Wurzel haben? Und damit verbunden, warum benötigen diese in sich bedeutsamen Entitäten überhaupt einen SeinsgrundSeinsgrund? Oder anderes gefragt: Sind die Werte nicht in sich selbst stehende, autonome Wirklichkeiten?
Diese Fragen seien in der Folge zu beantworten gesucht. Ein erstes ArgumentArgument stammt von von HildebrandHildebrandDietrich von und hebt an beim Sehen der SchönheitSchönheit einer Landschaft, z.B. der italienischen. Dabei „erfassen wir, dass die Schönheit in ihrer letzten SubstanzSubstanz eins ist mit der Substanz der LiebeLiebe, dass sie gleichsam eine objektivierte Liebe in etwas ‚Apersonalem‘ ist“4. Mit Max SchelerSchelerMax gesprochen, kann hier natürlich nichts definiert werden, „wie bei allen letzten Wertphänomenen. Wir können hier nur auffordern, genau hinzusehen“5. In diesem Sinne spricht auch von HildebrandHildebrandDietrich von weder von einem ErkennenErkennen noch von einem Definieren, sondern von einem dem Objekt angemessenen AhnenAhnen: „Dieser Zusammenhang von Wert und Liebe lässt uns ahnen, dass GottGott der Inbegriff der Liebe ist, da er der wesenhaft Vollkommene ist, der personale Inbegriff, die Inkarnierung aller WerteWerte, und darum auch die Liebe.“6
Dass die moralischen WerteWerte ihren SeinsgrundSeinsgrund in der vollkommenen PersonPerson Gottes haben, dafür sprechen zuallererst die moralischen Aktemoralischen Akte selbst. Bekanntlich setzen diese Akte die FreiheitFreiheit voraus, die selbst wiederum wesenhaft die VerantwortungVerantwortung impliziert. Die Verantwortung besteht im Letzten aber nicht gegenüber einem Menschen, denn dieser weiss – aufgrund seiner Unvollkommenheit und KontingenzKontingenz – nicht um das Mass und die Grenzen unserer Freiheit. Auch kennt er die letzten Gründe unseres Handelns und die innersten freien Entscheidungen nicht. Kein anderer MenschMensch kommt als letzter Adressat in Frage, vor dem wir Verantwortung tragen. Notwendigerweise wird von da her ein Adressat des Phänomens der sittlichen Verantwortung gefordert, der um die innersten Beweggründe eines jeden Menschen weiss. GottGott wird hier als absoluter Bezugspunkt und personales Korrelat der sittlichen Verantwortung gegenüber der tiefsten göttlichen Verkörperung des sittlich Guten erkannt. Ausgehend von der eindeutig gegebenen phänomenalen Basis der freien sittlichen Akte und der notwendigerweise geforderten personalen Instanz, vor der wir Verantwortung tragen, wird Gottes WirklichkeitWirklichkeit erkannt.7
Wie alleine schon aufgrund der sittlichen VerantwortungVerantwortung erhellt, haben die moralischen WerteWerte in GottGott mit GewissheitGewissheit ihr letztes Fundament. An dieser Stelle noch weiter nach einem Fundament des „Wertes, dieses tiefsten Urphänomens“8 zu fragen, erinnert an GoetheGoetheJohann Wolfgang von, der die Menschen, denen „der Anblick eines Urphänomens gewöhnlich nicht genug“ ist und denken, „es müsse noch weiter gehen,“ mit den Kindern vergleicht, „die, wenn sie in einen Spiegel geguckt, ihn sogleich umwenden, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist“.9 Nichtsdestotrotz seien in der Folge einige weitere Argumente beigebracht, die dafür sprechen, dass die moralischen Werte keinen absoluten Selbststand, sondern den Grund ihres Seins in Gott haben. Als erstes das Wesensgesetz, das auch von HildebrandHildebrandDietrich von erkannt hat und von da her auf diesen Seiten wiederholt zur Sprache kommt, nämlich der notwendige SachverhaltSachverhalt, dass moralische Werte bzw. Unwerte mit Lohn und StrafeLohn und Strafe verknüpft sind.10 Diese Gesetzmässigkeit verbürgt Gottes WirklichkeitWirklichkeit aus der ewigen GerechtigkeitGerechtigkeit, denn unmöglich kann etwas nicht sein, das vom WesenWesen der Gerechtigkeit gefordert und vorausgesetzt wird. Ein weiteres ArgumentArgument hebt an bei der Stimme des GewissensStimme des Gewissens und mündet in die EinsichtEinsicht der inneren Präsenz Gottes in der SeeleSeele. Da dieses Argument weiter unten entfaltet werden wird, sei an dieser Stelle darauf verwiesen.11
Ein anderes ArgumentArgument wird hier zum ersten Mal explizit entfaltet, nämlich das Argument der inneren wesenhaften EinheitEinheit des Moralischen, die nur in GottGott ihre letzte Erfüllung findet. Dieses Argument ist eng mit der inneren Einheit aller moralischen WerteWerte verbunden, die zu verwirklichen vom Menschen als Menschen verlangt ist. Dazu die einschlägige Stelle aus von Hildebrands ethischem Hauptwerk:
Es erscheint ganz natürlich, dass ein MenschMensch nicht jede einzelne intellektuelle Begabung besitzen kann; aber jeder sollte alle sittlichen WerteWerte besitzen. Es ist ganz vernünftig, wenn jemand erklärt: „Ich bin ein Musiker, aber ich habe nicht das geringste philosophische Talent“; oder „Mein Hauptgebiet ist NaturwissenschaftNaturwissenschaft, und die Kunst überlasse ich anderen, die dafür eine Begabung haben“. Aber es wäre ebenso absurdabsurd wie lächerlich, wollte jemand sagen: „Ich beschäftige mich vor allem mit GerechtigkeitGerechtigkeit; die Reinheit ist Sache meiner Kollegen.“ Die Verteilung der Werte auf verschiedene Menschen, die für alle anderen Personwerte ganz natürlich ist, gilt nicht für die sittliche Sphäre. Hier werden alle sittlichen Werte von jedem gefordert, weil er ein Mensch ist.12
Doch welcher Weg führt die VernunftVernunft von der vom Menschen geforderten EinheitEinheit der sittlichen WerteWerte nun zur Einheit dieser Werte in GottGott? Warum kann von HildebrandHildebrandDietrich von Gott mit Bestimmtheit als „die GüteGüte, die WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit, die GerechtigkeitGerechtigkeit, die LiebeLiebe“13 bezeichnen? In Bezug auf das soeben angeführte HildebrandHildebrandDietrich von-Zitat, weil es sich bei den sittlichen Werten, die zu verwirklichen von jedem Menschen gefordert sind, weil er ein MenschMensch ist, um gemischte Vollkommenheiten handelt, währenddem es sich in ihrer göttlichen FormForm um reine Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten handelt. Wie bereits erwähnt,14 lassen die göttlichen Vollkommenheiten nicht nur die unendliche Form zu, sondern weisen überdies die Eigenschaft auf, dass sie gegenseitig verträglich sind, alle gleichzeitig besessen bzw. realisiert werden können und keine dieser Eigenschaften wahrhaft sie selber ist ohne all die anderen. In analoger Weise kam dies auch in dem soeben angeführten HildebrandHildebrandDietrich von-Zitat betreffend der von jedem Menschen geforderten Einheit aller sittlichen Werte zum Ausdruck. Die moralischen Werte der Güte, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Liebe usw. setzen ihrem WesenWesen nach – sei es als gemischte oder als reine VollkommenheitVollkommenheit – notwendigerweise einen personalen Träger voraus. Und dieser Träger kann im Falle einer unendlichen qualitativen Eigenschaft keine menschliche, sondern einzig die absolut vollkommene PersonPerson Gottes sein.
Und gerade so, wie die sittlichen oder moralischen WerteWerte vom Menschen als solchem gefordert sind, so sind die personalen, allen voran die moralischen Werte die raison d’être des Seins überhaupt und enthüllen damit letztlich den Grund der göttlichen ExistenzExistenz. Und wenn Gottes Wertvollkommenheit auch in der unendlichen sittlichen VollkommenheitVollkommenheit kulminiert, so kann sie auf diese dennoch nicht eingeschränkt werden.15 Die angeführten Argumente vermögen zu zeigen, dass die Werte in GottGott gründen, was v.a. an den moralischen Werten aufgewiesen werden konnte. Brauchen die Werte aber überhaupt einen SeinsgrundSeinsgrund, war eine weitere Frage, die eingangs dieses Kapitels gestellt wurde. Ja, sie brauchen ihn notwendigerweise. Und zwar nicht alleine deswegen, damit die WirklichkeitWirklichkeit eine intelligible Struktur hat, sondern auch deswegen, weil der MenschMensch den existentiellen SinnSinn und das GlückGlück in seinem Leben nur über die Verwirklichung der von ihm geforderten moralischen Werte finden kann. Vor allem aber beantworten die Werte qua in sich ruhende Bedeutsamkeiten die von LeibnizLeibnizGottfried Wilhelm oder SchelerSchelerMax gestellte metaphysische Grundfrage, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts.16
Nebstdem führt auch vom Phänomen des absoluten moralischen Sollens ein denkerischer Weg zu GottGott. Diese Forderungen gehen über das hinaus, was der MenschMensch prinzipiell verwirklichen kann. Es sind im Letzten rein objektive Forderungen nach der höchsten WirklichkeitWirklichkeit des Guten, deren Verwirklichung aber nur in Gott selber liegen kann. Denn da dem Menschen die vollkommene Erfüllung der geforderten moralischen HeiligkeitHeiligkeit unmöglich ist, verlangt die moralische SollensforderungSollensforderung im Tiefsten nicht nur, dass die Menschen gut handeln und das BöseBösedas meiden sollen, sondern auch, dass das absolute GuteGutedas verwirklicht ist. Das aber kann nur in Gott vollste Wirklichkeit sein. Auch mit diesem ArgumentArgument, das vom Gesolltsein der moralischen WerteWerte ausgeht und eine Verwirklichung des Guten verlangt, wie sie kein Mensch erfüllen kann, stösst man auf den Grund und die Wurzeln der moralischen Welt in ihrer objektiven Gültigkeitobjektive Gültigkeit.
Nicht zuletzt kann der werttheoretische GottesbeweisGottesbeweis auch über die postulierte Nichtexistenz Gottes geführt werden. Denn wenn GottGott nicht existierte, wäre das Moralische seines höchsten Gegenstands beraubt und alle diesbezüglichen Akte, insbesondere die GottesliebeGottesliebe, würden, „da Gott nur entweder notwendig existiert oder in sich unmöglich ist, auf einer widersprüchlichen Idee beruhen“17. Das intelligible WesenWesen des Moralischen enthielte dann „einen inneren WiderspruchWiderspruch, was nicht sein kann“18.
5 Die Probe aufs Exempel: Prüfung der (Un-)Vernünftigkeit dreier moderner bzw. postmoderner Kritiken an der ReligionReligion
5.1 Der MenschMensch als SeinsgrundSeinsgrund Gottes in Ludwig Feuerbachs anthropologischer Theologie
Nach dem Aufweis der Vernünftigkeit der religiösen Grundüberzeugung, dass GottGott existiert, sei in der Folge zugesehen, wie es um das Gegenstück, nämlich um die Kritik religiöser Überzeugungen bestellt ist. Wohl wurde in groben Zügen schon auf die Kritik des XenophanesXenophanes an den anthropomorphen Göttervorstellungen der alten Mythen hingewiesen. Zu den Aufgaben der ReligionsphilosophieReligionsphilosophie gehört jedoch nicht nur die Kritik religiöser Überzeugungen, zu ihren Aufgaben gehört auch die Kritik an der Kritik religiöser Überzeugungen. Dieser Aufgabe seien die folgenden Seiten gewidmet, auf denen die ReligionskritikReligionskritik Ludwig Feuerbachs (1804–1872) kritisch untersucht wird. Vor dem Hintergrund des bereits Erarbeiteten wird dabei die kritische Frage zu beantworten gesucht, ob sein Vorwurf der Unvernünftigkeit der ReligionReligion haltbar ist, und wenn nicht, warum nicht.
Mit Ludwig FeuerbachFeuerbachLudwig begegnet ein Philosoph, dem nachgesagt wird, dass er die „gnoseologischen Wurzeln der ReligionReligion“1 entschlüsselt habe. Mit dem WortWort von den gnoseologischen, also den erkenntnismässigen Wurzeln ist Feuerbachs philosophisches Rüstzeug schon deutlich benannt: Was sich bei KantKantImmanuel auf die ErkenntnistheorieErkenntnistheorie erstreckte, nämlich das skeptisch-agnostische Nicht-erkennen-Können der objektiven WahrheitWahrheit, das übertrug Ludwig Feuerbach in analoger Weise auf die ReligionsphilosophieReligionsphilosophie. Bereits in seiner – 1830 anonym erschienenen – Erstlingsschrift Gedanken über TodTod und UnsterblichkeitUnsterblichkeit lehnte er den Glauben an einen persönlichen GottGott entschieden ab. Dieser GlaubeGlaube, so in seinem religionskritischen Hauptwerk die Leitlinie seines Denkens markierend, „ist nichts andres als der Glaube an die Gottheit des Menschen“2, denn „was der MenschMensch von Gott aussagt, das sagt er in Wahrheit von sich selbst aus“3. Aus diesen Worten lässt sich in etwa ermessen, inwiefern Feuerbachs Vorstoss „in der neueren Geschichte der Philosophie und WissenschaftWissenschaft die radikalste Absage an das Christentum und die sie rechtfertigende Theologie und Philosophie“4 darstellt.
5.1.1 Feuerbachs Thesen
Wer aufgrund des Titels der Feuerbachschen Hauptschrift Das WesenWesen des Christentums auf eine Analysierung und VerifizierungVerifizierung des Christentums selbst oder auf eine gegen aussen gerichtete Verteidigung schliessen zu können meint, wird überrascht sein, die Behauptung zu vernehmen: „Die ReligionReligion ist die Entzweiung des Menschen mit sich selbst“1. Denn: „Der MenschMensch – dies ist das Geheimnis der Religion – vergegenständlicht sein Wesen und macht dann wieder sich zum Gegenstand dieses vergegenständlichten, in ein SubjektSubjekt, eine PersonPerson verwandelten Wesens“2. Mit anderen Worten: „Die Religion ist das Verhalten des Menschen zu seinem eignen Wesen […], aber zu seinem Wesen nicht als dem seinigen, sondern als einem andern, von ihm unterschiednen, ja entgegengesetzten Wesen“3. Was FeuerbachFeuerbachLudwig in die prägnante Formel fasst: „der GottGott des Menschen ist sein eignes Wesen“4. Das aber heisst: „Gott ist nichts an sich selber.“5 „Ob er ist oder nicht ist – es ist einerlei; wir gewinnen nichts durch sein Sein und verlieren nichts durch sein Nichtsein; denn wir haben an Gott nur eine Wiederholung von uns selbst.“6 Darum ist auch „die ErkenntnisErkenntnis Gottes die Selbsterkenntnis des Menschen“7. Ja, „das WissenWissen des Menschen von Gott ist das Wissen des Menschen von sich, von seinem eignen Wesen.“8 Und wie „der GlaubeGlaube, dass überhaupt ein Gott ist, ein AnthropomorphismusAnthropomorphismus“ ist, so sind auch die Prädikate, die Gott zugeschrieben werden, blosse „AnthropomorphismenAnthropomorphismen, d.h. menschliche Vorstellungen“.9 „Wie ich bin, so ist mein Glaube, und wie mein Glaube, so mein Gott.“10 Kurzum: „Dass Gott ein andres Wesen ist, das ist nur ScheinSchein, nur Einbildung.“11 Da also „zwischen dem göttlichen und menschlichen Subjekt oder Wesen kein Unterschied ist“, ist „der wahre SinnSinn der Theologie die AnthropologieAnthropologie“.12
Bei der Verneinung der ExistenzExistenz Gottes macht sich der skeptische Einfluss Kants bemerkbar, für den, wie weiter oben gesehen, das ErkennenErkennen der Existenz Gottes unmöglich ist, zumindest das unmittelbare. Und obgleich FeuerbachFeuerbachLudwig eine gewisse Sympathie für den ontologischen Gottesbeweisontologischer Gottesbeweis bekundet – er nennt ihn den interessantesten BeweisBeweis, „weil er von innen ausgeht“13 –, hält er ihn trotzdem nicht für gültig. Nichtsdestotrotz übernimmt er Kants Kritik nicht vorbehaltlos, sondern unterzieht auch ihn selbst einer Kritik:
KantKantImmanuel hat bekanntlich in seiner Kritik der Beweise vom Dasein Gottes behauptet, dass sich das Dasein Gottes nicht aus der VernunftVernunft beweisen lasse. KantKantImmanuel verdiente deswegen nicht den Tadel, welchen er von Hegel erfuhr. KantKantImmanuel hat vielmehr vollkommen recht: aus einem Begriffe kann ich nicht die ExistenzExistenz ableiten. Nur insofern verdient er Tadel, als er damit etwas Besonderes aussagen und der Vernunft gleichsam einen Vorwurf machen wollte. Es versteht sich dies von selbst. Die Vernunft kann nicht ein Objekt von sich zum Objekt der Sinne machen. Ich kann nicht im Denken das, was ich denke, zugleich ausser mir als ein sinnliches Ding darstellen.14
Über die anthropologische Theologie bzw. die IdentitätIdentität von MenschMensch und GottGott hinaus tritt hier die Feuerbachsche ErkenntnistheorieErkenntnistheorie ans Licht.
5.1.2 Feuerbachs erkenntnistheoretische Prinzipien
„Nur durch die Sinne wird ein Gegenstand im wahren SinnSinn gegeben – nicht durch das Denken für sich selbst.“1 „Ein Objekt, ein wirkliches Objekt, wird mir nämlich nur da gegeben, wo mir ein auf mich wirkendes WesenWesen gegeben wird, wo meine Selbsttätigkeit […] an der Tätigkeit eines andern Wesens ihre Grenze – Widerstand findet.“2 Wobei nicht nur Äusserliches Gegenstand der Sinne ist, „nicht nur Fleisch, auch GeistGeist, nicht nur das Ding, auch das Ich ist Gegenstand der Sinne. – Alles ist darum sinnlich wahrnehmbar“3. Die GewissheitGewissheit betreffend behauptet FeuerbachFeuerbachLudwig: „Unbezweifelbar, unmittelbar gewiss ist nur, was Objekt des Sinns, der Anschauung, der Empfindung ist.“4 Ja, „sonnenklar ist nur das Sinnliche; nur wo die Sinnlichkeit anfängt, hört aller ZweifelZweifel und Streit auf. Das Geheimnis des unmittelbaren Wissens ist die Sinnlichkeit.“5 „WahrheitWahrheit, WirklichkeitWirklichkeit, Sinnlichkeit sind identisch.“6 Und die objektive Wahrheitobjektive Wahrheit? „Nur das durch die sinnliche Anschauung sich bestimmende und rektifizierende Denken ist reales, objektives Denken – Denken objektiver Wahrheit.“7 Diese DefinitionDefinition verweist wieder auf KantKantImmanuel, der auch schon dafür hielt, wie bereits erwähnt, dass die sinnlichen Anschauungen und die Begriffe die Elemente einer jeden ErkenntnisErkenntnis ausmachen.8
Nicht auf KantKantImmanuel jedoch kann Feuerbachs erkenntnistheoretischer SensualismusSensualismus zurückgeführt werden. Dieser hat seine Wurzeln vielmehr in John Lockes Versuch über den menschlichen VerstandVerstand (1690).9 Was immer im menschlichen Verstande ist, so die zentrale Aussage dieser Schrift, war zuvor in den Sinnen. LockeLockeJohn unterscheidet zwischen der Sinnesempfindung (sensation) und der Wahrnehmung der Sinnesempfindung (reflection), wobei die reflection die sensation voraussetzt. Von da her lässt sich ermessen, wie er seine Aussage verstanden wissen will, dass alles, was im menschlichen Verstande ist, zuvor in den Sinnen war.10
Lockes Lehre entwickelt Étienne Bonnot de CondillacCondillacÉtienne Bonnot de in seiner Abhandlung über die Empfindungen (1754) zu einem reinen SensualismusSensualismus weiter. Wie schon für LockeLockeJohn, so steht auch für CondillacCondillacÉtienne Bonnot de fest, „dass alle unsere Erkenntnisse aus den Sinnen stammen“11. Er hebt sich von LockeLockeJohn jedoch insofern ab, als er den eben zitierten SatzSatz für mangelhaft erklärt. Denn „wenn ich nicht weiss, wie sie daraus stammen, so werde ich glauben, dass wir sogleich alle Vorstellungen, die unsere Empfindungen in sich schliessen können, haben, wenn die Dinge Eindrücke auf uns machen, und werde irre gehen“12. Zwar verficht er mit LockeLockeJohn die Auffassung, dass der kognitive Prozess ausschliesslich bei den Empfindungen anhebt und die „Empfindungen die Quelle [aller] Kenntnisse“ sind, doch geht er über LockeLockeJohn insofern hinaus, als er die reflection verwirft und auf der alleinigen Basis der sensation „die Erinnerung an ihre vergangenen Empfindungen [als] ihren gesamten Inhalt“, ja als den „Inhalt aller unserer Erkenntnisse“ versteht.13 Und wie aus der Empfindung eines einzelnen Dinges eine Einzelvorstellung wird, so ist „ein Schema, das zu mehreren Einzeldingen passt, eine allgemeine Vorstellung“14. Ein WesenWesen oder eine SubstanzSubstanz aber gibt es für CondillacCondillacÉtienne Bonnot de nicht, empfunden werde immer nur je Dieses.15 Wenn nun „alle unsere Erkenntnisse aus den Sinnen“16 stammen, GottGott aber mittels der Sinne nicht empfunden werden kann, kann das Da- und SoseinSosein Gottes folglich auch nicht erkannt werden. Um in seinem System allerdings nicht ein Loch zu gewärtigen, spricht er – mit den DeistenDeisten seiner Zeit – vom „Weltschöpfer“17, welcher unverkennbare Züge einer schöpferischen NaturNatur (natura naturans) aufweist.18