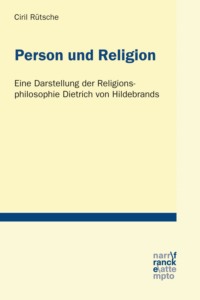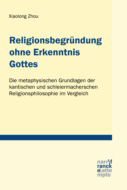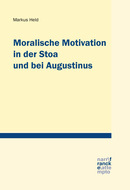Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 15
5.1.5.2 Die göttlichen Prädikate als menschliche Vergegenständlichung?
Vor diesem Hintergrund zeichnen sich die Eigenheiten des Feuerbachschen Denkens deutlich ab, was die Entfaltung einer Stelle aus dem WesenWesen des Christentums nur bestätigt:
Ein wahrer Atheist, d.h. ein Atheist im gewöhnlichen Sinne, ist daher auch nur der, welchem die Prädikate des göttlichen Wesens, wie z.B. die LiebeLiebe, die WeisheitWeisheit, die GerechtigkeitGerechtigkeit Nichts sind, aber nicht der, welchem nur das SubjektSubjekt dieser Prädikate Nichts ist. Und keineswegs ist die Verneinung des Subjekts auch notwendig zugleich die Verneinung der Prädikate an sich selbst. Die Prädikate haben eine eigene, selbständige Bedeutung; sie dringen durch ihren Inhalt dem Menschen ihre Anerkennung auf; sie erweisen sich ihm unmittelbar durch sich selbst als wahr; sie bestätigen, bezeugen sich selbst. GüteGüte, Gerechtigkeit, Weisheit sind dadurch keine Chimären, dass die ExistenzExistenz Gottes eine Chimäre, noch dadurch Wahrheiten, dass diese eine WahrheitWahrheit ist.1
FeuerbachFeuerbachLudwig trennt die göttlichen Prädikate hier vom göttlichen WesenWesen, und während er dieses zu einer Chimäre erklärt, spricht er jenen „eine eigene, selbständige Bedeutung“ zu.2 Inwiefern aber kommt GüteGüte, GerechtigkeitGerechtigkeit, WeisheitWeisheit, LiebeLiebe eine selbständige Bedeutung zu und aus welchem Grund erweisen sie sich unmittelbar durch sich selbst als wahr? Die AntwortAntworttheoretische auf diese Frage ist seinem sensualistischen Prinzip zu entnehmen: „WahrheitWahrheit, WirklichkeitWirklichkeit, Sinnlichkeit sind identisch.“3 Daraus folgt nichts anderes, als dass den geistigen Haltungen (Gerechtigkeit usw.) darum eine selbständige Bedeutung zukommt und sie sich darum unmittelbar durch sich selbst als wahr erweisen, weil sie sinnlich wahrgenommen werden. Bekanntlich ist dem Sensualisten Feuerbach ja ausnahmslos alles ein Gegenstand der Sinne.4 Und ob eine gegebene Sinneswahrnehmung mit der Wirklichkeit übereinstimmt, entscheidet sich für ihn im Zweifelsfalle am intersubjektiven KonsensKonsens5; eine Lehre, die sich von der oben dargelegten grundsätzlich unterscheidet. Während das GewissheitskriteriumGewissheitskriterium bei dieser die evidente ErkenntnisErkenntnis selbst ist und es keiner ausserhalb ihrer selbst gelegenen BegründungBegründung bedarf,6 bleibt die Wahrheit bei jener – wie bereits gesagt – beeinfluss- und manipulierbar.
Von da her ist die GerechtigkeitGerechtigkeit, um nur eines der oben genannten „Prädikate des göttlichen Wesens“7 zu verwenden, so zu verstehen, dass die Mehrheit der Menschen sich explizit oder implizit darauf geeinigt hat, „jedem das Seine zu geben“ zu einem Sollensgebot zu erklären. Warum aber wird die Gerechtigkeit mehrheitlich so begriffen, dass es besser ist, gerecht zu sein, als es nicht zu sein? In sachlicher Hinsicht wird man nicht fehl gehen, FeuerbachFeuerbachLudwig ein WortWort John Stuart Mills (1806–1873) in den Mund zu legen, der in seiner Schrift Utilitarianism – 1. Aufl. 18618, also noch zu Lebzeiten Feuerbachs – das grösstmögliche GlückGlück zum ZielZiel und ZweckZweck menschlichen Handelns erklärt hat. Dabei sind die erstrebenswerten Dinge wegen der inhärenten LustLust oder als Mittel zur Förderung von Lust bzw. zur Vermeidung von Unlust erstrebenswert. Und wie für Feuerbach, so bedarf die VerifizierungVerifizierung auch für MillMillJohn Stuart des Konsenses; freilich nicht mit unbestimmten Personen, sondern mit den Erfahrenen. Jedenfalls hat auch MillMillJohn Stuart keinen erkenntnismässigen Zugang zu den Sachen selbst, auch seine GewissheitGewissheit ist abhängig vom UrteilUrteil anderer.
Doch zurück zu FeuerbachFeuerbachLudwig. Nach ihm ist das SubjektSubjekt der göttlichen Prädikate eine menschliche Vergegenständlichung. Das heisst, der MenschMensch stellt in sich gewisse Eigenschaften fest, die er als positivwertig beurteilt und in vervollkommneter FormForm dem göttlichen WesenWesen zuschreibt. Was er deswegen tut, weil alleine das göttliche Wesen den menschlichen Wunsch nach Seligkeit zu befriedigen vermag.9 Insofern ist der GlaubeGlaube an GottGott aber „nichts anderes als das Wesen der SelbstliebeSelbstliebe“10. Wie immer diese BegründungBegründung beurteilt werden mag, entscheidend ist die Übereinstimmung mit der WirklichkeitWirklichkeit. Und gerade das ist die Frage: Ist das göttliche Wesen tatsächlich „das SelbstbewusstseinSelbstbewusstsein des Verstandes, das BewusstseinBewusstsein des Verstandes von seiner eigenen VollkommenheitVollkommenheit“11? Ja, zieht Feuerbach die angemessene SchlussfolgerungSchlussfolgerung aus der folgenden Tatsache: „Gott ist nicht, was der Mensch ist – der Mensch nicht, was Gott ist. Gott ist das unendliche, der Mensch das endliche Wesen; Gott vollkommen, der Mensch unvollkommen; Gott ewig, der Mensch zeitlich; Gott allmächtig, der Mensch ohnmächtig; Gott heilig, der Mensch sündhaft“12? Feuerbachs Intention jedenfalls ist unter Berücksichtigung seiner weiter oben genannten Thesen klar zu erkennen. Er behauptet, die göttlichen Eigenschaften seien die zu unendlicher Perfektion gesteigerten menschlichen Eigenschaften.
Doch, ermöglichen die menschlichen Eigenschaften denn überhaupt eine SteigerungSteigerung ins Unendliche? Und vor allem, können die göttlichen Eigenschaften überhaupt Steigerungsformen sein? Wenngleich die ethische Qualität der Sündhaftigkeit zweifelsohne Raum bietet für eine axiologische Verbesserung, ebenso wie der menschliche VerstandVerstand für eine Steigerung der Intelligenz, so sind UnendlichkeitUnendlichkeit, VollkommenheitVollkommenheit, EwigkeitEwigkeit oder AllmachtAllmacht weder steigerungsfähig noch können sie das Ergebnis einer Steigerung sein. Und zwar deswegen nicht, weil sie sich in der Welt nicht finden, sondern etwas schlechthin Neues sind. So etwa ist unter der göttlichen Eigenschaft der Ewigkeit nicht eine bloss potentielle Ewigkeit zu verstehen, d.h. ein beständiges Übergehen vom Noch-nicht-Sein zum Sein, welches im Übrigen ein metaphysisches Prinzip ausser seiner selbst bedingt, sondern ein absolutes Freisein von jedem Seinszuwachs und Seinsverlust. Was immer jedoch in der Welt begegnet, unterliegt diesem Übergang. Folglich kann die Ewigkeit aus ihr nicht abgeleitet sein. Vielmehr kann das Zeitliche nur aufgrund der Kenntnis des intelligiblen und notwendigen Wesens der Ewigkeit als Zeitliches überhaupt erst erkannt werden, wie schon BonaventuraBonaventura gezeigt hat.13 Ebenso wie mit der Ewigkeit verhält es sich mit der Unendlichkeit, der Allmacht und der Vollkommenheit.
5.1.5.3 Die einzigen Momente eines adäquaten Gottesbegriffs
Bei den göttlichen Eigenschaften kann es sich nicht um anthropomorphe Vorstellungen handeln. Und das nicht alleine deswegen, weil die göttlichen Eigenschaften unerfindbar-notwendig sind, sondern auch deswegen, weil sie aus der defizitären Welt nicht abgeleitet werden können. Womit der Grund gelegt ist, um dem von FeuerbachFeuerbachLudwig abgelehnten ontologischen Gottesbeweisontologischer Gottesbeweis – id quo maius nihil cogitari possit – wieder in sein Recht zu verhelfen. Feuerbach hat ja behauptet, dass die Ineinssetzung von Gottes ExistenzExistenz und WesenWesen nur ein vom Wesen des menschlichen Verstandes abgezogener BegriffBegriff sei.1 Was er deswegen behauptet hat, „weil nur die Existenz der VernunftVernunft Vernunft ist; weil, wenn keine Vernunft, kein BewusstseinBewusstsein wäre, alles nichts, das Sein gleich Nichtsein wäre“2. Die Gebrechlichkeit dieses Arguments liegt offen zutage, denn einerseits kann die notwendige reale Existenz ebensowenig wie die EwigkeitEwigkeit aus dem Bereich des Endlichen abgeleitet werden, andererseits hat er den Kern des ontologischen Arguments damit gerade nicht erfasst. Das ontologische ArgumentArgument zielt auf die EinsichtEinsicht, dass GottGott aufgrund seiner unendlichen personalen und sittlichen VollkommenheitVollkommenheit notwendigerweise existiert, ja nur als Existierender vollkommen ist. Dagegen ist es evident, dass die menschliche Vernunft nicht notwendigerweise existieren muss; verwiesen sei nur auf einen Tyrannen, der mithilfe seiner Vernunft vieles getan hat, was er besser nicht getan hätte, sodass es für die Betroffenen eine Erleichterung sein wird, wenn sie Kenntnis von seinem TodTod erhalten.
FeuerbachFeuerbachLudwig, der der ErkenntnisErkenntnis des Sachverhalts der notwendigen ExistenzExistenz des vollkommenen Wesens nahe stand, sie aber aus Gründen, die weiter unten noch zu beleuchten sind, nicht erlangt hatte, hätte nicht bestreiten können, dass EwigkeitEwigkeit, UnendlichkeitUnendlichkeit und AllmachtAllmacht – um seine oben genannten Eigenschaften wieder aufzunehmen –, werden sie als Prädikate des göttlichen Wesens gedacht, sich gegenseitig nicht ausschliessen, sondern gegenseitig verträglich sind.3 Das wird durch die Eigenschaft der VollkommenheitVollkommenheit nur bestätigt. Ewigkeit, Unendlichkeit, Allmacht und Vollkommenheit grenzen sich gegenseitig nicht aus, vielmehr weisen sie eine gegenseitige Harmonie und Verträglichkeit auf, die solcherart ist, dass sie erst in der EinheitEinheit mit allen anderen im vollen Masse sie selber sind. Mit einem Beispiel: Ewigkeit ohne Unendlichkeit ist keine Ewigkeit. Hierein fügen sich auch die von Feuerbach angeführten Eigenschaften der GerechtigkeitGerechtigkeit, der LiebeLiebe, der WeisheitWeisheit oder der GüteGüte. Auch sie sind mit der Unendlichkeit, der Ewigkeit usw. verträglich, ja sind erst in der Einheit mit allen anderen wahrhaft sie selber. Und ist irgendeine Eigenschaft mit einer anderen nicht verträglich, so handelt es sich bei der einen oder der anderen oder vielleicht auch bei beiden mit Sicherheit nicht um Attribute des vollkommenen Wesens.
Die von FeuerbachFeuerbachLudwig angeführten Eigenschaften sind jedoch nicht nur gegenseitig verträglich, Feuerbach, der über nicht gering zu schätzende philosophisch-theologische Kenntnisse verfügte, wollte sie bestimmt auch in dem Sinne verstanden wissen, in dem AnselmAnselmvon Canterbury von Canterbury die göttlichen Eigenschaften verstanden hat, nämlich, dass sie zu haben oder zu sein absolut besser ist als sie nicht zu haben oder nicht zu sein.4
Diese formalen Merkmale genügen, um zu verdeutlichen, dass FeuerbachFeuerbachLudwig sich in seinen anthropologisch-theologischen Ausführungen ausnahmslos auf solche Eigenschaften bezogen hat, die die Tradition als reine Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten bezeichnet.5 Seien dies nun exklusiv göttliche Eigenschaften wie die EwigkeitEwigkeit oder die AllmachtAllmacht, oder seien dies Eigenschaften wie die GerechtigkeitGerechtigkeit, die BarmherzigkeitBarmherzigkeit, die LiebeLiebe, die WeisheitWeisheit oder die GüteGüte, welche auch den Menschen zukommen, von ihnen allen handelt Feuerbach, ohne zu bemerken, dass der ständig drohende und allüberall in der Welt zu beobachtende Verlust der ExistenzExistenz nur dem zukommen kann, was unvollkommen ist. Beim vollkommenen WesenWesen dagegen sind Sein und Wesen identisch, ja müssen identisch sein, denn vollkommen ist nur das WesenWesen, das den Grund seiner Existenz in sich selber hat, und das ist eben gerade seine VollkommenheitVollkommenheit.6
5.2 Ludwig Wittgensteins Behauptung der Unsinnigkeit religiöser Aussagen1
Nach Kants kopernikanischer Wende und Feuerbachs Reduzierung der ExistenzExistenz Gottes auf eine anthropomorphe Vorstellung, trat Ludwig WittgensteinWittgensteinLudwig (1889–1951) mit seiner sprachkritischen Wende (linguistic turnlinguistic turn) auf den Plan: „Alle Philosophie ist ‚Sprachkritik‘.“2 Wie schon KantKantImmanuel und ebenso auch FeuerbachFeuerbachLudwig die Möglichkeit metaphysischer Erkenntnisse als unbegründbar betrachteten, so verstand auch WittgensteinWittgensteinLudwig die Ergebnisse der Philosophie als „Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der VerstandVerstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat“3. „Dieses Anrennen gegen die Wände unseres Käfigs ist völlig und absolut aussichtslos.“4 Weil in der EthikEthik und in der ReligionReligion aber trotzdem über diese Grenze der Sprache hinauszugelangen gesucht werde, mache „ihre Unsinnigkeit ihr eigentliches WesenWesen“ aus.5 „Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach UnsinnUnsinn sein.“6 Deswegen führe er selbst „die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück“7, denn „es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen“8. Zu dieser alltäglichen Verwendung der Sprache ist auch die Reduktion der Religion auf ein kulturell bedingtes SprachspielSprachspiel zu rechnen, mit der er den Unterschied verfehlt, der zwischen einem WahrheitsanspruchWahrheitsanspruch und einem Sprachspiel liegt. „Alles Sprachspiel beruht darauf, dass Wörter und Gegenstände wiedererkannt werden“9, „das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform“10, und auch „der BegriffBegriff des Wissens ist mit dem des Sprachspiels verkuppelt“11.
Für WittgensteinWittgensteinLudwig, zumal nach seinem Tractatus – für Joachim SchulteSchulteJoachim „ein Buch voller Lücken und Sprünge; ein Buch, in dem vieles nur angedeutet wird“12 –, zerfällt die WirklichkeitWirklichkeit in Dinge: „Ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und untereinander sind sie verbunden, so stellt das Ganze – wie ein lebendes Bild – den SachverhaltSachverhalt vor.“13 „Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen. (Sachen, Dingen.)“14 Ein Bild der Wirklichkeit schliesslich ist der SatzSatz. „Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken.“15 Dabei bilden die Grenzen der Sprache zugleich die Grenzen jeder möglichen ErkenntnisErkenntnis, mit anderen Worten: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Die LogikLogik erfüllt die Welt; die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen.“16
An der ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, so viel gleich zu Beginn, hatte WittgensteinWittgensteinLudwig kein echtes Interesse, sein „zentrales Anliegen war vom Anfang bis zum Ende seiner philosophischen Laufbahn das WesenWesen der Sprache“17.
5.2.1 Sprache und WahrheitWahrheit
Auf welcher wissenschaftstheoretischen Basis WittgensteinWittgensteinLudwig steht, zeigt sich etwa da, wo er vom Glauben an GottGott handelt: „Was immer der GlaubeGlaube an Gott sein mag, es kann kein Glaube an etwas sein, das wir nachprüfen oder durch Nachschauen herausfinden können.“1 Damit gibt er seine Zugehörigkeit zum sogenannten Wiener KreisWiener Kreis unmissverständlich zu erkennen, deren Mitglieder eine dezidiert empiristische und antimetaphysische Tatsachenforschung betrieben.2 Ein Mitglied war auch der weiter oben3 eingeführte Willard Van Orman QuineQuineWillard Van Orman, dessen naturalisierte ErkenntnistheorieErkenntnistheorie Wittgensteins denkerischen Hintergrund offen legt. QuineQuineWillard Van Orman ging davon aus, „dass jegliche BedeutungsgebungBedeutungsgebung für Wörter letztlich auf BeobachtungenBeobachtungen basieren muss“4, welche selbst wiederum eine empirische Grundlage in der „Reizung der SinnesrezeptorenSinnesrezeptoren“ haben.5
Von da her ist auch Wittgensteins an die ReligionReligion gerichteter Unsinnigkeitsvorwurf zu verstehen. Fällt sie ihm doch gerade deswegen aus dem Rahmen der Wissenschaftlichkeit, weil sie die GewissheitGewissheit ihrer Sätze weder nachprüfen noch durch Nachschauen herausfinden könne. Seine ReligionskritikReligionskritik begründet WittgensteinWittgensteinLudwig mitunter auch dadurch, dass die religiöse Sprache ohnehin beständig Gleichnisse verwende. „Doch ein Gleichnis muss ein Gleichnis für etwas sein. Und wenn ich eine Tatsache mit Hilfe eines Gleichnisses beschreiben kann, muss ich ebenfalls imstande sein, das Gleichnis wegzulassen und die Fakten ohne es zu beschreiben.“6 Doch sobald das Gleichnis weggelassen und die zugrunde liegende Tatsache zu beschreiben versucht wird, „merken wir, dass es gar keine derartigen TatsachenTatsachen gibt. Und so scheint, was zunächst wie ein Gleichnis wirkte, nichts weiter zu sein als UnsinnUnsinn“7. UnsinnigUnsinnig sind die Sätze für WittgensteinWittgensteinLudwig im Übrigen dann, wenn sie keine Verbindung mit einem Ding der – empirisch verstandenen – WirklichkeitWirklichkeit herstellen, währendem sie sinnlossinnlos in all jenen Fällen sind, in denen sie unabhängig von Sachverhalten in der Wirklichkeit wahr oder falsch sind, wie beispielsweise bei Kontradiktionen oder TautologienTautologien.8 „Danach können Sätze nur dadurch SinnSinn haben, weil und indem sie empirische Erkenntnisse herstellen.“9 So deckt sich das Gebiet der sinnvollen Sprache mit den Sätzen der NaturwissenschaftNaturwissenschaft, mit dem einzig Sagbaren.10 Doch wenn die Rede über die Naturwissenschaft die einzig sinnvolle Rede ist, so sei kritisch gefragt, sind dann auch alle seine einschlägigen Schriften Unsinn? Wenn er in diese Richtung auch zu tendieren scheint,11 so kann innerhalb der Grenzen der Naturwissenschaft jedenfalls nicht bestimmt werden, dass nur die naturwissenschaftlichen Sätze sinnvoll sind.12
Nicht anders als konsequent, weist er in seiner positivistischen Sichtweise das ontologische ArgumentArgument ebenso zurück wie GauniloGaunilo.13 „Das WesenWesen Gottes verbürge seine ExistenzExistenz“, wie er mit dieser Aussage konfrontiert ist, stellt er eine Frage, die der antimetaphysischen Linie gemäss ist, wie sie im Wiener KreisWiener Kreis vertreten wird: „Könnte man denn nicht auch sagen, das Wesen der Farbe verbürge ihre Existenz?“14 Wie sich weiter oben erwiesen hat, lässt sich die notwendige Existenz des vollkommenen Wesens aus seinem Wesen erkennen.15 Dass WittgensteinWittgensteinLudwig das ontologische Argumentontologische Argument auf die Farbe überträgt, demnach auch bei der Farbe das Wesen die Existenz verbürge, lässt auch bei ihm ein immanentistisches WeltbildWeltbild durchscheinen. Wenn ihm auch klar ist: „Ein GottesbeweisGottesbeweis sollte eigentlich etwas sein, wodurch man sich von der Existenz Gottes überzeugen kann“, und „dass die Gläubigen, die solche Beweise lieferten, ihren ‚Glauben‘ mit ihrem VerstandVerstand analysieren und begründen wollten“, so steht da nichtsdestotrotz ein WortWort, mit dem er die EmpirieEmpirie zu übersteigen scheint und das als SoseinserfahrungSoseinserfahrung gelesen werden kann, nämlich, dass „sie selbst durch solche Beweise nie zum Glauben gekommen wären“.16 Vielmehr könne nur das Leben „zum Glauben an GottGott erziehen“, wobei es „auch Erfahrungen [seien], die dies tun; aber nicht Visionen, oder sonstige Sinneserfahrungen, die uns die ‚Existenz dieses Wesens‘ zeigen, sondern z.B. Leiden verschiedener Art“.17 Nur „das Leben kann uns diesen BegriffBegriff aufzwingen“18.
Was aber ist und wo findet sich eigentlich der SinnSinn? Die grundlegende AntwortAntworttheoretische findet sich in der bereits erwähnten Stelle aus der Einleitung seines Tractatus, wo es heisst, dass der UnsinnUnsinn jenseits der Grenze der Sprache liege, was zugleich heisst: Der Sinn liegt innerhalb des Rahmens der Sprache. WittgensteinWittgensteinLudwig bezeichnet das „Bild von dem WesenWesen der menschlichen Sprache“, indem er darauf verweist, dass die Wörter Gegenstände und die Sätze Verbindungen von solchen Benennungen sind.19 „In diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzeln der Idee: Jedes WortWort hat eine Bedeutung. Diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet. Sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht.“20 Das Bild der Sprache ebenso wie jedes andere Bild bestehe darin, „dass sich seine Elemente in bestimmter Weise zueinander verhalten“21. Und was das Bild darstelle, sei sein Sinn.22 Wobei es Sinn nur insoweit habe, als es denk- und sagbar sei. Zudem stimme das Bild mit der WirklichkeitWirklichkeit überein oder nicht, sei es richtig oder unrichtig, wahr oder falsch.23 Wobei die WahrheitsdifferenzWahrheitsdifferenz der Sprache, das heisst ihre Fähigkeit, zwischen wahren und falschen Aussagen zu unterscheiden, sich nicht auf die Welt bezieht, sondern auf ihre logische FormForm.
Das Bild der WirklichkeitWirklichkeit, so wie sie gedacht werde, sei der SatzSatz.24 „Der Satz stellt das Bestehen und Nichtbestehen der Sachverhalte dar.“25 Der SachverhaltSachverhalt wiederum ist ihm „eine Verbindung von Gegenständen“26: „Ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und untereinander sind sie verbunden, so stellt das Ganze – wie ein lebendes Bild – den Sachverhalt vor.“27 Dem Sachverhalt kommt bei WittgensteinWittgensteinLudwig jedoch nicht dieselbe Bedeutung zu, die ihm bei von HildebrandHildebrandDietrich von und den anderen Realistischen Phänomenologen zukommt, denn während dem Sachverhalt hier die FormForm des a-Seins oder des nicht a-Seins eines B zukommt, identifiziert WittgensteinWittgensteinLudwig ihn mit dem Satz. Dass er damit allerdings keinen angemessenen Zugang zur WahrheitWahrheit hat, zeigen einige seiner Formulierungen, dann aber auch die Analyse der Wahrheit – im Sinne der UrteilswahrheitUrteilswahrheit – selbst.
Mit der WahrheitWahrheit ist nach WittgensteinWittgensteinLudwig der SatzSatz verwoben,28 wobei der Satz insofern wahr oder falsch sein kann, als er ein Bild der WirklichkeitWirklichkeit ist.29 Wird wahr und falsch dabei jedoch als Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zu verstehen gesucht, hat es für WittgensteinWittgensteinLudwig „etwas Irreführendes, weil es ist, als sagte man ‚es stimmt mit den TatsachenTatsachen überein oder nicht‘, und es sich doch gerade frägt, was ‚Übereinstimmung‘ hier ist“30. Aussagekräftig ist dann vor allem auch die folgende Stelle: „Wie die Beschreibung einen Gegenstand nach seinen externen Eigenschaften, so beschreibt der Satz die Wirklichkeit nach ihren internen Eigenschaften.“31 Das heisst: „Der Satz konstruiert eine Welt mit Hilfe eines logischen Gerüstes und darum kann man am Satz auch sehen, wie sich alles Logische verhält, wenn er wahr ist.“32 Damit gibt er die Grundzüge seines Denkens deutlich zu erkennen, nämlich einerseits den EmpirismusEmpirismus mit seiner Behauptung, dass die Sinneswahrnehmung die einzige Quelle der ErkenntnisErkenntnis sei, andererseits die Analyse dieser Sinnesdaten bis hin zu einer Verselbständigung des Logischen. „Notwendige Wahrheit“, wie Hacker klarstellte, „ist immer eine Sache logischer NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, und die logische NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive ist unabhängig davon, wie es sich in der Welt gerade verhält.“33 „Einen Zwang, nach dem Eines geschehen müsste, weil etwas anderes geschehen ist, gibt es nicht.“34
AristotelesAristoteles hatte die WahrheitWahrheit noch im Sinne der der Sache angemessenen Aussage definiert: „Zu sagen nämlich, das Seiende sei nicht oder das Nicht-Seiende sei, ist falsch, dagegen zu sagen, das Seiende sei und das Nicht-Seiende sei nicht, ist wahr.“35 WittgensteinWittgensteinLudwig, der den Metaphysikern noch vorgeworfen hatte, ihr „Anrennen gegen die Wände unseres Käfigs [sei] völlig und absolut aussichtslos“36, scheint selbst im logischen Gehäuse der Sprache gefangen gewesen zu sein. Von da her suchte er die GewissheitGewissheit auch nicht ausserhalb des logischen Raumes, sondern in den abstrakten Wissenschaften. Schon HumeHumeDavid schied die Erkenntnisse ja bekanntlich in apriorische und aposteriorische, wobei die aus der Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse TatsachenTatsachen betreffen und apriorisch nur diejenigen der LogikLogik und der MathematikMathematik gewonnen werden.37 Dem tat es WittgensteinWittgensteinLudwig gleich, indem er die Gewissheit nicht im Reich „der relativen Unsicherheit von Erfahrungssätzen“38 suchte, sondern in dem der Logik und der Mathematik.
In den Philosophische[n] Untersuchungen gab WittgensteinWittgensteinLudwig die Reduktion der Sprache auf die naturwissenschaftliche Sprache auf und ersetzte sie durch die Sprachspiele. Nun war es ihm der Gebrauch der Sprache, durch den die Wörter sinnvoll werden, wobei ihm die Regelmässigkeiten der Sprache den Gewohnheiten, Traditionen und Bräuchen entstammen. Wenn die Regelmässigkeiten der Sprache aber in den geschichtlich entstandenen und damit relativen Verhaltens-, Sprech- und Argumentationsweisen gründen, dann handelt es sich um „geregelte Formen des Sprechens, die sich an keiner Sache und an keiner VernunftVernunft ausweisen können und deshalb ganz einfach als ‚zufällig‘ gelten müssen“39. Wenn WittgensteinWittgensteinLudwig auch sagt, er führe „die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück“40, so bleibt es nichtsdestotrotz eine offene Frage, warum die Alltagssprache die eigentliche Norm, die Metasprache sein soll.