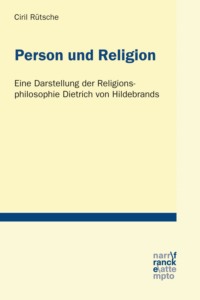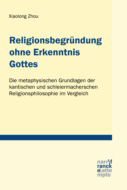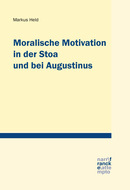Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 16
5.2.2 Sind die religiösen Aussagen tatsächlich unsinnig?
Dass auch die Erfahrung in einem bestimmten SinnSinn der NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive nicht entbehrt, konnte weiter oben nachgewiesen werden.1 An dieser Stelle sei nun Wittgensteins Behauptung einer näheren Prüfung unterzogen, dass die Unsinnigkeit das eigentliche WesenWesen der religiösen (und ethischen) Aussagen ausmache.2 Deren Unsinnigkeit liegt ihm darin begründet, dass die ReligionReligion es nicht mit relativen, sondern mit absoluten Werturteilen zu tun habe, doch gebe es „keine Sätze, die in einem absoluten Sinne erhaben, wichtig oder belanglos sind“3.4 Die relativen Werturteile hingegen sind „blosse Aussagen über Faktisches, doch keine Faktenaussage kann je ein absolutes Werturteil abgeben oder implizieren“5. Auch gebe es keine diesbezügliche Aussagen, die das WissenWissen vermehrten,6 also synthetischsynthetisch sind. Kurzum: Weil die Religion ihre Aussagen empirisch nicht begründen und verifizieren könne, sei sie UnsinnUnsinn.
Wird dieser Vorwurf der Unsinnigkeit religiöser Aussagen und Urteile zum Problem gemacht, ist gleich zu Beginn zwischen vier Arten von Sätzen zu unterscheiden, deren erste die Aussage- und Behauptungssätze sind, bei denen der SatzSatz das Äussere und das UrteilUrteil das Innere ist, wie Alexander PfänderPfänderAlexander differenzierte,7 der davon ausging, dass die LogikLogik eine ontologische Grundlage hat. Was nämlich im Urteil behauptet wird, ist das Bestehen eines gegebenen Sachverhalts. Das Urteil besteht dabei aus einem SubjektSubjekt, einem PrädikatPrädikat und einer KopulaKopula, welcher eine Doppelfunktion zukommt: nämlich das Hinbeziehen der Prädikatsbestimmtheit auf den Subjektsgegenstand und zugleich das BehauptenBehaupten der Übereinstimmung des Urteils mit einem als bestehend gesetzten SachverhaltSachverhalt.8 Damit erhebt es den Anspruch, mit der WirklichkeitWirklichkeit übereinzustimmen und damit wahr zu sein. Sofern es mit dem Sachverhalt jedoch nicht übereinstimmt, ist das Urteil falsch. Hieran scheiterte WittgensteinWittgensteinLudwig, der den Sachverhalt auf das Urteil bzw. den Satz reduzierte. Ein Satz kann aber ebenso wenig etwas meinen oder behaupten wie der Sachverhalt. In beiden Fällen bedarf es der Behauptung, dass das Verhalten der betreffenden Sache mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
Wird in diesem Sinne eine religiöse Aussage getätigt bzw. ein religiöses UrteilUrteil gefällt, beispielsweise, der endliche MenschMensch kann zu der unendlichen und vollkommenen PersonPerson Gottes betenbeten, dann liegen das SubjektSubjekt (die endliche Person) und das PrädikatPrädikat (zu der unendlichen und vollkommenen Person Gottes beten) nicht jenseits der Erfahrbarkeit und damit auch nicht der Erkennbarkeit. Sowohl das notwendige SoseinSosein der menschlichen Person als auch dasjenige Gottes können von innen her erfahren und die darin gründenden Sachverhalte mit absoluter GewissheitGewissheit erkannt werden.9 Und wenn die Prädikatsbestimmtheit des „Zu-der-unendlichen-und-vollkommenen-Person-Gottes-Betens“ auf den Subjektsgegenstand „Endliche Person“ bezogen und mit der KopulaKopula „Können“ behauptet wird, mit dem wirklichen Bestehen dieses Sachverhalts übereinzustimmen, dann handelt es sich dabei mit Sicherheit nicht um ein unsinniges, sondern vielmehr um ein äusserst tiefsinniges Urteil.
Ein anderes Beispiel wäre die Ableitung eines Sollens aus einem Sein, deren Begründbarkeit schon HumeHumeDavid bestritt. Sollte und sollte nicht könne nicht von einem ist oder ist nicht abgeleitet werden. Die Beziehung zwischen den Gegenständen des Seins und Sollens sei nicht in der Beziehung dieser Gegenstände selbst begründet, in der sie zueinander stünden. Es müsste, so HumeHumeDavid, „ein Grund angegeben werden für etwas, das sonst ganz unbegreiflich scheint, nämlich dafür, wie diese neue Beziehung zurückgeführt werden kann auf andere, die von ihr ganz verschieden sind“10. Und überdies könne diese Beziehung nicht durch die VernunftVernunft erkannt werden.11 Jedoch, wie gegen HumeHumeDavid einzuwenden ist, wird niemand bestreiten, einmal abgesehen von einem ganz entarteten Menschen, dass das Sehen selbst eines unbekannten Kindes, mit der die eigene PersonPerson in keinerlei verwandtschaftlicher oder rechtlicher Beziehung steht, es aufgrund seiner Würde auf den ersten Anblick verbietet, es in irgendeiner Weise zu misshandeln oder auszunützen. Im Sinne Humes wäre das ein FehlschlussFehlschluss vom Sein auf das SollenSollen. Doch ist das tatsächlich ein Fehlschluss? Ist das nicht vielmehr eine unmittelbare Erfahrung des diesem Kind zukommenden Wertes der MenschenwürdeMenschenwürde, die die eigene Person affiziert? Beim metaphysischen UrteilUrteil, dass unschuldige Kinder nicht misshandelt werden sollen, kann das „Nicht-misshandeln-Sollen“ evidenterweise vom menschlichen Sein abgeleitet und apodiktischapodiktisch behauptet werden.
Wobei es um die Sinnhaftigkeit in punkto Verstehbarkeit in diesen beiden Beispielen freilich ganz anders bestellt ist als bei einem Beispiel einer empirischen Tatsache, z.B., dass der Löwe ein Fleischfresser ist. Mit dem „sinnvollen intellektuellen Prozess“ des Verstehens, das das „WissenWissen um die Bedeutung der Wörter und das KennenKennen der Sprache“ voraussetzt und dadurch „einen ganz eigenen Typus der Erfahrung“ ermöglicht,12 hat auch von HildebrandHildebrandDietrich von sich auseinandergesetzt. Grundlegend ist seine Differenzierung zwischen der Bedeutung eines Wortes, dem BegriffBegriff, dem SatzSatz und dem SachverhaltSachverhalt. Während die Bedeutung eines Wortes ein Begriff ist und das WortWort auf einen Gegenstand zielt, zielt der Satz auf einen Sachverhalt.13 Das VerstehenVerstehen – „ein ausgesprochen rezeptiver Akt, ein Aufnehmen“14 – unterscheidet er sodann in drei Stufen. Von diesen drei Stufen sind die ersten beiden Stufen, nämlich „die Belehrung über den SinnSinn eines Wortes“ und „die Festigung dieser Kenntnis, bis sie mir geläufig ist“, an dieser Stelle nicht von Relevanz, sondern einzig die dritte Stufe, nämlich „der Gebrauch des Wortes im Meinen des Objektes und im BehauptenBehaupten eines Sachverhaltes durch einen Satz“.15
Die Unterscheidung, die von HildebrandHildebrandDietrich von auf dieser Stufe einführt, versteht sich von seiner ErkenntnistheorieErkenntnistheorie her. So bezieht er sich in erster Linie auf die Fälle, bei denen „der Inhalt des Mitgeteilten oder Behaupteten ein wesensnotwendiger SachverhaltSachverhalt“ ist, dessen VerstehenVerstehen in die Lage versetzt, „diesen selbst in seiner EvidenzEvidenz zu erkennen“ und das Verstehen eine rationale IntuitionIntuition der objektiven ExistenzExistenz dieses Sachverhalts ermöglicht.16 Darum ist die MitteilungMitteilung „nur ein Anlass, aber nicht die Quelle der ErkenntnisErkenntnis und unseres Wissens um seine Gültigkeit“17. Auch ist die Existenz des Sachverhalts ebenso wie das WissenWissen um ihn durch das WesenWesen garantiert, in dem er gründet, und nicht durch die Aussage des Mitteilenden.
Anders verhält es sich, wenn der Inhalt des Mitgeteilten oder Behaupteten „kein wesensnotwendiger SachverhaltSachverhalt, sondern ein kontingentes Gesetz oder ein konkretes reales Faktum“18 ist. Im Falle einer solchen MitteilungMitteilung oder Behauptung beruht die Überzeugung von der ExistenzExistenz des Sachverhalts darauf, dass sie der eigenen PersonPerson gesagt oder von jemandem niedergeschrieben wurde. „Jedenfalls ist das VerstehenVerstehen nicht nur als Unterlage erforderlich, um eine rationale IntuitionIntuition zu ermöglichen, sondern auf ihm baut sich ein Erfahren durch die betreffende Aussage auf, ein Annehmen des in ihr enthaltenen Anspruchs auf die WirklichkeitWirklichkeit des Mitgeteilten.“19
Werden diese Ausführungen über das VerstehenVerstehen mit einer analogen Stelle bei WittgensteinWittgensteinLudwig verglichen, zeigt sich der zwischen WittgensteinWittgensteinLudwig und von HildebrandHildebrandDietrich von in Sachen der Philosophie bestehende Unterschied in aller Deutlichkeit. Es ist der Unterschied zwischen einem Logischen PositivistenPositivisten und einem Realistischen Phänomenologen. Während das Verstehen für diesen eine rationale IntuitionIntuition in das WesenWesen und die objektive ExistenzExistenz eines gegebenen Sachverhalts ermöglicht, besagt das Verstehen für jenen, womit er sich jedoch nicht auf einen SachverhaltSachverhalt, sondern auf den SatzSatz bezieht: „wissen was der Fall ist, wenn er wahr ist“20. Woraus er folgert: „Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist.“21 Das gibt sein Bewegen in dem engen Gehäuse der LogikLogik, ohne Bezug zur ObjektivitätObjektivität, deutlich zu erkennen.
Es gibt bei WittgensteinWittgensteinLudwig allerdings auch Stellen, die ein philosophisches VerstehenVerstehen der ReligionReligion und der personalen Bedingungen eines solchen Verstehens vermuten lassen.22 Stellen, mit denen er seine TheseThese implizit in Frage zu stellen scheint. Dass er gewisse Merkmale der Religion verstanden hat, gibt er beispielsweise da zu erkennen, wo er vom Dialog des Menschen mit GottGott handelt: „Gott kannst du nicht mit einem Andern reden hören, sondern nur, wenn du der Angeredete bist.“23 Vielsagend sind dann aber auch die Stellen, an denen er sich zu den Bedingungen des religiösen Verhältnisses äussert.24 Doch schränkt er eine übertriebene Erwartung mit einer Aussage wieder ein, die einerseits zwar für eine gewisse Religiosität zu sprechen scheint, die andererseits aber seine Unsinnigkeitsthese untermauert: „Ich könnte ihn ‚das Vorbild‘, ja ‚Gott‘ nennen – oder eigentlich: ich kann verstehen, wenn er so genannt wird; aber das WortWort ‚Herr‘ kann ich nicht mit SinnSinn aussprechen.“25 Nur unter der Voraussetzung könnte ihm das etwas sagen, wie er bekennt, „wenn ich ganz anders lebte“26.27
5.2.3 Das Ineinander von Philosophie und ReligionReligion
Dass die religiösen Aussagen nicht unsinnig sind, erweist sich nicht alleine daran, dass die LogikLogik und die ErkenntnistheorieErkenntnistheorie mit den Sachverhalten eine ontologische Grundlage haben, die – wie sich gezeigt hat – auf eine andere Art verstanden werden können als die Sätze (nämlich auf dem Wege einer rationalen IntuitionIntuition), sondern auch daran, dass der AntwortAntworttheoretische des Glaubens eine intellektöffnende WirkungWirkung zukommen kann. Freilich ist dieses ErkennenErkennen aufgrund des Glaubens immer abhängig vom Gegenstand und der jeweiligen Glaubensintensität. Wären die religiösen Aussagen aber UnsinnUnsinn, gäbe es in der WirklichkeitWirklichkeit kein ihnen entsprechendes Korrelat. Wenn dem Glauben jedoch eine vernunftgemässe Wirkung eignet, muss auch das Korrelat real sein, dem Glauben geschenkt wird. Diese Erfahrung hat nicht nur von HildebrandHildebrandDietrich von gemacht,1 diese Erfahrung haben auch Denker wie AnselmAnselmvon Canterbury von Canterbury oder Duns ScotusDuns ScotusJohannes gemacht, die die Eigenschaften des vollkommenen Wesens zu unterscheiden wussten. Denn eindeutig gibt AnselmAnselmvon Canterbury alleine schon im Titel seiner Schrift Proslogion (Anrede) und sodann auch quer durch die ganze Schrift hindurch seinen Glauben an GottGott zu erkennen, den er durch die von ihm beschriebenen Denkschritte immer besser zu verstehen sucht und schliesslich auch besser versteht, entsprechend seinem Programm: fides quaerens intellectumfides quaerens intellectum.
Bereits AugustinusAugustinus verhalf der GlaubeGlaube an die Trinität Gottes und an das Imago-Dei-Sein des Menschen zu überzeugenden philosophischen Einsichten in die Struktur des menschlichen Geistes.2 Durch den Glauben an die Dreifaltigkeit Gottes vermochte er nicht nur dieselbe Struktur auch im Menschen auszumachen, der mit GeistGeist, LiebeLiebe und Kenntnis eine in sich geeinte Dreiheit darstellt.3 Vielmehr erschloss er darüber hinaus auch das WesenWesen der PersonPerson, indem er darauf aufmerksam machte, dass der Geist nicht nur sich selbst kennt und liebt, sondern auch vieles andere.4 Nicht zuletzt vermochte Augustinus auf dieser Basis auch das erkenntnistheoretische Problem zu klären, was die EinsichtEinsicht in einen gegebenen SachverhaltSachverhalt eigentlich bedingt. Zumindest zweierlei scheint es zu bedingen, nämlich die Person und das Objekt. Doch für Augustinus impliziert das ErkennenErkennen keine zweigliedrige, sondern eine dreigliedrige Struktur, denn zwischen dem Objekt und der Person ist es der Wille, der zur ErkenntnisErkenntnis motiviert.5
Das Verhältnis zwischen der VernunftVernunft und dem Glauben oder der Philosophie und der ReligionReligion hat darüber hinaus noch andere wesentliche Merkmale. Damit ist in erster Linie auf die Gegenstände Bezug genommen, die zugleich KorrelateKorrelateobjektive des Glaubens wie der rationalen ErkenntnisErkenntnis sind, bei denen die philosophische Erkenntnis die Wahrheitsansprüche des Glaubens stützen kann. Dann aber zeichnet sich das Verhältnis zwischen Vernunft und GlaubeGlaube auch dadurch aus, dass die Religion die philosophischen Grundwahrheiten voraussetzt. Etwa die Verschiedenheit von Körper und GeistGeist, die menschliche FreiheitFreiheit, die Verschiedenheit von gut und böse oder die Realität des personalen im Unterschied zum apersonalen Sein usw. Die religiösen Wahrheiten liegen dabei aber nicht abseits der philosophischen Grundwahrheiten, sondern über ihnen.6 Ein erhellendes Beispiel dafür ist etwa die Würde des Menschen, die zweifelsohne ein Gegenstand philosophischen Forschens ist, die durch den Glauben an die Menschwerdung Gottes aber in einer ganz anderen TiefeTiefe durchdacht werden kann. Auch die darin gründenden Sachverhalte erscheinen dann in einer wesentlich gesteigerten IntelligibilitätIntelligibilität, als wenn der MenschMensch als ein höher entwickeltes Tier postuliert wird. Das erklärt zumindest ansatzweise, warum und inwiefern von HildebrandHildebrandDietrich von die Philosophie eine Wegbereiterin der Religion (praeambulum fidei) nennt.7 Weil der Glaube auf den philosophischen Grundwahrheiten aufbaut und sie durch die ZustimmungZustimmung zu einer religiösen WahrheitWahrheit übersteigt.8
Doch muss beim Vergleich einer vernünftigen ErkenntnisErkenntnis mit einem Akt des Glaubens eine klärende Unterscheidung gemacht werden: „Es schliesst keine ‚doppelte WahrheitWahrheit‘ ein, sondern ist von entscheidender Bedeutung innerhalb des Glaubens. Es ist der Unterschied zwischen GlaubeGlaube an, und Glaube dass, der u.a. von Martin BuberBuberMartin und Gabriel MarcelMarcelGabriel gemacht wurde.“9 Aber nicht als ob BuberBuberMartin und MarcelMarcelGabriel die ersten gewesen wären, die diesen Unterschied machten, vielmehr – worauf von HildebrandHildebrandDietrich von aufmerksam macht10 – ist schon bei AugustinusAugustinus vom Unterschied zwischen credere in Deum und credere Deo zu lesen.11 Jedenfalls ist der Glaube an, der Glaube an den persönlichen GottGott. „Dieser Akt ist nicht eine Überzeugung, sondern eine spezifische Hingabe an eine PersonPerson. Ja, noch mehr, es muss die Hingabe an die absolute Person sein“12. Der Glaube an ist jedenfalls keine theoretische AntwortAntworttheoretische, wie z.B. der Glaube an die ExistenzExistenz des expandierenden Universums. Im Unterschied zu einem Glauben, der sich auf einen SachverhaltSachverhalt bezieht, ist der Glaube an „ein allumfassender Akt“13. Was aber meint: ein allumfassender Akt? Damit ist der religiöse Akt als solcher bezeichnet, d.h. der „Akt, in dem die Person Gott nachfolgt, ihm anhängt, sich selbst mit VerstandVerstand, Wille und Herz an die absolute Person Gottes hingibt“14.
Der GlaubeGlaube dass ist dagegen eine ausgesprochen theoretische AntwortAntworttheoretische. Seine Gegenstände sind Sachverhalte und nur Sachverhalte, nicht aber Personen. Mit der theoretischen AntwortAntworttheoretische des Glaubens dass verhält es sich im Grunde wie mit der theoretischen AntwortAntworttheoretische der ErkenntnisErkenntnis, dass … z.B. dass die menschliche PersonPerson eine EinheitEinheit aus Materiellem und Geistigem, aus Kontingentem und Notwendigem ist. Doch während bei der Erkenntnis, gerade im Falle eines in einer wesensnotwendigen Einheit gründenden Sachverhalts, das objektive Korrelat selbst mit absoluter GewissheitGewissheit erkannt werden kann, ohne BedürfnisBedürfnis nach weiteren Gewissheitskriterien, ist im Falle des Glaubens die eine AntwortAntworttheoretische gleichsam die Stütze der anderen. Oder mit den Worten von Hildebrands: „Der Glaube an ist gerade die Grundlage für den Glauben dass.“15 Sie sind so miteinander verwoben, dass jeder MenschMensch, der einen Glauben an hat, immer auch einen Glauben dass haben wird.16 Die Untersuchung der religionskritischen TheseThese Wittgensteins, dass die religiösen Aussagen UnsinnUnsinn, weil ohne wirklichen Gegenstand seien, auf den die Aussagen sich bezögen, sei mit einem Ausschnitt aus einem Werk beschlossen, das von Hildebrands letztem Lebensjahrzehnt entstammt:
Jedem Glauben an entspricht also nicht nur ein GlaubeGlaube dass, der sich auf die von GottGott geoffenbarten Wahrheiten bezieht, sondern auch ein anderer, der sich auf die PersonPerson selbst bezieht, an die wir glauben. Wenn wir z.B. schöne Musik hören und tief davon bewegt sind, so ist unser Erlebnis sicher nicht ein UrteilUrteil, dass diese Musik schön ist. Es ist vielmehr der direkte Kontakt mit der SchönheitSchönheit der Musik, ein Ergriffensein von ihr und eine AntwortAntworttheoretische der Begeisterung. Aber ohne jeden ZweifelZweifel halten wir dabei das Urteil ‚diese Musik ist schön‘ implizit für wahr. Das ist nur ein schwacher Vergleich, aber er mag genügen um zu zeigen, in welcher Weise jeder Glaube an implizit einen Glauben einschliesst, dass der Gegenstand unseres Glaubens, die Person, an die wir glauben, existiert und dass sie in allem so ist, dass ihr der Glaube an gebührt.17
5.3 Richard DawkinsDawkinsRichard und der „Neue Atheismus“
5.3.1 Thesen und BegründungBegründung
Vor dem Hintergrund des Aufweises der Erkennbarkeit Gottes und der Widerlegung der Thesen Ludwig Wittgensteins sei der Stimme von Richard DawkinsDawkinsRichard (1941-) Gehör geschenkt, der sich mit seiner im Jahre 2006 erstmals im englischen Original erschienen Monografie The God Delusion (Der Gotteswahn) gegen die theistischen Religionen und insbesondere gegen die drei abrahamitischen Religionen gewandt hat. Sein Buch gilt seither als einer der Haupttexte des „Neuen Atheismus“. DawkinsDawkinsRichard’ zentrale TheseThese, die im Rahmen dieser Untersuchung relevant ist, lautet, dass die ReligionReligion „ein unglückliches Nebenprodukt einer grundlegenden psychologischen Neigung“ sei, „die unter anderen Umständen nützlich sein kann oder früher einmal nützlich war“.1 Wie aber begründet er diese Behauptung, die der auf den vergangenen Seiten dargelegten und philosophisch wohlbegründeten Lehre diametral entgegengesetzt ist?
DawkinsDawkinsRichard Schrift ist in zehn Kapitel gegliedert, von denen in diesem Abschnitt die Kapitel drei bis sieben thematisiert werden. Im dritten Kapitel beschäftigt er sich unter anderem mit den klassischen Argumenten für die ExistenzExistenz Gottes, und kritisiert an den bekannten fünf Wegen des Thomas von AquinThomas von Aquin, „dass GottGott selbst gegen die Regression immun ist“2. Dabei geht es ihm um die in die unendliche Regression verlaufende Frage nach dem Ursprung Gottes, nach dem Gestalter des Gestalters. „Die Lösung ‚Gott‘ beendet also nicht die unendliche Regression, sondern verstärkt sie ganz gewaltig.“3 Das ontologische ArgumentArgument bezeichnet er sodann als das „kindische Argument“, aus dem „aus trickreichen Wortverdrehungen grossartige Schlussfolgerungen hervorgehen sollen“.4 Er bekundet „ein automatisches, tiefes Misstrauen gegenüber jedem Gedankengang, der zu einer derart bedeutsamen SchlussfolgerungSchlussfolgerung gelangt, ohne dass auch nur eine einzige ErkenntnisErkenntnis aus der WirklichkeitWirklichkeit dazu beigetragen hätte“5. Vielleicht, wie er eingestehen muss, „zeigt das einfach nur, dass ich kein Philosoph bin, sondern NaturwissenschaftlerNaturwissenschaftler“6, womit er gerade da positioniert ist, wo auch GauniloGaunilo stand. Hatte DawkinsDawkinsRichard die Argumente des Thomas von Aquin immerhin noch dahingehend kritisieren können, dass doch auch Gott einer AntwortAntworttheoretische auf das Woher bedarf, so bringt er keinerlei Verständnis mehr auf dafür, dass „Existenz […] ein Zeichen für VollkommenheitVollkommenheit“7 ist.
Auch weiss er mit der EinfachheitEinfachheit Gottes nichts anzufangen. „Ein GottGott, der ständig den Zustand jedes einzelnen Teilchens im Universum überwacht und kontrolliert, kann nicht einfach sein. Seine ExistenzExistenz erfordert schon als solche eine ungeheuer umfangreiche Erklärung.“8 Hieran zeigt sich DawkinsDawkinsRichard Unverständnis für die philosophische MethodeMethode ebenso wie sein szientistischer Zugang, denn wesentlich einfacher als die empirische ist die philosophische Erkenntnismethode. Während diese nämlich auf das Erfassen des Wesens des Seienden abzielt, geht jene beobachtend um das Seiende herum. Während die NaturwissenschaftenNaturwissenschaften von vielen BeobachtungenBeobachtungen auf das betreffende Arturteil schliessen, bedarf die Philosophie nicht des Vielerleis an Einzelbeobachtungen. Sie kann das SoseinSosein prinzipiell an einem einzigen Beispiel erfassen. Auch Maurice BlondelBlondelMaurice wusste darum, dass das Sein umso mehr inneren Reichtum hat, je mehr es eins ist.9
Die Suche nach einem ArgumentArgument für die ExistenzExistenz Gottes ist für DawkinsDawkinsRichard insgesamt ein BeweisBeweis dafür, dass das BewusstseinBewusstsein der betreffenden Personen noch nicht erweitert wurde. „[D]er grösste wissenschaftliche Bewusstseinserweiterer, den es je gab“, ist ihm „Darwins Theorie der EvolutionEvolution durch natürliche Selektionnatürliche Selektion“.10 Die Theorie der natürlichen Selektion geht auf Charles DarwinDarwinCharles (1809–1882) zurück, der mit seiner 1859 in London erstmals erschienen Schrift On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life nachzuweisen suchte, dass die Entstehung der Arten auf dem Wege der Evolution vonstatten geht. DawkinsDawkinsRichard wiederum nennt die natürliche Selektion einen „allgemeinen Prozess zur Optimierung biologischer Arten“11 bzw. „eine additive Einbahnstrasse in Richtung der Verbesserung“12. Über den UrknallUrknall13, die VererbungVererbung und den Kampf ums DaseinKampf ums Dasein, welchen das am besten angepasste Individuum überlebt und sich fortpflanzt, verläuft der Prozess der Entstehung und der Entwicklung der Lebewesen von niederen zu höheren Arten. Von da her ist es auch zu verstehen, dass DawkinsDawkinsRichard sich am unendlichen Regress stösst, da ihm jedes Lebewesen eine naturwissenschaftlich greifbare UrsacheUrsache haben muss.
Wenn er von da her auch von einer „EvolutionEvolution der ReligionReligion“14 spricht und diese von der darwinistischen Theorie her zu erklären versucht, dann fragt er nach dem Druck, den die natürliche Selektionnatürliche Selektion ausgeübt hat, „sodass die Hinwendung zur Religion begünstigt wurde“15. Da in der darwinistischen Selektion eine erbarmungslose Nützlichkeit vorherrscht und jegliche Verschwendung strikte vermieden wird, „muss jedes allgemein verbreitete Merkmal einer Spezies – auch die Religion – dieser Spezies einen gewissen Vorteil verschafft haben, sonst hätte es nicht überlebt“16. Auch bei der „Evolution der Religion“ geht DawkinsDawkinsRichard von den Vorzügen der natürlichen Selektion aus, die er in der „Fähigkeit zum Überleben und zur Verbreitung“17 sieht. Nach seiner eigenen Ansicht über den darwinistischen Überlebenswert ist die Religion „ein Nebenprodukt von etwas anderem“18. Wenn die Religion aber, wie eingangs erwähnt, „ein unglückliches Nebenprodukt einer grundlegenden psychologischen Neigung“ sein soll, „die unter anderen Umständen nützlich sein kann oder früher einmal nützlich war“,19 was ist dann dieses andere? Nach DawkinsDawkinsRichard, ein eigentlich nützlicher Mechanismus, von dem die Religion „eine Fehlfunktion“20 sei.
In groben Zügen ist an dieser Stelle auch auf seinen Erklärungs- und Begründungsversuch „der memetischen Theorie der ReligionReligion“21 einzugehen, nach der die Replikatoren, d.h. die codierten Informationen, die – nach dem Musterbeispiel eines Gens – exakte Kopien ihrer selbst erzeugen,22 welche sich kulturell replizieren und vererben. Nach DawkinsDawkinsRichard sind die Meme, „die allein nicht unbedingt gute Überlebensfähigkeit besitzen“, in Memplexe gruppiert, in denen sie erhalten blieben.23 Auf dieser Grundlage versucht DawkinsDawkinsRichard auch die Sprachevolution verständlich zu machen, nach der infolge der Veränderung des ersten Vokals sich auch andere hätten wandeln müssen, auf dass Zweideutigkeiten vermieden wurden. „In diesem zweiten Entwicklungsstadium wurden Meme vor dem Hintergrund bereits vorhandener Mempools selektiert und bildeten einen neuen Memplex aus untereinander verträglichen Memen.“24 Von da her versucht er auch die ExistenzExistenz der Religion so zu begründen, dass sie nur „wegen ihrer absoluten ‚Leistung‘ oder wegen ihrer Verträglichkeit mit dem vorhandenen Memplex“25 erhalten geblieben sei.
Auch wenn von einem Teil nicht auf das Ganze geschlossen werden kann, so wird der erste Eindruck, den diese Theorie erweckt, durch ein anderes WortWort nur bestärkt, nach dem auch die NächstenliebeNächstenliebe eine Fehlfunktion sei. Ein Wort, welches DawkinsDawkinsRichard „in einem streng darwinistischen SinnSinn“ gebrauche und „keinerlei Abwertung“ beinhalte.26 Unweigerlich entsteht bei diesem Verdrehen der WahrheitWahrheit der Eindruck, als sei der antike SophismusSophismus wiedererstanden. Was Grund genug ist, die EvolutionstheorieEvolutionstheorie insgesamt einer philosophischen Kritik zu unterziehen. Diese rechtfertigt sich auch von da her, dass diese Theorie eindeutig naturalistischnaturalistisch und materialistischmaterialistisch ist und zahlreiche philosophische Prämissen enthält, die sie selbst nicht zu begründen weiss, wie z.B. den wesentlichen Unterschied zwischen Apersonalem und Personalem.