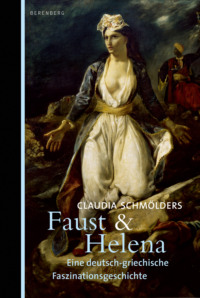Kitabı oku: «Faust & Helena», sayfa 2
Deutschkritisch heftig reagiert und über penible Kritik sich geärgert hatte zuvor schon Herder, der Völkerphilosoph und Winckelmann-Bewunderer in einem Nachruf im »Teutschen Merkur«: »… in der schrecklichen Einöde alter Nachrichten und Geschichte, da Plinius und Pausanius, wie ein paar abgerissene Ufer dastehn, auf denen man weder schwimmen, noch ernten kann; in einer solchen Lage der Sachen rings umher an eine Geschichte der Kunst des Altertums denken, die zugleich Lehrgebäude, keine Trümmer, sondern ein lebendiges, volkreiches Theben von sieben Pforten sei, durch deren jede Hunderte ziehen; gewiß, das konnte kein Kleinigkeitskrämer, kein Krittler an einem Zeh im Staube. Auch hat es Winckelmann in den letzten Jahren seines abgeschnittenen unvollendeten Lebens bitter gefühlt und beklagt, daß sein Vaterland in manchen ihm zutönenden Stimmen sich nach deutscher Weise an die einzelnen kleinen Fehler des Werkes hielt und die Mühe und den Geist des Ganzen verkannte. Aber so ist es in Deutschland und so wird es bleiben.«
Aber so blieb es nicht, ganz im Gegenteil. Ein unseliger »Geist des Ganzen« ergriff rund 150 Jahre später fast die gesamte Nation, auch in ästhetischer Hinsicht total bis ins Groteske. Hitler als grausamer Graekomane bemächtigte sich in Winckelmann ausgerechnet einer Ikone der »Griechenliebe«; homoerotische Neigung übersetzte man in spartanische Körperzucht, vor allem im Umkreis der Olympiade 1936, künstlerisch monumental von Leni Riefenstahl und Arno Breker erfasst, aber im Kern längst auf Kriegstüchtigkeit ausgerichtet. Wegen seiner Kritik am französischen Stil wurde Winckelmann unter Hitler vorbildlich als Franzosenhasser, der einen »wahren Alexanderzug um Reiche der Seele und des Geistes« vollbracht habe, und der einstige Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom, Ludwig Curtius, nannte ihn 1941 bewundernd gar »einen der geistigen Diktatoren Europas«.
In Wahrheit war die Entdeckung der griechischen Welt um 1750 in ganz Europa im Gang. Während Winckelmann seine Träume träumte, schickte die englische Society of Dilettanti Kunstkenner in das wirkliche Land, um genaue Zeichnungen der verfallsbedrohten Kunstwerke anzufertigen. Das mächtige Werk von James Stuart und Nicholas Revett erschien ab 1762 in drei Bänden: »The Antiquities of Athens, measured and delineated« – und zusammen mit den Beschreibungen des mitreisenden Schriftstellers Richard Chandler sowie den Berichten auch parallel aus französischer Hand ließ sich allmählich der antike Klassiker der Landeskunde, Pausanias, nachvollziehen, konnte man griechischen Boden und griechisches Leben en détail erobern.
Wohl keine fremde Kultur ist derart penibel beschrieben worden wie die hellenische, keine fremdsprachige Literatur derart untersucht, angeeignet und geliebt und keine Kunst aus Stein derart imitiert worden wie die des alten Griechenland. Aber natürlich unterschieden sich die Nationen dabei charakteristisch. Während die Deutschen mit Winckelmanns Werk eine Art Evangelium erhielten, dem sie treu bleiben wollten wie ihrem Homer und ihrem Platon, hielten die Engländer sich an die Wirklichkeit: als Reisende und Zeichner, als Kunsthändler und Seemacht, als Räuber und Politiker. Ein englischer Geistlicher gilt als Begründer der modernen griechischen Archäologie. John Potter, Sohn eines Weißwäschers, war ähnlich begabt und von der Antike begeistert wie Winckelmann; sein zweibändiges Meisterwerk »Archaeologia graeca« von 1697/98 hielt sich als englisches Standardwerk bis zu den berühmten »Dictionaries« von William Smith im Jahre 1842. Potter brachte es bis zum Erzbischof von Canterbury; durch die deutsche Übersetzung seines Buches 1775/78 kam der Ausdruck »Archäologie« überhaupt erst nach Deutschland.
Nachrichten über Griechenland aus englischen Quellen hatten, anders als deutsche, gern etwas Abenteuerliches, wenn nicht Skandalöses an sich. Das begann 1786, als Goethe auf seiner Italienreise den britischen Botschafter im Königreich Neapel, William Hamilton, besuchte und den alten Kunstsammler mit einer jungen schönen Mätresse fand; zusammen hatten die beiden eine neue Kunstrichtung erfunden: griechischen Tanz, griechische Kleidung, lebendig ins Werk gesetzt nach den Vorlagen der hellenischen Vasenkunst, die Hamilton durch die Ausgrabungen von Herkulaneum und über den Kunsthandel in sein Haus brachte. Später verkaufte er seine große Sammlung dem Britischen Museum. Seine junge Frau Emma Hart, aus ärmlichsten Liverpooler Verhältnissen, machte mit Anmut und Geschick steile Karriere, nicht nur als Botschaftergattin, sondern um 1800 auch als Geliebte des Admirals Lord Nelson, zum Schrecken der hohen Gesellschaft diesseits und jenseits des Ärmelkanals. Europaweit umstritten war auch Lord Elgin, um 1800 Botschafter im osmanischen Athen, der große hellenische Architekturen kopieren, vor allem aber auch demontieren ließ. In einem Vertrag mit der türkischen Regierung, der sogenannten »Hohen Pforte«, ließ er sich bescheinigen, dass er nicht nur Abgüsse aus Gips herstellen, sondern sogar originale Stücke abnehmen konnte; schließlich dürfe man herrliche Kunst wie diese nicht verfallen lassen. Elgin barg oder nahm sich mehr als die Hälfte des berühmten Frieses aus dem Athener Parthenon, in dem der größte hellenische Bildhauer Phidias und seine Schüler die Schlacht bei Marathon unerhört modelliert hatten. Elgin verschiffte die Sammlung zusammen mit vielen anderen wertvollen Stücken 1803 nach England; aber wie unter göttlichem Zorn verschwand die Ladung bei einem Schiffbruch teilweise im Meer. Erst nach dreijähriger Arbeit und unter astronomischen Kosten konnten Taucher die Kunstwerke bergen. 1812 landeten schließlich achtzig Kisten mit den sogenannten »Elgin Marbles« in London. Erst vier Jahre später, nach umständlichen Verhandlungen, konnte der Lord sie endlich für 35.000 Pfund Sterling an das Britische Museum verkaufen; die Summe deckte angeblich nur die Hälfte der eigenen Kosten.
Der ganze Vorgang war unerhört. Während Lord Elgin die hellenische Welt partikelweise ins Europa der Christen brachte und damit ein Stück handgreifliche griechische Realität, wurde seine Transaktion heftig kritisiert. Man hielt ihn für einen Räuber; er hatte der griechischen Kultur ein zentrales, wenn nicht das wichtigste Zeugnis einstiger Größe zerstört. Scharfe Worte fand damals auch der skandalumwitterte Dandy Lord Byron, der Griechenfreund, Goetheverehrer und Dichter, dessen Versepos »Childe Harold’s Pilgrimage« im selben Jahr 1812 in zwei Gesängen erschienen war. Es war das romantisch verzweifelte Selbstporträt eines Reisenden ins Osmanische Reich, der natürlich auch bis zum Athener Parthenon kam und Klage erheben konnte.
Auch Goethe, der begeisterte Philhellene, hatte inzwischen mit einer Art Trauerarbeit begonnen. Mit seiner Anthologie über »Winckelmann und sein Jahrhundert« (1805) erinnerte er noch einmal an die grundstürzende Sehnsucht und die Leistungen dieses Kunstphilosophen. Das Buch wurde ein tiefgehender Abschied vom Griechentraum, denn im selben Jahr 1805 starb auch sein Freund Schiller, der mit ihm zusammen so vielfach der Antike gehuldigt hatte. Schon 1788, im Jahr der »Iphigenie«, hatte Schiller das erste ernüchterte Poem über die »Götter Griechenlands« verfasst: »Ausgestorben trauert das Gefilde, Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, Ach, von jenem lebenswarmen Bilde Blieb nur das Gerippe mir zurück«. Gemeint war damit aber nicht die ausgestorbene Kunstszene, sondern die rabiate Vertreibung der heidnischen Götter des Polytheismus durch den einen und einzigen Gott des Christentums. Schiller erntete Kritik und lieferte noch im letzten Lebensjahr eine weniger unchristliche Fassung: Die Pflege des entleerten Himmels war nun Sache der Poesie. Trauerarbeit leistete zur selben Zeit auch Wilhelm von Humboldt, damals Botschafter in der ruinenübersäten Hauptstadt Italiens. 1804 schrieb er an Goethe einen verdeckten Kommentar auf Lord Elgins Aktion: »Aber es ist auch nur eine Täuschung, wenn wir selbst Bewohner Athens oder Roms zu sein wünschten. Nur aus der Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß das Altertum uns erscheinen. Es geht damit wie wenigstens mir und einem Freunde mit den Ruinen: wir haben immer einen Ärger, wenn man eine halb versunkene ausgräbt; es kann höchstens ein Gewinn für die Gelehrsamkeit auf Kosten der Phantasie sein.«
Goethe hatte die Botschaft verstanden; nach Schillers Tod kam er zurück in die deutsche Gegenwart. Fast vierzig Jahre trennten ihn nun von Winckelmann, dem bewunderten, ja geliebten Kunstlehrer von einst, und es waren dramatische, hochpolitische Jahre gewesen. Hinter ihm lag die Französische Revolution, die er hasste, und der Aufstieg Napoleons, den er bewunderte. Im Jahr seiner denkwürdigen Begegnung mit dem französischen Kaiser erschien endlich das deutscheste Werk der deutschen Literatur, »Faust I«, im Druck: es war dieser Faust, seit 1775 als »Urfaust« bekannt, dann weitergeführt als »Faust. Ein Fragment« und als solches 1790 erstmals veröffentlicht. Nun also 1808 »Faust I« zum Abschluss der Werkausgabe beim Verleger Cotta gedruckt: keine Iphigenie mehr und kein Prometheus, sondern sehr zeitgenössisch eine Figur, die Goethe angeblich aus einem Mainzer Puppenspiel kannte, das ihn als Kind so begeistert hatte; nun also ein Mann als Heiratsschwindler und Mörder, ohne weiteren philhellenischen Glanz, dazu ein satanisches Abkommen und die Tragödie einer jungen Frau, verführt, zum Wahnsinn getrieben und schließlich als Kindsmörderin hingerichtet, wenn auch von einem christlichen Gott erlöst.
Lord Byron kannte und verfolgte Goethes Ruhm, konnte aber kein Deutsch und also erst einmal nichts original lesen. Er ließ sich berichten und spiegelte schließlich die Faustgeschichte auf seine Art in dem Versepos »Manfred. A Dramatic Poem« von 1817. Goethe war begeistert. Zwar hatte er schon vorher Gedichte von Byron gelesen, auch ansatzweise übersetzt; aber nun verfolgte er nahezu unaufhörlich das Werk des Jüngeren und notierte monatlich im Tagebuch seine Lektüren bis ins Todesjahr. »Manfred«, ein schuldbeladener, schwermütiger Wanderer in den Schweizer Alpen, der nach Vergessen sucht, zaubert wie Faust Geister heran, aber es sind Naturgeister, die sich nicht materialisieren wollen, allenfalls alle zusammen in einer herrlichen Frau. Sie erscheint, Manfred will sie umarmen, doch sie entschwindet. Das Leiden beginnt. Das Muster einer immer wieder seltsam misslingenden Liebe zu einem blendenden Phantom, bisher nur in der Volksliteratur, in Sagen und in Märchen zuhause, war in der hohen Literatur in England und in Deutschland angekommen.
Der britische Dichter lieferte damals ein Paradestück zur sogenannten schwarzen Romantik. Die Mischung aus Okkultismus, moralischer Selbstqual und individueller Hybris inspirierte selbst Goethe, den Feind aller romantischen Poesie. Und doch dauerte es noch zehn Jahre, bevor er ein Bruchstück seiner Fortsetzung des Dramas zu Faust II unter dem Titel »Helena. Klassisch-romantische Phantasmagorie« (1827) als »Zwischenspiel zu Faust« öffentlich machte. Auch hier gab es nun die Frau als hinreißendes Phantom, als griechische Erscheinung, ja sogar als Erscheinung Griechenlands in begehrenswerter klassischer Gestalt; nicht als teuflisches Blendwerk wie im altdeutschen Puppenspiel. Diese Helena würde schließlich die Figur eines gemarterten Gretchens und aller umgebenden Schuld vergessen lassen; und doch gehörten sie beide zusammen wie die Gesichter einer Herme. Oder womöglich nicht? Wer sich in der griechischen Mythologie auskannte wie der Dichter und viele seiner Leser auch, wusste natürlich zugleich, dass man mit dieser Figur eine sagenhaft schillernde Überlieferung bekam, ein episches Delta, eine personifizierte Verflechtung von Narrationen, die dem Dichter jederzeit Abweichungen und Ausflüge erlauben würde.
Die Arbeit an dem Phantom dauerte lange, der alte Goethe empfand es selber so. Aber sie endete bedeutungsschwer im Jahr der Befreiung Griechenlands, drei Jahre nach Byrons Tod in dieser Mission, 1827. »Wie ich im Stillen langmütig einhergehe werden Sie an der dreitausendjährigen Helena sehen, der ich nun auch schon sechzig Jahre nachschleiche, um ihr einigermaßen etwas abzugewinnen«, schrieb Goethe dem Freund Nees von Esenbeck, einem Meteorologen. Dabei handelte es sich bei seinen neuen Versen um eine ganz aktuelle Liebeserklärung an Byron, den mit Goethes Sohn August fast gleichaltrigen Freiheitskämpfer, der nun im Stück in Gestalt eines Kindes von Faust und Helena erschien: ein Euphorion als leuchtend, flirrend übermütiges Geschöpf mit einem frühen Tod.
Byron selbst hatte diesen Tod in Wirklichkeit auch gesucht; denn er hatte kein allegorisches, sondern ein völlig realistisches Bild von Griechenland. Anders als Goethe engagierte er sich schon früh im Freiheitskampf aus dem Geist von Katharina der Großen. 1823 brach er mit einem gemieteten Schiff namens Hercules von Genua auf, um den aufständischen Griechen beizustehen, die ihren Krieg dann doch erst vier Jahre später unter großen Opfern und mit Hilfe der europäischen Nationen gewinnen konnten. Byron starb bald nach seiner Ankunft 1824 in Missolonghi, dem Hafen einer entscheidenden Schlacht, nicht als Heldenkämpfer, sondern am Fieber. Die Griechen betrauerten ihn außerordentlich. Nicht nur bestattete man sein Herz in Missolonghi und setzte ihm ein Denkmal, der griechische Nationalpoet Dionysios Solomos verfasste sogar ein Gedicht auf ihn, Söhne wurden namentlich nach ihm benannt und selbst eine Stadt nahe Athen. Seine letzte und einzige unmittelbare Botschaft an Goethe war ein ergreifender Dankesbrief vom 23. Juli 1823:
»Erlauchter Herr – Ich kann Ihnen nicht gebührend für die Zeilen danken, die mein junger Freund Sterling mir von Ihnen übersandte, und es würde mir schlecht anstehen, Verse zu tauschen mit dem, der seit fünfzig Jahren der unbestrittene Herrscher über die europäische Literatur ist. – Sie müssen daher meinen aufrichtigen Dank in Prosa annehmen – und noch dazu in eiliger Prosa – denn ich bin wieder einmal auf einer Reise nach Griechenland – und umgeben von Hast und Unruhe, die kaum einen Augenblick selbst der Dankbarkeit und Bewunderung gestatten – Ich segelte vor einigen Tagen von Genua ab – wurde durch widrige Winde zurückgetrieben – bin dann wieder in See gestochen – und traf heute früh hier in (Livorno) ein, um einige griechische Passagiere für ihr im Kampf befindliches Land an Bord zu nehmen. – Hier auch fand ich Ihre Zeilen und Mr. Sterlings Brief vor – und kein günstigeres Omen und keine angenehmere Überraschung hätten mir zuteil werden können als ein Wort von Goethe, geschrieben von seiner eigenen Hand. – Ich kehre nach Griechenland zurück, um zu sehen, ob ich dort nicht irgendwie nützlich sein kann; – wenn ich jemals wiederkommen sollte, will ich Weimar einen Besuch abstatten, um die aufrichtige Huldigung eines Ihrer vielen Millionen Bewunderer darzubringen. Ich habe die Ehre, stets und ergebenst zu sein,
Ew. dankbarer Bew[underer] und D[iener]
Noel Byron«
Eine deutsch-englische Wahlverwandtschaft im Faustgebiet hatte es freilich schon lange zuvor gegeben, wenn auch nie so innig wie zwischen Goethe und Byron. Seit 1600 reisten englische Comedians mit einem Faustspiel durch die Lande, auch durch die deutschen; denn seit 1587 gab es das deutsche Volksbuch mit der »Historia von J. Fausten dem weit beschreyten Zauberer«, gedruckt zu Frankfurt am Main von einem Johan Spies. Zwei Jahre später erschien die »Tragical History of Doktor Faustus« des englischen Autors Christopher Marlowe, ins Deutsche übersetzt allerdings erst 1818 von Wilhelm Müller, einem der bekanntesten Philhellenen seiner Zeit, ein Dichter, der nicht nur Franz Schubert zu seinen Liederzyklen »Die schöne Müllerin« und »Die Winterreise« inspirierte, sondern auch zahllose Lieder für die Freiheitsbewegung schrieb und als »Griechenmüller« bekannt wurde. Goethe hat Marlowes Stück angeblich erst durch Müller kennengelernt; er selbst berief sich immer auf das Puppenspiel seiner Frankfurter Kinderzeit, »wo Faust in seinem herrischen Übermut durch Mephistopheles den Besitz der schönen Helena von Griechenland verlangt«. In beiden Versionen wird Faust für seinen Pakt mit Mephisto bitter bestraft und muss zur Hölle fahren; zur Urform gehören aber auch Faust und Helena als Eltern mit einem Sohn namens Justus, der früh stirbt oder verschwindet, wie dann auch Goethes Euphorion.
Als Goethe von Marlowe hörte, hatte es einen Faust für fromme Bürger schon länger auf deutschen Bühnen gegeben, nur stammte er nicht von Goethe, sondern vom theatererfahrenen August Klingemann, der das Stück im Hoftheater Braunschweig noch vor Goethes Tod zur Aufführung bringen sollte. Als Mitglied einer Theatertruppe nahm sich Klingemann Freiheiten heraus; er sah Faust zwischen einer Ehefrau Käthe und einer teuflisch maskierten Helena zerrieben. Die Uraufführung 1811 in Breslau mit Ludwig Devrient als Mephisto hatte europaweiten Erfolg. Offenbar war es ein Reißer geworden; farbig, grotesk und bombastisch. In London sah ihn auch einer der größten Goetheverehrer Englands, der historische Schriftsteller und Essayist Thomas Carlyle. Er hatte eigens Deutsch gelernt, aus Zuneigung zu den deutschen Denkern, vor allem zu Fichte. In Byrons Todesjahr sandte er Goethe seine Übersetzung von »Wilhelm Meisters Lehrjahre« und begann eine jahrelange Korrespondenz mit dem alten Dichter. Carlyle spielte damals für die deutsche Literatur eine ähnliche Rolle für England wie Madame de Staël für Frankreich, deren Essay »Über Deutschland« von 1813 ein ganzes Kapitel hingerissener Faustlektüre enthielt. Carlyle, von ihr angeregt, besprach und lobte alle möglichen zeitgenössischen deutschen Autoren. Mit größter Hochachtung schrieb er sogar eine Biographie über Schiller, und »Faust I« wie auch die Helena-Phantasmagorie wurden eingehend von ihm gewürdigt.
Goethe starb 1832. Nach seinem erklärten Willen erschien der zweite Teil des Faust, also »Faust II«, erst nach seinem Tode im Druck. Aufgeführt wurde er sogar erst 1856, nach dem Tod seines Gesprächsbruders Eckermann, der bis dahin als Treuhänder des Werkes galt. Goethes letzte Regieanweisung lautete: »Helenes Gewande lösen sich in Wolken auf, umgeben Faust, heben ihn in die Höhe und ziehen mit ihm vorüber.« Diese Helena ist nicht nur keine Hexe, sondern rettet im Gegenteil Faust vor der Verdammnis. In Englands frommer Gesellschaft wurde das immer wieder getadelt. Sollte die griechische Helena mit Faust womöglich die Deutschen retten – und wenn ja: wovor? Entrückung und Versöhnung gelingen hier jedenfalls im Zeichen der Meteorologie, der sich Goethe zum Ende seines Lebens widmete. In einem früheren Entwurf hieß es wahrhaft himmlisch: »Die Wolke steigt halb als Helena nach Süd-Osten halb als Gretchen nach Nordwesten.«
ZWEITES KAPITEL
1832
Der Staat als Ziel. Philhellenische Hilfe: Katharina II., die Grafen Orlow und Kapodistrias. Die Schweizer und Jean-Gabriel Eynard. Die Engländer und Lord Byron. Die Bayern und Otto I. Die Heimholungen Griechenlands im Roman, in Architektur und Kunst. Goethes Faust II als Oper.
Im Mai 1832, zwei Monate nach Goethes Tod und elf Jahre nach Beginn des Freiheitskampfes, erhielten die Griechen einen Staat. Zum ersten Mal seit der Antike sollte es wieder ein eigenes Land griechischer Sprache geben, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrtausend wäre es nicht mehr Teil eines christlichen Großreiches, sondern ein selbständig christlicher Staat, wenn auch mit langer nichtchristlicher Vorgeschichte, die immer noch kulturell alles zu überragen schien, was seit dem Römischen Reich mit der hellenischen Erbschaft geschehen war. In diesem Jahr 1832 wurde nach dem Beschluss der Großmächte Russland, England und Frankreich der Sohn des bayerischen Königs Ludwig I., der achtzehnjährige Otto I. inauguriert. Er durfte sich »König von Griechenland« nennen, nicht aber »König der Griechen« oder gar »der Hellenen«. Im Dezember reiste er von Brindisi in die vorläufige Hauptstadt Nauplion; die Regierung konnte er allerdings nur volljährig übernehmen, und erst 1841 war das Schloss in Athen überhaupt bezugsfertig. Es war das heutige Parlamentsgebäude, damals vom bayerischen Baumeister Friedrich von Gärtner errichtet.
Das Vorspiel zu dieser ganzen Inthronisierung, der griechische Freiheitskampf zwischen 1821 und 1827, war blutig verlaufen und keineswegs in Harmonie beendet worden. Er verdankte sich außer der russischen Initiative aus den 1770er Jahren unmittelbar dem Aufruhr der Französischen Revolution, deren Folgen vom Wiener Kongress unter Metternich nur mühsam und widerwillig mit nationalen Zugeständnissen gebändigt wurden. Aber die gebildete Welt stand aufseiten der Griechen, wenn auch durch einen Trugschluss vom alten Hellas auf das inzwischen osmanisch verwahrloste Land. Seit 1814 gab es mit Filiki Eteria und dem Verein der Philomusen aktive Geheimbünde einflussreicher Russen und Griechen in Odessa und Athen, teils politisch, teils nur kulturell aktiv, daneben aber auch unablässige Fürsprachen aus ganz Europa. Nicht nur Byron, der erstmals schon 1809 nach Griechenland gesegelt war, auch prominente Franzosen wie Benjamin Constant und Chateaubriand verlangten mit dringlichen Aufrufen öffentliche Teilnahme; deutschsprachige Philhellenen strömten heran, vor allem aus der Schweiz und aus Bayern und sogar aus den USA. Es waren Kämpfer und Ideologen, Christen und Sektierer, reiche und arme Leute, Abenteurer, Legionäre und gescheiterte Existenzen. Einer der Mitwirkenden, Wilhelm Barth aus Süddeutschland, hat ein penibles Verzeichnis mit biographischen Daten von rund 300 Teilnehmern aus Europa und den USA bis zum Jahr 1831 hinterlassen; es wurde allerdings erst 1961 im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart sorgfältig ediert und gedruckt.
Aus der Schweiz kamen damals besonders tätige Helfer wie etwa der Zürcher Redakteur Johann Jakob Meyer, der an der Seeschlacht von Patras teilnahm, in Missolonghi eine Apotheke eröffnete und mit der Ellinika Chronika die erste Zeitung in Griechenland begründete, finanziert von Lord Byron, wenn auch widerwillig, denn er meinte, in einem Land von Analphabeten könne eine Zeitung nicht wirklich nützen. Schweizerische Philhellenen wirkten nachhaltig auch aus der Heimat; es gab Aufrufe und enorme Spenden vor allem von Kirchenleuten – denn Griechenland stand ja mit seiner alten Sprache für das Neue Testament und die Korintherbriefe des Paulus, die Vorlagen der volkssprachlichen Übersetzungen von Luther und Zwingli. In dieser hellenischen Sprache wiederum konnten die Manuskripte, wie auch ihre Auslegung, dann in der byzantinischen Orthodoxie und in Konstantinopel seit dem 6. Jahrhundert überdauern. Selbst als die Türken 1453 diese Stadt eroberten und das Osmanische Reich entstand, verschwand das griechisch-orthodoxe Christentum keineswegs; man hatte schließlich jahrhundertelang im ganzen Gebiet Klöster gebaut, Mönche erzogen, Gemeinden gepredigt, Menschen getauft, verheiratet und begraben. Für die Hohe Pforte waren diese Bildungszentren und Priester Werkzeuge der Verwaltung. Christen, die in festen Gemeinden lebten, ließen sich zur Steuer zwingen, ebenso wie die Juden mit ihren Handelsplätzen.
Aber nicht nur Christenmenschen halfen dem griechischen Aufstand, sondern, fast wichtiger, Finanziers. Der junge Staat brauchte Geld in jeder Hinsicht. Nachdem ein erster Kredit aus England 1824 im Umfang von 800.000 Pfund Sterling höchstens zur Hälfte in Griechenland ankam, wegen grassierender Korruption auch bei den Gebern, und ein zweiter wenig später ebenfalls versickerte, verschaffte man dem Land 1834 erneut 60 Millionen französische Goldfrancs, von denen freilich allein 12 Millionen der Hohen Pforte gezahlt werden mussten. An irgendeine Rückzahlung in solcher Höhe war kaum zu denken. Die Zinssätze lagen zu hoch, ebenso die Ausgaben, Einkünfte waren zu spärlich. Die Parteien versuchten ohnehin sich zu bereichern, mit einigem Recht natürlich auch die bayerische Regierung in Athen, die ihre Beamtenschaft installieren musste und dabei die Kosten einer würdigen Repräsentation nicht scheute. Untadelig und denkwürdig blieb damals der wichtigste Finanzier des werdenden Griechenstaates, Jean-Gabriel Eynard, ein Bankier aus Genf, der 1841 die Griechische Staatsbank gründete und wie Byron und später Ottos Vater, der bayerische König Ludwig I., mit hohen privaten Summen einsprang.
Das ganze idealistische Unternehmen war von Anfang an mehr als riskant. Zwar herrschte unter den Freiwilligen zunächst Begeisterung, aber nur wenige Kämpfer konnten durchhalten. Geld, Leben und Gesundheit waren der hohe Einsatz; und viele, wenn nicht die meisten Nachrichten klangen bedenklich. Süddeutsche Zeitungen erhielten Berichte oder veröffentlichten Privatbriefe; manche lobten die Griechen, andere tadelten ihre Rohheit, manche hielten sie für bildungsfähig, andere für bockig oder feige. Soldaten ärgerten sich, dass »selten ein Grieche den Mut hat, eine Kanone abzufeuern, viel weniger sie zu richten versteht«, während andere verhältnismäßig zufrieden konstatierten: »Wir bekommen Brot, Fleisch und Wein von der Einwohnerschaft, müssen aber selbst kochen. Kleidung haben wir nicht erhalten; wir tragen unsere eigene immerwährend fort. Geld will uns der Gouverneur zu den notwendigsten Bedürfnissen, als Tabak, Wäsche, u. s. w. geben.« Aber nicht Lohn gab es, sondern immer mehr Ärger und Streit, auch aus sprachlichen Gründen, denn natürlich konnten die wenigsten Ausländer sich mit den Einheimischen verständigen. »Damals strömten die Freiwilligen aus allen Gauen Teutschlands zahlreich zu König Ottos Fahnen […] Mit Freude verliess man sein Vaterland, um nur auf dem Boden wandern zu können, der durch so mächtig erhabene Erinnerungen aus der Vorzeit geheiligt ist. […] Ein Jeder von uns trug den Keim irgendeiner Hoffnung im Herzen, und nach Werbenderart versäumte man nicht, diesen Keim durch Versprechungen zu hegen und zum Treiben zu bringen: Daher die Täuschung so vieler Philhellenen, daher das damit verbundene Heimweh so Vieler, das schrecklich langsam, aber sicher würgende Gift einer unheilbaren Gemüthskrankheit«, resümierte schließlich ein Jakob Keyer.
Enttäuschung musste es schon aus mehreren Gründen geben. Zum Kampf gekommen waren und geworben hatte man unvorbereitete, unausgebildete und schlecht ausgerüstete Freiwillige. Die Verantwortlichen zuhause und vor Ort hatten zwar vielleicht Homer gelesen, aber keine Ahnung von Topographie und Klima, geschweige denn von medizinischer Versorgung. »Die Sterblichkeit unter den Soldaten ist sehr groß«, schrieb ein Medizinstudent seinem Bruder; »Täglich ein, oft auch zwei Leichenbegängnisse … Wir haben kein Spital, das nur einigermassen eingerichtet wäre, keine Fornituren für unsere Kranken, und was noch das allerschlimmste, keine Mittel und keinen Weg, darin Änderung und bessere Einrichtungen zu treffen.« Tatsächlich starben die meisten Opfer wie Lord Byron an Krankheiten und nicht im Kampf.
Das eigentliche Hindernis einer Staatsgründung aber, stellte sich mehr und mehr heraus, war die griechischerseits oft fehlende, weil niemals verlangte Idee einer wirklich städtischen Gesellschaft mit Willen zur Kooperation oder gar mit Sinn für eine zentrale Verfassung; selbst die gemeinsame Sprache war ja kein wirklich soziales Band. 400 Jahre osmanischer Herrschaft hatten außer der kirchlichen Hierarchie wenig mehr als lokale Chefs, Clans und sogenannte Klephten, also Briganten hinterlassen. Das Unternehmen wirklich vorantreiben konnten damals – wie wohl noch heute – nur die Griechen in der Diaspora, die Auslandsgriechen, zahlenmäßig ohnehin den Einheimischen überlegen, in jedem Fall aber besser gebildet und wohlhabender als die Inländer. Aber selbst diese Anstrengungen wären ohne den aufstürmenden, internationalen intellektuellen Philhellenismus der Epoche vergebens geblieben. Katharina die Große hatte 1768 den ersten Aufruf verfasst und später im Testament sogar ihren Enkel Konstantin zum griechischen König bestimmt; Voltaire hatte eine Ode für sie und ein wütendes Stück gegen die Türken geschrieben. Die große Enzyklopädie von Diderot und d’Alembert widmete seit 1754 zahlreiche Artikel der griechischen Antike, wenn auch vielleicht noch mehr der römischen, die in Gestalt Italiens und mit Rom eine echte translatio imperii hinter sich hatte, was Griechenland natürlich unerreichbar war.
Tatsächlich hatte die Ideengeschichte zu diesem ganzen politischen Aufruhr schon lange zuvor mit Humanisten wie Martin Crusius und Erasmus Fahrt aufgenommen und sich um 1700 beschleunigt in dem bekannten Pariser Streit zwischen den Alten und den Modernen (Querelle des Anciens et des Modernes). Ging es hier meist noch um stilistische Fragen, wie etwa das Stilideal der simplicité, von Winckelmann später mit »edle Einfalt« übersetzt, wurde auf höherer Ebene schon mit andern Waffen gefochten. Alles Denkbare war an der griechischen Antike vorbildlich, und nicht zuletzt die staatliche Verfassung. Der Erzieher des Dauphin höchstpersönlich, François Fénélon, verfasste damals eine Satire, die Ludwig XIV. mit der Entlassung des Autors quittierte. Der Roman »Les aventures de Télemaque« von 1699 wurde zu einem europäischen Bestseller und unverzüglich ins Deutsche übersetzt. »Die seltsamen Begebenheiten des Telemach. Ein Staatsroman« erzählt in einem pseudohistorischen und zugleich utopischen Plot vom Sohn des Odysseus und dessen Lehrer Mentor (hinter dem sich die Göttin Athene verbirgt); die beiden reisen zusammen durch diverse Staaten, die meist durch Schuld ihrer von Schmeichlern und falschen Ratgebern umgebenen Herrscher zugrunde gehen: ein Spiegelbild für das kriegsverstrickte und verarmende Frankreich des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Mentor weiß aber Rat, indem er friedlichen Ausgleich mit Nachbarn empfiehlt, Wachstum und Förderung der Landwirtschaft anregt sowie Minderung der Luxusgüter. Ludwig XIV. verbot das Buch sofort nach Erscheinen, aber es kam in anderen französischen Ausgaben auch nach Brüssel und Den Haag und eroberte sich als Mischung zwischen Fürstenspiegel und Bildungsroman sein oft jugendliches europäisches Publikum.