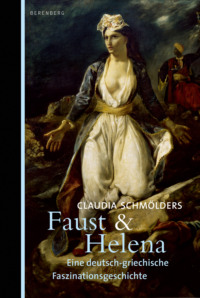Kitabı oku: «Faust & Helena», sayfa 4
Mit den Funden Schliemanns kam die ganze verwickelte griechische Mythologie ins Bewusstsein der europäischen, vor allem aber der deutschen Gesellschaft wieder zurück. Helena also: Atemberaubend schön, war sie nach der bekanntesten griechischen Sage das Opfer eines himmlischen Wettstreits, bei dem Göttinnen unrühmlich mitspielten, aber die Menschen nicht minder. Ein Königssohn namens Paris entführte die Frau des Menelaos angeblich nach Ilios oder Troja, in die heutige Türkei, vielleicht verschwand sie aber auch nach Ägypten, unter dem Schutz des Zeus, und ein Trugbild kam nach Troja, jedenfalls rüstete der Schwager Agamemnon die griechische Flotte zur Rückholung der Beute. Es wurde ein zehnjähriger Krieg mit grausamen Opfern; das Meiste darüber ist aus der Ilias des Homer bekannt.
Nun aber, im Jahr der realgeschichtlichen Ausgrabung von Troja, gerät Helena gleichsam leibhaft unter die Augen von Heinrich Schliemann. Aus tiefsten mythischen Nebeln taucht sie hier endlich auf, dieses ganz konkrete Objekt der Begierde eines wahrhaft faustischen deutschen Mannes, der auch noch wirklich Heinrich hieß. Schliemanns rastlose Karriere brachte die antike Traumfrau zum Greifen nahe, wie er glaubte, und zwar im Schatten ihrer Schmuckstücke. Die großen Funde von Troja und Mykene gehörten zwar nicht einer gemeinsamen Kulturepoche zu; denn Schliemann hatte ja eine rund zweitausend Jahre ältere Schicht, eine vormykenische Stadt Troja ergraben. Aber das stellte sich erst bei seinem Nachfolger Dörpfeld heraus. Erst einmal konnte der Ausgräber seinen Fund inszenieren. Der trojanische Schatz umfasste Tausende von Einzelteilen, darunter feinsten Schmuck, wie ihn Helena, falls es sie jemals gab, womöglich getragen hatte. Musste sich Schliemann nicht fühlen wie Goethes Faust auf dem Rücken des Chiron? Im eiligen Gespräch der beiden im zweiten Teil der Tragödie berichtet der heilkundige Kentaur ja, dass er Helena höchstpersönlich auf dem Rücken getragen und sie in seine Mähne gegriffen habe. Faust ist hingerissen, denn diese Mähne berührt ja nun auch er. Die Mähne als Fetisch: die Mähne als Analogie für den Schmuck. Ließ Helena sich mit einer Zeitmaschine von ferne berühren? Schliemann greift in die Verse Homers, der doch Helena wahrhaft näher stand als Goethe, und seine Mähne ist dieser Schatz. Später im Grabungsbericht wird alles sorgsam dokumentiert, wenn auch mit einigen Ungenauigkeiten, die von der Fachwelt alsbald registriert wurden. Natürlich inszenierte Schliemann alsbald eine Fotositzung, für den seine Frau Sophia das sogenannte »große Gehänge« einer Helena am trojanischen Hof anlegt, als »echte Griechin« und Nachkommin des homerischen Geschlechts – das alles mit geschickter Propaganda und weltweiter Wirkung aus einem erst vierzigjährigen jungen Griechenstaat heraus. Diese Helena/Sophia ist zwar nicht Frau eines südlichen Königs, wohl aber Gattin eines ostdeutschen Oligarchen, seinerseits geboren und aufgewachsen unweit von Stralsund, wo der Urvater der deutschen Hellasliebe, Johann Joachim Winckelmann, fast zwanzig Jahre gelebt hatte. Doch anders als der rastlose Schliemann hatte Winckelmann nie nach einer Helena gesucht, sondern war bis auf seltene Reisen in Italien sesshaft geblieben, meist in Rom, introvertiert und in mythisch schönen Männerkörpern befangen.
Bei aller deutschen Graekomanie – mit seinen pompös vermarkteten Grabungen ging Schliemann für die deutsche Fachwelt zunächst einmal wohl zu weit. Man tadelte und verlachte ihn und misstraute ihm. Der Berliner Papst der klassischen Philologen, Wilamowitz, soll in einer Satire Frau Schliemann gespielt haben, wie sie den Schatz in ein Tuch gewickelt von der Grabungsstätte getragen habe. Das Misstrauen der Philologen saß tief. Seit Gründung der Berliner Humboldt-Universität hatte man ja von oberster Stelle aus das Hellenentum in Gestalt der Gräzistik akademisch eingehegt und in diversen Instituten, wie etwa dem Deutschen Archäologischen Institut Athen, dann aber auch im humanistischen Gymnasium, glorifiziert und versäult. Hier kritisierte man an Schliemann noch lange den haut goût des Hochstaplers, des wütend ehrgeizigen Dilettanten und Aufsteigers. Der alte Schmidt in Fontanes »Frau Jenny Treibel« musste jedenfalls noch verteidigen, »dass jemand, der Tüten geklebt und Rosinen verkauft hat, den alten Priamus ausbuddelt«. Und wirklich: Fast rückhaltlose Bewunderung erhielt Schliemann zunächst einmal nur aus England; hier, im Londoner South Kensington Museum, durfte er seinen Fund 1877 ausstellen, bevor seine Frau und der Freund Rudolf Virchow ihn dazu brachten, den ganzen Schatz von mehr als achttausend Teilen 1881 dem Deutschen Reich zu schenken, durchaus zur Freude des Kaisers, der ja selber als Hobby-Archäologe tätig war. Pünktlich zu diesem Anlass erschien nun auch der voluminöse Bericht über das ganze Unternehmen, mit detailgenauen Zeichnungen, zahlreichen Fotos und Beiträgen namhafter Kollegen als Buch unter dem schlichten Titel »Ilios«, mit dem Untertitel »Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja«.
Abbildung 14 in diesem Band zeigte die »Allgemeine Übersicht des in 28 Fuss Tiefe gefundenen Schatzes«, der heute im Berliner Neuen Museum als Replik zu sehen ist: nämlich den Schlüssel der Schatzkiste, die goldenen Diademe, Stirnband, Ohrringe und kleine Juwelen; ferner silberne Talente und Gefäße von Gold und Silber; silberne Vasen und eine merkwürdige kupferne Platte; Waffen und Helmkronen von Kupfer oder Bronze; ein kupfernes Gefäß, kupferner Kessel mit zwei Henkeln, kupferner Schild. Unerhört penibel schildert und zeichnet Schliemann die eigentlichen Schmuckstücke, wie sie eine Trojanerin – Abbildung 688 – wohl getragen haben mag. Der Name Helena taucht im Text nicht auf, aber schließlich kam Helena ja auch aus Sparta und hätte in Troja also fremden Schmuck getragen, was bei einem zehnjährigen Exil in königlicher Umgebung wohl auch denkbar war. Schon Schliemann dachte bei seinen Beschreibungen damals aber auch an ägyptischen Einfluss; natürlich kannte auch er die antike Version der Helena-Sage, wonach ihr Entführer Paris nur ein trügerisches »eidolon« nach Troja gebracht habe, sie selbst aber sei vorsorglich von ihrem Vater Zeus nach Ägypten gerettet worden. Dem gleichsam doppelt fremden Schmuck später im Gräberfeld von Mykene widmete ein deutscher Archäologe namens Meurer 1912 eine sonderbar ausufernde schliemannkritische Studie. Er ließ an eine ägyptische Helena denken, wie sie in der Zeit zwischen den Weltkriegen zur Titelfigur einer Oper von Richard Strauss wurde, mit einem Libretto von Hugo von Hofmannsthal, uraufgeführt in Dresden 1928 und erneut bei den Salzburger Festspielen 1933. – Den echten »Schatz des Priamos« aus dem Hügel von Hissarlik, dann in Berlin, erbeuteten im Zweiten Weltkrieg sowjetische Soldaten; nach 1945 war er angeblich nicht wieder aufzufinden. Erst 1993, nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches, erfuhr die staunende Welt, dass er sich im Moskauer Puschkin-Museum befand, wo er seit 1996 auch wieder gezeigt wird. In Berlin sieht man bisher nur eine detailgetreue Kopie.
Was aber hatte Schliemann letztlich zu dieser archäologischen Raserei gebracht? War es wirklich, wie er in seinen autobiographischen Bemerkungen schrieb, eine allgemeine Begeisterung seiner kindlichen Umgebung für Homer, oder ganz besonders eine vom Vater geschenkte Weltgeschichte für Kinder? 1828 gab es zuhause den Band von Georg Ludwig Jerrer und der Vater hatte ihm daraus vorgelesen. Mit wem konnte man sich dabei identifizieren, mit Agamemnon oder Aeneas oder Herakles oder eben Odysseus? Als der junge Sigmund Freud das berühmte Buch »Ilios« über die Ausgrabungen lesen konnte, war er begeistert, nicht nur von den Griechen, sondern auch von Schliemann. Dieser Mensch hatte eine untechnische, geistige, nämlich sprachliche Entdeckung gemacht, er hatte eine vergangene Wirklichkeit hinter den Buchstaben entdeckt; er hatte in der Tiefe der Geschichte gegraben und sich nicht mit der Oberfläche einer Fiktion begnügt. Mehr als fünfzig Jahre später sollte Freud eine Reise nach Athen beschreiben, die er 1904 zusammen mit seinem Bruder unternommen hatte. Freud erinnerte sich in dem Text, den er »Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis« nannte, wie sonderbar er es nach der Ankunft auf der Burg plötzlich fand, dass nun alles greifbar und vorhanden war, was sie als Kinder bei Homer gelesen hatten und was erst recht Schliemann bekräftigt hatte. Auf den ersten Blick schien Freuds »Störung« also nur eine Abwehr Schliemanns, dessen Abenteuerlust ja gerade mit Finderglück belohnt worden war; aber der zweite Blick offenbarte dann doch tiefen Sinn für das archäologische Verfahren, wenn Freud später etwa die Stadt (Rom) zum Modell der menschlichen Psyche erhob, in der sich Analytiker grabend bewegten, jeder ein Schliemann, und oft auch mit strahlenden Funden belohnt.
Warum aber dieser Schliemann, der doch eigentlich Geschäfte mit Farben und Stoffen und Kriegsmaterial machte, der an der Börse unaufhörlich rechtzeitig kaufte und verkaufte, dessen Briefe von finanztechnischen Details wimmeln, von Verlustängsten gepeinigt, warum also dieser Mann sich in die griechische Antike nicht nur zurücksehnte, sondern regelrecht eingraben wollte wie in ein Pharaonengrab, ist oft erörtert worden. Fontane hat es leise parodiert. Nicht nur seine Frau »Jenny Treibel« will ja möglichst nur Handfestes, selbst der alte Schmidt des Romans meint beim Anblick der ›Agamemnon‹-Maske: »wenn ich mir vorstelle, dass diese Goldmasken genau nach dem Gesicht geformt wurden, gerade so wie wir jetzt eine Gesichts- oder Wachsmaske formen, so hüpft mir das Herz bei der doch mindestens zulässigen Idee, daß dies hier – und er wies auf eine aufgeschlagene Bildseite – daß dies hier das Gesicht des Atreus ist oder seines Vaters oder seines Onkels …« Wieder drängt sich der Fetischcharakter der Funde ins Bild, ihr Koeffizient an Wirklichkeit und Gegenwart, die weder Kunst noch Literatur bieten können. Aber womöglich die Sprache darunter?
Die Welt der alten Griechen aus dem Munde Homers zum Greifen nah: eine solche Intuition mochte Schliemann vielleicht wirklich als Junge aus Ankershagen gehabt haben; inzwischen kannte er aber doch auch die leidenschaftlichen Diskussionen, die Goethes Zeitgenosse Friedrich August Wolf im Jahr 1795 ausgelöst hatte. Wolf erörterte damals die These des italienischen Kulturphilosophen Vico, wonach es den einen und einzigen Homer vielleicht nie gegeben habe, wonach diese grandiosen Epen, Ilias und Odyssee, womöglich in mündlicher Tradition von vielen Sängern überliefert und bis zur schriftlichen Fixierung auch immer weiter verbessert worden seien. Einer wie Schliemann konnte aber beweisen, dass hinter dem Namen Homer ein Historiker stand, kein phantastischer oder gar phantasierender Sänger oder gar eine Gruppe von Sängern. Er konnte, vor allem aber wollte er es beweisen. Und denkbar ist, dass ausgerechnet seine Sprachwut ihn dabei leitete. Als er 1856 in Petersburg bei dem jungen Vimbos Griechisch lernte, war in dessen Kreisen das linguistische Todesurteil über die griechische Sprache sicher gespenstisch bekannt; eben Jakob Fallmerayers Verdikt von 1830. Inzwischen, mit Gründung des Staates und der unermüdlichen Patronage von Adamantios Korais, hatte man die Katharevousa ja eingeführt, ein modernisiertes Altgriechisch, eine Mischung, die natürlich auf Anhieb keineswegs überall gleichmäßig angewandt wurde. Wiederholt hat Schliemann in seinen Erinnerungen beschrieben, dass er genau solch ein Verfahren selber erprobt und sich angeeignet hatte. Nur ist bei ihm niemals die Rede von diesen innergriechischen Debatten und der Name »Katharevousa« fällt nicht. Ob ihn an Fallmerayers Text etwas ganz anderes gereizt hatte? Dort nämlich standen ja die wuchtigen Sätze, die Schliemanns kindliche Vorstellungen zermalmen wollten und zugleich zeigten, wie man sie in Erfüllung gehen lassen konnte, nämlich durch Grabung: »Eine zweifache Erdschichte, aus Trümmern und Moder zweier neuen und verschiedenen Menschenrassen aufgehäuft, decket die Gräber dieses alten Volkes. Die unsterblichen Werke seiner Geister, und einige Ruinen auf heimatlichem Boden sind heute noch die einzigen Zeugen, daß es einst ein Volk der Hellenen gegeben habe. Und wenn es nicht diese Ruinen, diese Leichenhügel und Mausoleen sind; wenn es nicht der Boden und das Jammergeschick seiner Bewohner ist, über welche die Europäer unserer Tage in menschlicher Rührung die Fülle ihrer Zärtlichkeit, ihrer Bewunderung, ihrer Tränen und ihrer Beredsamkeit ausgießen: so hat ein leeres Phantom, ein entseeltes Gebilde, ein nicht in der Natur der Dinge existierendes Wesen die Tiefen ihrer Seele aufgeregt.«
VIERTES KAPITEL
1871 bis 1897
Neue Nachrichten aus Athen. Schliemann zwischen Homer und Darwin. Hellas als Hölderlins »Mutter aus dem Grabe«. Ernst Curtius träumt olympisch. Jacob Burckhardt schimpft. Nietzsche sieht »gräcisierende Gespenster«. Freud träumt begehrlich wie Faust, aber Hella/Helena ist seine Tochter. Nietzsches »wahre Helena« bei Richard Wagner. Die olympischen Spiele.
Während nun also Schliemann mit seinem tollkühn erworbenen Privatvermögen seit 1871 die Ausgrabungen im Hügel von Hissarlik, in Mykene und schließlich auch auf Kreta betrieb, hatte der griechische Staat vierzig dramatische Jahre hinter sich. Wie zu erwarten, waren die drei Großmächte Russland, England und Frankreich im Land als Parteien bei Hofe etabliert, die um Einfluss sowohl beim König wie bei den einheimischen Machthabern rangen, die ihrerseits mehr Mitsprache und eine neue Verfassung wünschten. Die »Bavarokratie« unter Otto I. erregte immer mehr Unmut, und 1843 musste der König der Einsetzung eines Parlaments zustimmen. Zugleich wuchsen die Schulden, trotz der großen Kredite, die seit 1821 gewährt worden waren. Ein erster drohender Staatsbankrott 1847 konnte nur durch die private Mitwirkung des Genfer Bankiers Jean-Gabriel Eynard abgewendet werden. Aber es kehrte keine Ruhe ein. Der kostspielige Staatsapparat wuchs, weil die einheimischen Freiheitskämpfer mit Recht ihren Lohn, sprich ihre Versorgung einforderten; das Militär wuchs mit Blick auf Gefahren aus der Türkei, aber auch in der irredentistischen Hoffnung auf griechische Territorien, die seit alters zum Land gehört hatten. Schließlich verschlangen Hofhaltung und bayerische Beamtenschaft sinnlose Summen. 1863 wurde Otto I. zur Abdankung gezwungen; ihm folgte ein König aus dänischem Haus, Georg I., im Amt bis zu seiner Ermordung 1913, vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Als eine Art Morgengabe hatte er Griechenland die bis dahin britischen Ionischen Inseln zurückgebracht und mit dieser Geste Englands Einfluss im Parlament bekräftigt. Russischer Einfluss wiederum wurde durch Georgs Heirat mit einer Romanow gestärkt: Olga, die um die Jahrhundertwende mit einer dramatischen Episode in die neugriechische Geschichte einging. Damals brach der schon lange schwelende, nun aber veritable Sprachenstreit um die offenbar lähmende Herrschaft der Katharevousa aus; die Dichter fühlten sich behindert, weil sie das Volk nicht mehr erreichen konnten. Überhaupt fühlte die neue Generation der um 1830 geborenen Griechen sich vom Hellenismus ihrer Eltern weniger erhoben als gefesselt, auch wenn gerade dieser philhellenische Furor sie doch aus ihrer osmanischen Gefangenschaft befreit hatte. Man sei »vom Wahn der Antike befallen; nicht von der Kenntnis der Antike, sondern der ständig und überall betriebenen oberflächlichen, unpassenden und unbegründeten Beschwörung der antiken Vorfahren …«, schrieb Kostis Palamas, ein maßgeblicher Autor der Literaturszene um 1900; man gebrauche eine »makkaroniartige, pseudohellenische Sprache«, die dem Volk fremd sei und habe »vollständig jedes Gefühl für die Realität verloren.« In dieser Situation agierte Königin Olga aus dem Hause Romanow zusammen mit den Sprachkämpfern von unten. Da sie während des letzten griechischtürkischen Krieges verwundete Soldaten gepflegt hatte, wusste sie, dass einfache Menschen die Bibel in der alten Hochsprache nicht verstehen konnten. Auf ihre Anregung und sogar mit ihrer Beteiligung wurde das Neue Testament in Dimotiki übersetzt, ja, sie versuchte sich sogar selber an einer Übersetzung. Ein Sturm kam auf; die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Theotokis wurde gestürzt, der Erzbischof von Athen protestierte und trat zurück. Selbst das Parlament entschied gegen die Königin. Bei Strafe verboten wurden fortan eigenmächtige Übersetzungen der Bibel und die vorhandenen Exemplare wurden eingezogen. Die Katharevousa als Schriftsprache blieb buchstäblich im Amt bis zum Ende der Junta und dem der griechischen Monarchie 1976. – Auch die Schulden blieben, trotz neuer Verfassung und neuem König. 1863 wurden erneut Auslandsanleihen aufgenommen; als größter Gläubiger erwies sich schließlich das Deutsche Reich. 1893 kam es zum Staatsbankrott, ausgelöst durch eine unglücklich eingetretene und ungeschickt gehandhabte landwirtschaftliche Panne in der Korinthenausfuhr. Ein internationales Finanzkonsortium wurde beauftragt, die Schuldentilgung fortan im Land zu überwachen: also gab es schon damals eine Art Troika unter deutscher Dominanz. Tatsächlich hat Griechenland dann aber trotz größter Kriegswirren seine Schulden bis 1931 bedient.
In diesen sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts, während Schliemann gerade mit seinem Studium an der Sorbonne begann, erregte das erste Buch von Charles Darwin, »Über den Ursprung der Arten« (1859), weltweit Erschrecken wie Bewunderung. Ein kalter naturwissenschaftlicher Blick vereinte Menschen und Tiere jenseits der biblischen Schöpfungsgeschichte; ein übergreifendes Narrativ gewann atemberaubende Präsenz. Stammte der Mensch wirklich vom Affen ab? Gab es konkurrierende Rassen im Kampf um biologische Dominanz in geschichtlichen Zeiten, waren die »Arier« oder womöglich gar die »Achäer« wirklich das physisch auserwählte Volk? Rudolf Virchow, der einzige einflussreiche Freund Schliemanns in Deutschland, der Begründer der Zellphysiologie und damit natürlich auch Biologe und Rassenforscher, bemühte sich um humane Maßstäbe. So etwa setzte er eine Massenuntersuchung in Deutschland bei sieben Millionen Schulkindern durch, die nach physischen Merkmalen wie Haarfarbe und Konstitution durchmustert wurden. Nur ein Drittel war blond und blauäugig, die Mehrheit aber gemischt. Von einer »arischen« Dominanz konnte keine Rede sein. Schliemann ließ Virchow die hellenischen Schädel begutachten, die bei den Grabungen gefunden wurden, und Virchow versah sie mit dem zögernden Befund, dass man zwar, gemessen am Schädelindex sowie der gesamten Kopf- und Gesichtsbildung, vielleicht »an Leute der arischen Rasse zu denken« habe, dass aber »der Naturforscher vor diesen Problemen Halt machen und die weitere Erörterung der archäologischen Betrachtung überlassen« müsse.
Aller behutsamen Einschränkung zum Trotz – wenige Sätze haben die hellenistische Begeisterung in der Folge so kontaminiert wie diese, jedenfalls in Deutschland. Sie befeuerten den Verdacht oder die Hoffnung, das ganze unerhörte »griechische Wunder« sei in Wahrheit ein »arisches«. Es war eine Hoffnung auf antiken Ursprung, auf eine gigantische Familiengeschichte im Zeichen Homers, die nicht nur in der hartnäckigen Rassendiskussion weiterlebte und im »Dritten Reich« zu aberwitziger Prominenz gelangte, vielmehr gab es sie ja schon seit Jahrzehnten auch als Sprachillusion. Der Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voss, der den antiken Hexameter und Pindars Metrik in die deutsche Verskunst einführte, der begeisterte Hölderlin, die Brüder Schlegel, vor allem aber Wilhelm von Humboldt, der Begründer des deutschen Gymnasiums: Sie alle fanden in der griechischen Sprache einen ähnlichen Abgott wie einst Winckelmann in der bildenden Kunst. Die Sprache überhaupt, meinte Humboldt, sei »ein absichtslos aus der freien und natürlichen Einwirkung der Natur auf Millionen von Menschen, durch mehrere Jahrhunderte, und auf weiten Erdstrichen entstandenes Erzeugnis« und damit »eine ebenso ungeheure, unergründliche, geheimnisvolle Masse, als das Gemüt und die Welt selbst, mehr, wie irgendetwas andres hervorzubringen imstande ist.« Und in diesem romantischen Überschwang auf der Suche nach indogermanischen Vorfahren sah man schließlich die genuine Verwandtschaft zwischen deutscher und altgriechischer Sprache, also eben auch zwischen deutschem und hellenischem Denken. Es entstand ein ethnisches Phantasma, ein deutschhellenischer Avatar, der über eine »Ehe«, wie etwa die Assoziation eines Faust mit einer Helena, weit hinausging und sich trotz wissenschaftlicher Mühen und realer politischer Feindschaften nicht gänzlich dekonstruieren ließ. Im Gegenteil, durch Denker wie Martin Heidegger und dessen Verliebtheit in vorsokratische Wortwurzeln sollte es unversehens ins 21. Jahrhundert überdauern.
Dabei gab es in diesen sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts gleichzeitig auch einen europäischen Aufschwung der hellenistischen Wissenschaft, oder genauer: der Wissenschaften im Plural zwischen Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte und Philologie. Doch deutsche Forscher nahmen den Faden nicht auf. Der Kunsthistoriker und Gräzist Carl Justi verfasste vielmehr um 1860 eine dreibändige Biographie über Winckelmann und erneuerte dessen Ruf als epochal deutschen Genius schon mit dem ersten und abschreckend unbeholfenen Satz: »Die Erscheinung Winckelmanns steht gleichsam an der Pforte, die aus der Verknöcherung und Geschmacklosigkeit der vorhergegangenen Zeiten hinüberführt in den unserer Erinnerung so teuren Bezirk, wo die bei den neuern Völkern herumgehende Leitung der geistigen Bewegung an Deutschland kam: seine Werke gehören zu den Erstlingen des deutschen Genius …« Justis Kollege Walter Pater aus Oxford reagierte immerhin sofort und setzte Winckelmann fast gleichzeitig in einem glänzenden Essay ein englisches Denkmal, natürlich auch dem männlichen Genie gewidmet. Aus der Schweiz dagegen meldete sich der Rechtshistoriker Johann Jakob Bachofen mit einer großen Studie über das altgriechische »Mutterrecht« (1861), der sogenannten »Gynaikokratie« – also Frauenherrschaft, für Bachofen die ursprüngliche gesellschaftliche Verfassung. Das Werk wurde zunächst vergessen, aber um die Jahrhundertwende als Vorläufer einer philosophischen Anthropologie hoch geschätzt.
Viele Monate vor Schliemanns erster amtlicher Grabung, aber im selben Jahr 1871 wurde Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt, und in Griechenland kam Ioannis Metaxas zur Welt, der spätere griechische Diktator zur Hitlerzeit. Die deutsche akademische Archäologie widmete im folgenden Jahrzehnt ihre ganze Energie nicht etwa Troja und Homer – das Feld hatte Schliemann besetzt –, sondern der Ausgrabung des antiken Olympia, inspiriert vom antiken Pausanias. Es war ein territorialer Reflex auf den preußischen Sieg über die Franzosen und die Reichsbildung. Unter Leitung von Ernst Curtius führte man ein Projekt durch, dessen Gedankenschmied eher als überragend gebildeter Philhellene galt, denn als Mann des Augenscheins und der Lokaltermine, auch wenn es einige wenige gab. Anders als der fieberhafte Autodidakt Schliemann hatte Curtius – von 1844 bis 1850 Erzieher des späteren Kaisers Friedrich III. und Professor in Berlin – schon seit Anfang der fünfziger Jahre umfassend gelehrte Zielvorstellungen für die Erschließung der gesamten griechischen Kultur des 6. Jahrhunderts entwickelt. Zum Heiligtum von Olympia, hieß es nun, seien damals die meisten griechischen Stämme gekommen; Olympia habe für nationale Einheit gesorgt, auch wenn das Land später dann durch die Perserkriege zersplitterte. Die Erforschung dieser heiligen Stätte und ihrer Rituale würde einen ganzen Kulturkreis erhellen. Curtius rechnete auf die Unterstützung des Hofes, er gehörte nicht zu den Revoluzzern von 1848 wie etwa Jacob Grimm, dem damals berühmtesten Sprachforscher Deutschlands.
Den entscheidenden Vortrag hielt Curtius 1852 in der Berliner Singakademie. Er begann mit einem Rückblick auf die überlieferte Landeskunde von Pausanias, ging weiter über die französischen Ausgrabungen bis zu seinen eigenen Recherchen, die er von diversen Reisen ins Landesinnere wie auch nach Athen mitgebracht hatte. Aufgrund dieser Kenntnisse, aber noch ohne Grabungen, entwarf Curtius einen topographischen »Plan von Olympia«. Er sprach über die Begeisterung der Griechen für den Wettkampf und rühmte das agonale Element der hellenischen Bildungswelt. Man habe die »harmonische Ausbildung aller natürlichen Kräfte« angestrebt und Erziehung hin bis zum Götterdienst im Zeichen des Olymps ausgerichtet. In und mit Olympia als einem »geistigen Mittelpunkt« hätten die Griechen sich als »einiges Volk fühlen« gelernt. Das Kultbild des Zeus vom Bildhauer Phidias habe den Höhepunkt griechischer Kunst und »nationalen Vermögens« bezeichnet. Den letzten Teil der Rede widmete Curtius einer Beschreibung des gesamten Festes, den Riten, den prachtvollen Feiern, der allgemeinen Lebenslust. Mit Beginn des Peloponnesischen Krieges 431 freilich verfiel die Euphorie mehr und mehr, Niedergang folgte für die zweieinhalbtausend Jahre danach.
Schon Winckelmann hatte die Ausgrabung angeregt, französische Forscher hatten Versuche angestellt, aber seither war nichts geschehen. Curtius rief pathetisch nach einem Schliemann, als den er sich selber dachte: »man hörte auf zu suchen, ehe man zu finden aufgehört hatte. Von neuem wälzt der Alpheios seinen Schlamm über den heiligen Boden und wir fragen mit gesteigertem Verlangen: wann wird sein Schoß wieder geöffnet werden, um die Werke der Alten an das Licht des Tages zu fördern! Was dort in der dunklen Tiefe liegt, ist Leben von unserem Leben. Wenn auch andere Gottesboten in die Welt ausgezogen sind und einen höheren Frieden verkündet haben, als die olympische Waffenruhe, so bleibt Olympia doch auch für uns heiliger Boden und wir sollen in unsere […] Welt herübernehmen den Schwung der Begeisterung, die aufopfernde Vaterlandsliebe, die Weihe der Kunst und die Kraft der alle Mühsale des Lebens überdauernden Freude.«
Gefördert wurden die ambitiösen Projekte vom deutschen Hof, erst von Kaiser Friedrich III., der trotz seiner Krankheit – er litt an Kehlkopfkrebs – oder vielleicht sogar ihretwegen das Olympia-Projekt unterstützte, dann von Wilhelm II., der es gegen den Willen Bismarcks finanzierte. Die eigentliche Ausgrabungsstätte besuchte Curtius später nur zweimal für ein paar Wochen. Er war weder ein kunsthistorischer Archäologe noch ein erfahrener Ausgräber, ähnlich wie Schliemann. Trotzdem hielt er in Berlin immer wieder Vorlesungen zur Griechischen Kunstgeschichte und vermittelte seinen romantischen Philhellenismus über Jahrzehnte. Die Buchausgabe erschien in sechs Auflagen – und wurde zum Konkurrenten des gleichzeitig in Basel dozierenden Schweizers Jacob Burckhardt. Burckhardt, der Lehrer von Nietzsche, der Italienkenner und Renaissance-Spezialist, berühmt für seinen »Cicerone« durch die südliche Kunstwelt, hatte das Pamphlet von Fallmerayer nicht vergessen. Er warf das neue und durch zeitgenössische Ärgernisse eher hässliche Bild des realen Griechenlands zurück in die Antike und ließ seinen Erben Sätze zurück, die noch zu Beginn der 1930er Jahre Unmut stiften konnten: »In betreff der alten Griechen glaubte man seit der großen Erhebung des deutschen Humanismus im vorigen Jahrhundert im Klaren zu sein; im Widerschein ihres kriegerischen Heldentums und Bürgertums, ihrer Kunst und Poesie, ihres schönen Landes und Klimas schätzte man sie glücklich, und Schillers Gedicht ›die Götter Griechenlands‹ faßte den ganzen vorausgesetzten Zustand in ein Bild zusammen, dessen Zauber noch heute seine Kraft nicht verloren hat. Allermindestens glaubte man, die Athener des perikleischen Zeitalters hätten Jahraus Jahrein im Entzücken leben müssen. Eine der allergrößten Fälschungen des geschichtlichen Urteils, welche jemals vorgekommen, und umso unwiderstehlicher und überzeugter sie auftrat. Man überhörte den schreienden Protest der ganzen überlieferten Schriftwelt, welche vom Mythus an das Menschenleben überhaupt beklagt und verschätzt war, und in betreff des besondern Lebens der griechischen Nation verblendete man sich, indem man dasselbe nur von den ansprechenden Seiten nahm und die Betrachtung gerne mit der Schlacht von Chaironeia abschloß. Ganz als wären die folgenden zwei Jahrhunderte, welche das Volk, und weit überwiegend durch sein eigenes Tun, bis nahe an die materielle Zernichtung führten, nicht die Fortsetzung des Vorhergegangenen gewesen.«
Jacob Burckhardt demolierte im Sinne von Fallmerayer das begehrenswert schöne Bild, das in Deutschland trotz aller Kenntnisse über die Griechen entworfen wurde – und jenseits der abgründigen Metapher, die Goethe mit dem himmlischen Paar »Faust und Helena« geliefert hatte. Dass dieses Bild immer weiter schön bleiben wollte, mochte aber auch mit einer ganz anderen Phantasie zu tun haben, jenseits von Rassenkunde und Sprachverwandtschaft, zwei Phantasmen, die einem energischen Realisten wie Schliemann jedenfalls fremd sein mussten. Fremd waren ihm, als einem weltweit agierenden Geschäftsmann, die rassistischen Spekulationen ohnehin, seine griechische Frau war weder blond noch blauäugig noch altadelig, sondern eine Nichte seines griechischen Sprachlehrers. Nicht also diese unbefangene, unmythische Sorte von Ehe zwischen einem deutschen Faust und einer griechischen Helena lag in der deutschen Luft, sondern eine eher unheimliche Idee territorialer Landung und Bergung. Ging es beim Werben um Griechenland um Figurationen wie Iphigenie und Odysseus – um Ankünfte, nur ohne vorgängige Reise oder Entführung? Es wäre deutsche Wertarbeit am Mythos, vielleicht absichtslos oder missverstanden, aber doch eine Entstellung. Hölderlin wäre ihr Ahnherr; Sigmund Freud mochte die Stelle gelesen haben, im Zuge der frühen psychoanalytischen Diskussion, denn Rückkehr in den mütterlichen Schoß bildete offenbar schon um 1800 eine deutsche Matrix der gelehrten Erinnerung wie hier des Hyperion: »Mich ergriff das schöne Phantom des alten Athens, wie einer Mutter Gestalt, die aus dem Totenreiche zurückkehrt.«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.