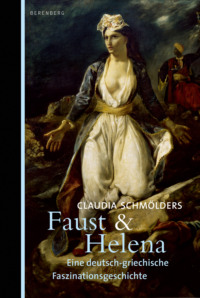Kitabı oku: «Faust & Helena», sayfa 3
Ähnlich graekophile Geschichten folgten in Deutschland und inspirierten die griechischen Freiheitskämpfer ihrerseits. Goethes »Werther« (1774) fühlte und handelte zwar ganz zeitgenössisch deutsch, konnte aber dennoch von Homer wie von einem Großvater schwärmen; während Christoph Martin Wielands »Geschichte des Agathon« (1767–1777) in einem fiktiven Hellas spielte und tatsächlich 1814 vom Direktor der Smyrna-Schule, Konstantin Kumas, ins Neugriechische übersetzt wurde. Ein Jahr vor der Revolution erschien dann in Frankreich »Die Reise des jungen Anachasis in Griechenland« (1788) des Archäologen Jean-Jacques Barthélemy, begonnen 1757 und 1819 ebenfalls ins Griechische übersetzt. Auch und gerade dieser Bericht hat sich europaweit verbreitet und wurde bis 1893 ununterbrochen aufgelegt. Noch im 20. und 21. Jahrhundert wurde der Plot von Künstlern und Dichtern erwidert, zuletzt 2014 von Marlene Streeruwitz: »Die Reise einer jungen Anarchistin in Griechenland«, nun also erstmals von einer Frau geschrieben und von einer Frau handelnd. Im Original ging es dabei um einen sogenannten »edlen Wilden«, einen jungen Skythen, Sohn des berühmten skythischen Philosophen Anacharsis, der durch ganz Hellas reist und rückblickend die Gebräuche, die Regierung, die Kunstwerke, die Sprache, Dichtung und das ganze ihm eigentlich fremde, nun aber gegenwärtige Land schildert, um zeitgenössischen Lesern eine mehrschichtige Kenntnis zu liefern. Es wurde eine Art Sachbuch; eine spätere Ausgabe enthielt sogar noch genaue Karten für Zeitreisende zum 4. Jahrhundert vor Christus. Auch dieses Buch traf mit seinem revolutionären Horizont ins Herz des griechischen Aufstands, denn der wichtigste Anführer, Rigas Velestinlis, lieferte eine neugriechische Übersetzung des vierten Bandes mitsamt persönlichen Anmerkungen. Doch wurde der Autor von der Zensur erfasst, verhaftet und in Bukarest hingerichtet.
In diesen Jahren konnten deutsche Leser also, neben dem immer noch unübertroffenen antiken Pausanias, ganz reale Ortsbeschreibungen des antiken Hellas wie auch des gegenwärtigen Griechenland von Autoren wie Pierre Guys und Richard Chandler lesen; und wenn Goethes Werther von seiner Homerlektüre schwärmt, galt das nicht unbedingt einer originalsprachlichen. Auch den herrlich illustrierten Reisebericht von Gabriel de Choiseul-Gouffier, einem Diplomaten und Althistoriker, konnten die von Winckelmann aufgeweckten Geister schon 1782 studieren, jedenfalls den ersten Band seiner »Voyage pittoresque de la Grèce«, um sich mit den dort beschriebenen Zuständen des gegenwärtigen Landes unter osmanischer Herrschaft zu befreunden, sie mindestens zur Kenntnis zu nehmen, wenn das nicht schon Chandler ein paar Jahre zuvor gelungen war. Choiseul-Gouffier war Botschafter an der Hohen Pforte von 1784 bis 1791; mit der Französischen Revolution, die er erbittert bekämpfte, verlor er den Posten und seine Besitztümer. Er floh nach Russland, wo man ihn zum Direktor der Akademie der Künste und der kaiserlichen Bibliothek ernannte. Katharina die Große schenkte ihm Ländereien in Litauen; 1802 kehrte er nach Frankreich zurück, 1809 erschien der zweite Band, und als der dritte 1822 posthum erschien, war der Freiheitskampf der Griechen schon in vollem Gang.
Im Dezember 1821 nämlich war in Nea Epidauros eine erste griechische Nationalversammlung zusammengetreten; und im selben Jahr exkommunizierte das Patriarchat von Konstantinopel auf Befehl der Hohen Pforte alle Aufständischen. Auf welche Tradition wollten die aufsässigen Griechen sich jetzt berufen? Nicht nur die politische Abspaltung eines Landes aus einem Großreich, auch der Konflikt zwischen einer heidnischen Antikenverehrung und einer über tausendjährigen christlichen Orthodoxie im byzantinischen Reich war unausweichlich. Tatsächlich nahm die Kirche in Konstantinopel ihre Glaubenskinder erst nach Ottos I. Abdankung 1863 wieder zurück; dabei hatte eine 1833 eigens einberufene Synode von Athen ohnehin die griechische Kirche für autokephal erklärt und damit die Freiheitsbewegung gestärkt. Es war eine plausible Maßnahme, denn nur so war die Zustimmung der Landbevölkerung zu erreichen. Allein die Propaganda eines idealistisch gebildeten, womöglich sogar protestantischen Philhellenentums hätte die ungebildeten Einwohner auf dem Lande und in den Bergen niemals wirklich beeinflusst. Eindruck gemacht hätte hier allenfalls das griechische Militär mit seiner Hoffnung auf Wiedergewinnung des alten byzantinischen Reiches mit Konstantinopel am Horizont; man sprach hier von der sogenannten »Megali Idea«, von dem großgriechischen Reich, die das politische Handeln des neuen griechischen Staates dann bis 1922 teils glücklich, teils desaströs tatsächlich bestimmen sollte.
Doch vorerst trugen Klephten und Clans ihre Streitigkeiten trotz fremder Mächte weiter aus wie bisher und wollten sich keiner Zentralgewalt unterwerfen. Nach einer katastrophalen Niederlage in Missolonghi 1826 kam es im Oktober 1827 zur entscheidenden Schlacht im Hafen von Navarino; die europäische Flotte versenkte fast alle Schiffe des ägyptischen Sultans Mehmet, der dem Osmanischen Reich noch einmal zu Hilfe gekommen war. Ein Protokoll hielt die Kapitulation der Türkei fest, und im April wurde schließlich Graf Ioannis Kapodistrias aus Korfu, ein erfahrener Politiker in russischen Diensten, Mitglied von Filiki Eteria und Gründer des Vereins der Philomusen, zum ersten Präsidenten einer ersten Verfassung gewählt. Mit zahlreichen Maßnahmen versuchte er eine Zentralverwaltung gegen die widerspenstigen Provinzherren durchzusetzen, wurde aber 1831 von griechischen Clanchefs ermordet. Gerüchte kursierten, es sei ein englischer Hinterhalt gewesen, um Russland keinen zu großen Einfluss auf das griechische Geschick zu lassen; andere Gerüchte besagten im Gegenteil, er sei das Werkzeug Russlands geblieben, und wieder andere verdächtigten ihn, selbst König werden zu wollen. Lulu Gräfin Thürheim, die ihn 1817 in Karlsbad kennenlernte, beschrieb ihn jedoch in ihren Erinnerungen ungemein beeindruckt: »Es ist dies ein bescheidener Mann, dessen Charakter und Verstand ihm jedoch die Herrschaft über alle geben, mit denen er verkehrt; sein durchdringender und schwermütiger Blick offenbart von Haus aus die Seele eines Philosophen, der über alles nachgedacht und erkannt hat, dass nichts auf dieser Welt großen Wert besitzt. Sein griechischer Akzent (er ist Korfe) verleiht seiner Aussprache etwas Fremdes und Graziöses, das mit der Ruhe seiner Bewegungen, seiner originellen Beredsamkeit und der Harmonie in seinem ganzen Wesen übereinstimmt und ihn in meinen Augen ganz anders erscheinen lässt, wie die übrigen Leute von Geist, mit denen ich bisher zusammentraf. Nichts verrät an ihm den Günstling. Capo d’Istria wäre vollkommen liebenswert, wenn er um zehn Jahre älter wäre, denn mit seinen kaum vierzig Jahren und seinem reizenden Lächeln und Augen, wie ich sie noch nie so schön gesehen habe, könnte er etwas weniger ernst und mehr jung sein.«
Trotz oder wegen andauernder Spannungen im Lande einigten sich die Großmächte in einem zweiten Londoner Protokoll nun auf den jungen bayerischen Kronprinzen Otto von Wittelsbach, der von seinem Vater ohnehin schon in leidenschaftlicher Griechenverehrung erzogen worden war. Mit Otto kamen an die sechstausend Helfer ins Land, teils Soldaten, teils Beamte, teils einfach Abenteurer oder gebildete Freunde des Landes, von denen viele später ebenfalls zu Beamten erhoben wurden. Es wurde eine erste Begegnung der Deutschen mit der griechischen Realität in sozialer, politischer und kultureller Hinsicht; und es wurde eine oft zermürbende, teils von rücksichtslosem Herrschaftswillen, teils aber auch von großem Idealismus getragene Koexistenz. Faust und Helena, mochte man meinen, versuchten sich endlich in einer Ehe, deren Stifter inzwischen gestorben war. Um dem antiken Ideal näher zu kommen und das Land mit Verstand zu regieren, brauchte man Juristen, Soldaten, Lehrer, Architekten, Dichter und Maler. Verwaltung, Bildung, Militär, Rechts- und Sozialwesen mussten eingerichtet werden; und das Leitbild gab dabei natürlich der bayerische Staat unter Ludwig I. ab, dessen Griechenliebe schon bis ins »y« im Landesnamen von Bayern hineingereicht hatte. Zu den bekanntesten deutschen Kulturhelfern der neuen Athener Regierung zählten damals neben dem Pädagogen Friedrich Thiersch, dem engagierten Lehrer von Otto, auch der Architekt Friedrich Wilhelm von Gärtner, Erbauer des Athener Schlosses und Kollege von Leo von Klenze. Klenze galt wie Gärtner als Ludwigs Hofarchitekt; mit seinen zahlreichen Bauten in München sollte und wollte er ein zweites Athen herstellen; selbst die sogenannte Walhalla in Regensburg spiegelte trotz ihres germanischen Namens das Parthenon. Klenze war zwar stärker als Gärtner hellenistisch inspiriert, aber dennoch kein verträumter Griechenfreund wie sein größter Konkurrent aus Preußen, Karl Friedrich Schinkel. Dieser glanzvolle Baumeister und schließlich sogar Oberbaurat des gesamten Landes war Philhellene durch und durch, dazu ein begabter Maler und Bühnenbildner, auch wenn fast die Hälfte seiner Entwürfe blieben, was sie waren. 1825 widmete er sein letztes großformatiges Gemälde namens »Blick in Griechenlands Blüte« dem griechischen Freiheitskampf; es zeigte halbnackte junge Männer beim Tempelbau nach den Regeln griechischer Architektur. Und nun, anlässlich des bayerischen Regierungsantritts, entwarf er auf Anregung des preußischen Kronprinzen einen Palast, der eine Akropolis völlig umgestalten sollte, die Schinkel selber nie gesehen hatte. Die Ruinen von Parthenon, Propyläen, Erechtheion und Niketempel sollten abgeräumt und in Gärten integriert werden. Erwartungsgemäß kritisierte Leo von Klenze die umfangreichen Pläne heftig und erfolgreich als »Sommernachtsträume« und meinte, die welthistorische Athener Akropolis dürfe allein Sache der Archäologen sein.
Wirklich gehörte Schinkel, wie die meisten preußisch protestantischen Philhellenen im 19. Jahrhundert, zu den Auslandsfreunden, die sich aus zweiter und dritter Hand über die leibhafte Wirklichkeit Griechenlands informierten. So etwa hatte er ausgiebig das Werk der Engländer Stuart und Revett studiert, das für die Zwecke eines Architekten wie geschaffen war, da es die genauesten Maßangaben und Zeichnungen einschließlich der antiken Grundrisse enthielt und damit ohne weiteres in architektonische Lehrbücher und Sammlungen architektonischer Entwürfe eingehen konnte. Europäische Baukunst war für Schinkel gleichbedeutend mit griechischer Baukunst, im Sinne Winckelmanns und nach der Devise, »das Notwendige der Construction schön zu gestalten«. Aber Schinkel begeisterte sich eben auch für phantastische Architektur; an die vierzig Bühnenbilder stammen von ihm. 1816 hatte er mit seiner Berliner Ausstattung von Mozarts »Zauberflöte« Goethe für sich gewonnen; es waren zwölf herrlich orientalisierende Bühnenbilder, darunter das sternenübersäte Pantheon für den Auftritt der »Königin der Nacht«.
Keinen anderen Opernkomponisten hat Goethe in Weimar so häufig aufgeführt wie Mozart; zwischen 1791 und 1813 wohl fast dreihundertmal; darunter die Zauberflöte mit 82 Aufführungen am häufigsten. Dass Goethe selber eine Fortsetzung zu der Oper verfasst hat, ist fast vergessen, dabei gab es schon seit 1795 erste Entwürfe, die auch gedruckt, aber nie aufgeführt wurden. Angeblich fand Goethe keinen Komponisten dafür; angeblich hatte Mozarts Librettist, Emanuel Schikaneder, eine eigene Fortsetzung gedichtet. Goethes »Zauberflöte II« hatte seltsamerweise nur ein Thema: das Kind, das Pamina und Tamino sich wünschen und gezeugt haben, und das schließlich nach einer Irrfahrt als »Genius« aus einem Sarg gerettet wird, während die Kinder von Papageno und Papagena aus drei Vogeleiern schlüpfen. Das Motiv des bedrohten, geraubten, verschleppten oder gar getöteten Kindes gehörte zu Goethes Schlüsselphantasien. Seit der realistischen Kindsmordepisode aus »Faust I« stand das nahezu alchemistisch gezeugte Knäblein Otto aus den »Wahlverwandtschaften« von 1808 in seinem Horizont, und präsent war Goethe natürlich beständig auch das Knäblein Justus aus dem faustischen Puppenspiel in Frankfurt. Das Geschöpf, welches später als Euphorion in »Faust II« abenteuerlich umhertanzt, ähnelt dem Schicksalskind aus der Zauberflöte II bedeutsam. Denn auch diese Zauberflöte II durchzieht ein Hauch von paradoxer, weil mythologischer Naturwüchsigkeit, wenn der Nachwuchs vom Vogelfänger, der ja selber kein Vogel ist, aus Eierschalen springt. Es war eine Anspielung auf Helena, die nach der Sage von einem schwangestaltigen Zeus gezeugt und von der Mutter Leda in einem Ei geboren wurde, zusammen mit Zwillingen, den Dioskuren. Zugleich wird in diesem Libretto auch höhere Weisheit bemüht, die Weisheit der Freimaurer, die schon Mozarts Komposition erfüllt. Der Mythos von Isis und Osiris steht hinter den Zeilen und den erahnten Noten; das Kind dieser beiden ist kein anderer als Horus, das Götterkind, der oberste Gott der ägyptischen Religion. Gab es also hinter Faust und Helena ein hochkulturelles, orientalisches Muster, ein Muster, das zwar nicht auf Erlösung, wohl aber auf Versöhnung der Gegensätze aus war? So wollten es spätere Erben der goetheschen Spätwelt verstanden wissen, als es um den Grundstein der sogenannten »Anthroposophie« gehen sollte; so hat es auch seit 1956 dann Katharina Mommsen dokumentiert, die dem Herzstück der west-östlichen Goetheforschung ein Lebenswerk gewidmet hat.
Dass auch Goethe sich seinen »Faust« überhaupt als Oper vorstellen konnte, ja ausdrücklich wollte, ist bekannt; auch und gerade »Faust II« erfüllt ja nach den Regieanweisungen die Liebeshöhle des Hohen Paares mit Komposition: »vielstimmige Musik« erklingt zur Geburt des Euphorion. Das musikalische Publikum und die Komponisten folgten der Anregung. Noch zu Goethes Lebzeiten gab es ein halbes Dutzend Vertonungen, in Frankreich wie in Deutschland, auch unter Goethes Mitwirkung. Bis hin zu Thomas Manns Dr. Faustus, dem Tonkünstler, war Goethes Drama eben auch Tonkunst, ergötzendes Klangschauspiel, mit den ausschweifenden Möglichkeiten der Verskunst und den harmonischen Möglichkeiten eines wohltemperierten Systems – und damit also auch mit den Hoffnungen auf eine erlösende Koexistenz von Faust und Helena und allem, was sie an scharfen Kontrasten eigentlich personifizierten.
DRITTES KAPITEL
1832 bis 1871
Nachrichten aus Weimar, Wien, Athen. Die neue Sprache Katharevousa. Jakob Philipp Fallmerayer als linguistischer Scharfrichter. Sprachenlernen als »furchtbare Passion«: Auftritt Heinrich Schliemann. Die unglaubliche Laufbahn eines ostdeutschen Pfarrerssohns. Heinrich und der »Schatz des Priamos«; Heinrich und Helena: das Traumpaar des deutschen Hellenismus.
Die politische Realität hinter dem Harmoniebegehren von 1827, dem Jahr des griechischen Triumphs und der goetheschen »Helena«, sah aber natürlich ganz anders aus. Bei aller Liebe zu Musik und Dichtung und zum alten Griechenland schätzte Goethe die Lage eher realistisch ein. Am 2. April 1829 brach es im Gespräch mit Eckermann geradezu prophetisch aus ihm heraus: »›Ich will Ihnen ein politisches Geheimnis entdecken‹, sagte Goethe heute bei Tisch, ›das sich über kurz oder lang offenbaren wird. Kapodistrias kann sich an der Spitze der griechischen Angelegenheiten auf die Länge nicht halten, denn ihm fehlet eine Qualität, die zu einer solchen Stelle unentbehrlich ist: er ist kein Soldat. Wir haben aber kein Beispiel, daß ein Kabinettsmann einen revolutionären Staat hätte organisieren und Militär und Feldherrn sich unterwerfen können. Mit dem Säbel in der Faust, an der Spitze einer Armee, mag man befehlen und Gesetze geben, und man kann sicher sein, daß man gehorcht werde; aber ohne dieses ist es ein mißliches Ding. Napoleon, ohne Soldat zu sein, hätte nie zur höchsten Gewalt emporsteigen können, und so wird sich auch Kapodistrias als Erster auf Dauer nicht behaupten, vielmehr wird er sehr bald eine sekundäre Rolle spielen. Ich sage Ihnen dieses voraus; es liegt in der Natur der Dinge und ist nicht anders möglich.‹«
Dass der griechische Aufstand den ehemaligen russischen Gesandten Kapodistrias plötzlich in die Rolle eines Napoleon versetzen könnte, wie nun 1827 durch die revolutionären Zustände im Osmanischen Reich, muss Goethe tatsächlich erschreckt haben. Er hatte den Grafen zwei Jahre zuvor in Weimar kennengelernt; ein junger Schützling der »Philomusen« – dem Bildungsverein des Grafen – studierte damals in München und übersetzte hingebungsvoll Goethes »Iphigenie« ins Griechische. Genauer, er übersetzte das berühmteste Stück des deutschen Philhellenentums in die neugriechische Kunstsprache Katharevousa, die der Schriftsteller Adamantios Korais erfunden hatte und dem jungen Staat einprägen wollte. Es war eine idealistische und zugleich ganz realpolitische Initiative. Das Motiv der auch sprachlich gradlinigen Abstammung aus dem alten Hellas befeuerte natürlich nicht nur die gebildeten Ausländer, sondern vor allem die griechischen Intellektuellen selber; auf dem Weg zu einer nationalen Wiedergeburt wollte man die Dialekte hinter sich lassen, die im osmanischen Vielvölkerstaat zwangsläufig entstanden waren. Das Experiment gelang nur halb, denn anders als in Israel, wo das zurückeroberte Hebräisch tatsächlich eingebürgert werden konnte, blieb die Katharevousa als eher förmliche Schrift- und Amtssprache nur bis 1976 erhalten, nur wenig länger als die griechische Monarchie. Seither wird eine gehobene Alltagssprache namens Dimotiki benutzt, die aber durchaus antike Herkunft erkennen lässt.
Es war absehbar, dass es mit der Gründung eines griechischen Staates auch zu heißen Kämpfen um die zukünftige Sprache – vor allem die Amtssprache – kommen musste: schließlich gehörte das klassische Griechisch der gesamten antiken Literatur zur Ahnenreihe eines Weltreiches noch unter Alexander dem Großen und lange danach auch im Römischen Reich. Die alte Sprache trug das identitätsbildende Narrativ des Volkes und einst real existierenden Landes, nach dem sich auch eine neugriechisch sprechende Iphigenie sehnen mochte. Goethes Stück wurde also 1818 von einem jungen Studenten namens Papadopoulos übersetzt. Aber wer konnte dieses Griechisch im neuen Land schon sprechen, verstehen oder schreiben? Trotzdem war die Einsetzung der Katharevousa das Gebot der Stunde, denn tatsächlich brach der schärfste Kritiker der soeben mühsam errungenen Staatlichkeit genau in diese offene Flanke. Zielgenau im Jahr 1830 veröffentlichte ein Südtiroler Historiker eine Schmähschrift gegen das zeitgenössische Griechenland in Gestalt einer linguistischen Untersuchung. Jakob Philipp Fallmerayers »Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters: ein historischer Versuch« begann mit folgenden Sätzen: »Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet. Schönheit der Körper, Sonnenflug des Geistes, Ebenmaß und Einfalt der Sitte, Kunst, Einfalt, Stadt, Dorf, Säulenpracht und Tempel, ja sogar der Name ist von der Oberfläche des griechischen Kontinents verschwunden […] Denn auch nicht ein Tropfen ächten und ungemischten Hellenenblutes fließet in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands. Ein Sturm, dergleichen unser Geschlecht nur wenige betroffen, hat über die ganze Erdfläche zwischen dem Ister und dem innersten Winkel des peloponnesischen Eilandes ein neues, mit dem großen Volksstamme der Slaven verbrüdertes Geschlecht von Bauern ausgegossen. Und eine zweite, vielleicht nicht weniger wichtige Revolution durch Einwanderung der Albanier in Griechenland hat die Szenen der Vernichtung vollendet.«
Wen also würde ein deutscher Faust im Athen des Jahres 1832 in den Armen halten, überhaupt welche Frau wäre wirklich Griechin mit hellenischem Stammbaum? Grausamer als mit Fallmerayers Worten konnte man die desaströse Vertreibung der Helena aus den Phantasien deutscher Philhellenen nicht beschreiben. Ob der alte Goethe jemals davon erfuhr? Es ist nicht bekannt.
Fallmerayer hatte in längeren Reisen durch das Land vor allem Namenkunde betrieben, geographisch wie sozial, und dabei eine völlige Dominanz der slawischen Sprachen festgestellt. Seine gehässige Formulierung galt der idealistischen Emphase nicht nur von Leuten wie Adamantios Korais, sondern eben auch der ganzen philhellenischen Begeisterung in Bayern, die Fallmerayer in München, wo man ihm eine Professur überlassen hatte, aus nächster Nähe kennengelernt hatte. Auch wenn die Forschung inzwischen fast alles widerlegt hat, was der Professor im Brustton der Überzeugung behauptet hatte, seine brutal rassistische Auslassung sollte nie wieder aus dem Magazin der Griechenkritiker wie auch der Eugeniker verschwinden. Im Gegenteil, sie gewann mit der Epoche Darwins immer mehr Fahrt, um spätestens 1941 in den Köpfen der deutschen Wehrmacht und schließlich auch sinngemäß bei Hitler zu landen.
Gespenstisch daran war nicht zuletzt, dass die Tirade einen gewissen Vorlauf mitten aus der innigsten literarischen Liebeserklärung der Deutschen besaß. Schon 1810 sprach der Geographielehrer von Schillers Söhnen, Friedrich August Ukert, in seinem landeskundlichen Werk über das Griechenland seiner Zeit von »den entarteten Nachkommen« der Hellenen, die er erforscht habe, »um zu sehen, ob das gesunkene Geschlecht, das mit so vielen fremden Völkern vermischt ward, so lange unter dem Druck roher und harter Beherrscher seufzte, noch den alten Griechen ähnlich zu nennen sei«. Freiheitliche Hoffnungen hatten Ukert zu seinem Werk getrieben, dessen liebevolle Detailfreude damals unübertroffen war; wer es las, konnte sich in Griechenland zuhause fühlen. Für ein idealistisches Publikum gespenstisch musste aber auch schon der Vorgänger dieser Meinungsschmiede sein. Es war ausgerechnet Hölderlin, der schon ein Dutzend Jahre vor Ukert seinen Hyperion sagen lässt: »Ich will, sagt ich, die Schaufel nehmen und den Kot in eine Grube werfen. Ein Volk, wo Geist und Größe keinen Geist und keine Größe mehr erzeugt, hat nichts mehr gemein, mit andern, die noch Menschen sind, hat keine Rechte mehr, und es ist ein leeres Possenspiel, ein Aberglauben, wenn man solche willenlose Leichname noch ehren will, als wär ein Römerherz in ihnen. Weg mit ihnen! Er darf nicht stehen, wo er steht, der dürre faule Baum, er stiehlt ja Licht dem jungen Leben, das für eine neue Welt heranreift. Alabanda flog auf mich zu, umschlang mich, und seine Küsse gingen mir in die Seele.«
Wenigstens gab es nicht nur den griechischen Aufrührer Alabanda in diesem Roman, sondern eben auch eine Diotima. Mit ihr erinnerte Hölderlin namentlich an die einzige und überragende weibliche Figur aus den Dialogen des Sokrates, wo sie die mystische Theorie der Liebe erläutert – und nun also auch Hyperion zur Nächstenliebe auffordert: »Ich bitte, dich, geh nach Athen hinein, noch einmal, und siehe die Menschen auch an, die dort herumgehn unter den Trümmern, die rohen Albaner und die andern guten kindischen Griechen, die mit einem lustigen Tanze und einem heiligen Märchen sich trösten über die schmähliche Gewalt, die über ihnen lastet – kannst du sagen, ich schäme mich dieses Stoffs? Ich meine, es wäre doch noch bildsam. Kannst du dein Herz abwenden von den Bedürftigen? Sie sind nicht schlimm, sie haben dir nichts zu leid getan. Was kann ich für sie tun, rief ich. Gib ihnen, was du in dir hast, erwiderte Diotima …«
»Hyperion«, dieser Briefroman über den allerersten griechischen Befreiungskampf, erschien in zwei Bänden zehn Jahre nach der Französischen Revolution. Napoleon war Erster Konsul geworden und unterwegs zum Kaisertum. Mit der historisch viel älteren Szene des Romans erinnerte Hölderlin an die Seeschlacht von Tschesme im Auftrag Katharinas, unter Leitung des Grafen Orlow 1770. Zwar besiegten damals die Russen die Türken, aber der Aufstand im Land der Griechen misslang – und dieses Misslingen hielt der Roman nun auch seiner eigenen Gegenwart vor. Napoleons Aufstieg bedeutete das Ende der Freiheit in Frankreich wie auch in Deutschland, dem der wohl schneidendste Satz des Romans galt: »Es ist ein hartes Wort und dennoch sag’ ichs, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen – ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergossne Lebensblut im Sande verrinnt?«
Hölderlins Roman wurde trotz aller Liebe zum Traumvolk nicht in die neugriechische Katharevousa übersetzt. Der einzige Grieche, der dazu fähig gewesen wäre, Rigas Velestinlis, wurde 1798 hingerichtet; und als es 1832 endlich einen Staat mit kulturellen Ambitionen gab, hatte anderes Vorrang.
Fallmerayers Tirade empörte jedenfalls das gesamte philhellenische Feld. Im Nu machten die Sätze die Runde, bis hin zu Ludwig I., der dem Autor die Professur entzog. Auch die Griechen selber protestierten und bestärkten ihre Forschungen zur byzantinischen Kontinuität des Hellenentums. Eine der herausragenden und beispielhaften Figuren in dieser Gesellschaft war der Theologe Theoklitos Farmakides. Nach einem Studium in Istanbul, Jassy und Bukarest wurde er 1811 geweiht und dann nach Wien geschickt, wo er bis 1818 als Priester wirkte. Hier lernte er Latein, Französisch und Deutsch, wurde Mitglied der Filiki Eteria und Mitherausgeber der Zeitschrift »Hermes Ho Logios«, einem Sprachrohr von Adamantios Korais. Damit war Farmakides ein entschiedener Verteidiger der Katharevousa. Am griechischen Aufstand nahm er ab 1821 teil; als Mitglied der ersten Nationalversammlung wurde er ab 1825 Herausgeber der »Allgemeinen Zeitung von Griechenland«, dem späteren Amtsblatt der Regierung und unter Otto I. treibende Kraft bei der Synode von 1833. 1837 erhielt er den Lehrstuhl für Theologie an der neuen Universität Athen. Zweifellos kannte er das Pamphlet des Griechenfeindes Fallmerayer, und womöglich war es auch Thema des Unterrichts.
Unter seinen Studenten muss damals jedenfalls ein gewisser Theodorus Vimbos aus Athen gewesen sein, später Bischof dortselbst und Erzbischof von Mantineia. Im Jahr 1856 verdiente sich Vimbos noch Geld als Sprachlehrer vorübergehend in Petersburg. Unter seinen Schülern war ein prominenter deutscher Geschäftsmann, der seit Ende des Krimkrieges als reichster Mann der Petersburger Börse galt. Er hieß Heinrich Schliemann – und der Moment, in dem er den jungen Vimbos traf, war schicksalsträchtig. Ihn, den eingefleischten Geschäftsmann, hatte nämlich nach eigener Auskunft eine unerhörte Sprachpassion erfasst. Fast verzweifelt schrieb er im Dezember 1856 seiner Tante Magdalena nach Kalkhorst: »Wissenschaften und besonders Sprachstudium sind bei mir zur wilden Leidenschaft geworden, und jeden freien Augenblick darauf verwendend ist es mir gelungen, in den zwei letzten Jahren noch die polnische, slavonische, schwedische, dänische sowie im Anfang d. J. die neugriechische Sprache fertig zu erlernen, so daß ich jetzt 15 Sprachen geläufig spreche u. schreibe. Die furchtbare Passion für Sprachen, die mich Tag und Nacht quält und mir fortwährend predigt, mein Vermögen den Wechselfällen des Handels zu entziehen u. mich entweder ins ländliche Leben oder in eine Universitätsstadt wie z. B. Bonn zurückzuziehen, mich dort mit Gelehrten zu umgeben u. mich ganz und gar den Wissenschaften zu widmen, ist jetzt schon seit Jahren in blutigem Kampf mit meinen zwei anderen Leidenschaften, dem Geiz und der Habsucht …«
Zwei Jahre später hatte er genügend Neu- wie auch Altgriechisch gelernt, um eine erste große Reise nach Athen anzutreten; aber die Geschäfte, vielleicht auch die Reichtumsgier eines Schatzgräbers und überhaupt Geltungssucht fesselten ihn und seine Ursehnsucht noch zwölf Jahre, bevor er in der Türkei nach Homer zu suchen und zu graben begann.
Heinrich Schliemann, geboren 1822 in Neubukow, Mecklenburg, aufgewachsen in Ankershagen, jammervoll gestorben auf einer Straße in Neapel, war ein kultureller Oligarch, wie ihn die Welt oder mindestens die deutsche bis dahin noch nicht gesehen hatte. In einen ärmlichen Pfarrhaushalt verschlagen, mit einem offenbar brutalen, aber kenntnisreichen Vater gestraft, verlor er früh die Mutter und musste schon mit vierzehn als Handlungsgehilfe arbeiten. Aber er war der Arbeit physisch nicht gewachsen. Nach Missgeschicken auf See kam er mit zwanzig in Amsterdam in einem Handelskontor unter; hier lernte er zwar Handel treiben, fühlte sich aber unterfordert und lernte Sprachen gleich schockweise: erst Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch, später Russisch. Offenbar war niemand in seiner Umgebung darüber erstaunt. 1846 ging er nach Petersburg und baute ein Imperium auf; schon 1854 galt er dort als Börsenmagnat, und das erst recht, als ihm der Krimkrieg 1854–1856 das Vermögen noch einmal verdoppelte; er hatte rechtzeitig Waren für das Militär eingekauft. Aber nun machten Geschäfte ihm keine Freude mehr; er fürchtete beständig Verluste und träumte nur noch von Bildungsreichtum. Inzwischen hatte er Reisen quer durch Europa und bis nach Amerika absolviert, Schwedisch und Polnisch gelernt, bis er in Petersburg auf Theodorus Vimbos traf, den Mann seiner Träume. Mit ihm entwickelte er eine eigene Methode, lernte erst Neu-, dann Altgriechisch und verständigte sich wenn nötig mit einer Mischung aus beidem. Es vergingen aber noch weitere zehn Jahre mit Geldverdienen, Reisen und Sprachenlernen in Asien und im Orient, ehe er sich 1866 in Paris niederließ, um ein Studium aufzunehmen. Alle möglichen Fächer wurden erwogen, aber die Antike reizte ihn dann offenbar doch am meisten. 1868 kam er zum ersten Mal über Italien zur Peloponnes und in die Türkei nach Hissarlik, wo nach Meinung einiger Fachleute und gebildeter Dilettanten Troja, die berühmteste Stadt aus Homers »Ilias« liegen musste. Mit dem Bericht über diese Reise promovierte Schliemann 1869 an der Universität Rostock; im selben Jahr heiratete er die blutjunge Griechin Sophia Engastromenou, eine Nichte seines Griechischlehrers. Zwei Jahre später hatte er sich endlich mit den türkischen Behörden geeinigt und stürzte sich auf die Ausgrabung Trojas im damals türkischen Gebiet. Er glaubte an die Wörtlichkeit der homerischen Epen wie ein Pietist an das Evangelium; Odyssee und Ilias waren für ihn nicht Gedichte, sondern Landeskunden, wenn auch rühmend und spannend vorgetragen. Seine amtlichen Grabungen begann Schliemann im Oktober 1871, neun Monate nach dem Sieg von Versailles und der Krönung von Wilhelm I. zum deutschen Kaiser, wofür er sich offenbar nicht interessierte. Im Lauf der kommenden zehn Jahre machte er weltweit beachtete, aufsehenerregende Funde, wenn auch die Fachwelt, besonders die deutsche, ihm immer wieder misstraute, nicht selten zu Recht. Aber er fand tatsächlich Stadtreste, die er Troja nannte, und er fand einen spektakulären Goldschatz, den er dem mythischen Trojanerkönig Priamos zuschrieb. Auch seine späteren Grabungen im griechischen Mykene machten Schliemann reich, als ob er das noch nötig gehabt hätte; in fünf sogenannten »Schachtgräbern« fand er wiederum lauter Schätze, am berühmtesten darunter eine goldene Gesichtsmaske: für Schliemann war es frei nach Homer die Maske von Agamemnon, dem Herrscher von Mykene und Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg – also eben im Krieg um die legendäre Helena, Königin von Sparta und Frau des Menelaos, dessen Bruder Agamemnon war. Helena war mithin seine Schwägerin.