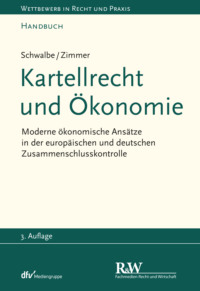Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 13
ɛ) Substitutionsketten
Eng verwandt mit dem Problem der Marktabgrenzung bei differenzierten Gütern ist das der Substitutionsketten. Auch in vieler Hinsicht sehr unterschiedliche Produkte könnten dem gleichen sachlichen oder räumlichen relevanten Markt zuzuordnen sein, wenn diese Produkte durch eine Substitutionskette miteinander verknüpft sind. So könnten zwei Güter, A und E, die keine direkten Substitute darstellen, im gleichen Markt sein, wenn z.B. A durch B, B durch C, C durch D, und D durch E substituiert würden. Allerdings bedeutet die Existenz einer solchen Substitutionskette nicht notwendig, dass alle Produkte in dieser Kette dem gleichen relevanten Markt zugeordnet werden müssen, denn entscheidend ist das Ausmaß der Substitution, die bei einer Preiserhöhung eines hypothetischen Monopolisten erfolgt. Wenn ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist, der die Produkte B und D anbietet, die Preise der beiden Güter um mindestens 5 % anheben würde, dann könnte dies zu einer starken Substitution von B und D durch das Gut C führen, aber nur zu einer geringen Substitution durch die Güter A und E, sodass die Preiserhöhung nicht profitabel wäre. Würde das Gut C dem Kandidatenmarkt hinzugefügt werden, dann könnte sich eine Preiserhöhung der Güter B, C und D als profitabel erweisen, sodass diese einen relevanten Markt darstellen. Die Güter A und E, trotz der Tatsache, dass sie zu dieser Substitutionskette gehören, wären nicht in diesem relevanten Markt.
ζ) Marktabgrenzung bei Preisdiskriminierung
Einige Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass es zwischen verschiedenen Konsumentengruppen erhebliche Unterschiede gibt, die eine Preisdiskriminierung zwischen diesen Gruppen ermöglichen, da die Substitutionsmöglichkeiten verschieden sein können. Wenn ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist in der Lage wäre, den Preis seines Produktes für eine spezifische Konsumentengruppe für längere Zeit um 5–10 % anzuheben, dann umfasst ein relevanter Markt neben den Produkten und den Gebieten auch die entsprechende Konsumentengruppe.113 Damit eine Preisdiskriminierung zwischen verschiedenen Konsumentengruppen durchgeführt werden kann, muss jedoch eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. So darf es keine Möglichkeit der Arbitrage zwischen den verschiedenen Konsumentengruppen geben, da dies eine Preisdiskriminierung verhindern würde. Weiterhin muss der hypothetische Monopolist in der Lage sein, die verschiedenen Konsumentengruppen zu identifizieren. Allerdings sind diese Bedingungen, insbesondere die Identifikationsmöglichkeiten eines hypothetischen Monopolisten, häufig nur schwer zu überprüfen. Ist jedoch Preisdiskriminierung für das betrachtete Produkt eine gebräuchliche Praxis, dann ist dies ein starkes Indiz dafür, dass auch ein hypothetischer Monopolist eine Preisdifferenzierung vornehmen würde. In diesem Fall wäre der relevante Markt auch unter Berücksichtigung verschiedener Konsumentengruppen, die einer Preisdifferenzierung unterliegen, abzugrenzen.114
η) Folgemärkte
Spezifische Probleme bei der Marktabgrenzung können bei Produkten auftreten, die nur zusammen mit einem anderen Produkt verwendet werden, wie es z.B. bei Kaffeemaschinen und den dazu passenden Kaffeepads oder Drucker und Druckerpatronen der Fall ist. Allgemein liegt eine solche Situation dann vor, wenn ein primäres Produkt, wie z.B. eine Kaffeemaschine oder ein Drucker, erworben wird und später weitere, sekundäre Produkte hinzugekauft werden, die zusammen mit dem primären Produkt verwendet werden und ohne die die Funktionsfähigkeit des primären Produktes nicht gegeben oder zumindest stark eingeschränkt ist. Primäres und sekundäres Produkt bilden also ein System, das nur dann zufriedenstellend funktioniert, wenn beide Produkte vorhanden sind.115 Ähnliche Folgemarktsituationen treten auch im Rahmen von Franchise-Vereinbarungen auf, in denen die Konzession bzw. die entsprechende Marke das primäre Produkt ist und die abzunehmenden Güter das sekundäre Produkt darstellen.116 Häufig sind die technischen Spezifikationen der Produkte derart, dass nach dem Kauf des primären Produktes die Substitutionsmöglichkeiten bezüglich des sekundären stark eingeschränkt sind. Hat man einen bestimmten Drucker erworben, dann können nur Druckerpatronen verwendet werden, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Die Konsumenten unterliegen also einem lock-in. Häufig sind dabei die Hersteller des primären Produktes auch die einzigen Hersteller des kompatiblen sekundären Produktes. Würde man den Markt für das sekundäre Produkt, den so genannten Folgemarkt (Aftermarket), als relevanten Markt abgrenzen, dann würde man häufig sehr hohe Marktanteile feststellen und damit auch Marktmacht konstatieren müssen.117 Es stellt sich jedoch die Frage, ob selbst ein Marktanteil von 100 % im Folgemarkt ein deutliches Indiz für Marktmacht ist. Dies wäre dann der Fall, wenn der Hersteller des sekundären Produktes in der Lage wäre, den lock-in der Konsumenten auszunutzen und den Preis für das sekundäre Produkt signifikant über den Wettbewerbspreis anzuheben. Allerdings werden Konsumenten, vor allem dann, wenn der Preis der sekundären Produkte einen großen Anteil am Gesamtpreis des Systems ausmacht oder das sekundäre Produkt häufig ersetzt werden muss, bereits beim Erwerb des primären Produktes die Kosten des sekundären berücksichtigen. Eine Anhebung des Preises des sekundären Produktes wird dann zu einer Verringerung der Nachfrage nach dem zugehörigen primären Produkt führen, wenn die Nachfrager über ausreichende Substitutionsmöglichkeiten verfügen. Dies macht deutlich, dass Folgemärkte nicht isoliert vom Markt für das primäre Produkt analysiert werden sollten. Der Anbieter eines primären und sekundären Produktes wird den Preis des sekundären nicht anheben, wenn die Konsumenten den höheren Preis für das sekundäre Produkt bei der Kaufentscheidung für das primäre Produkt berücksichtigen und aus diesem Grunde ein anderes primäres Produkt erwerben. In diesem Fall würde der Markt für das sekundäre Produkt keinen relevanten Markt darstellen, sondern es wäre der Markt für Systeme zu betrachten, d.h. für primäre und sekundäre Produkte zusammen. Sind jedoch die Substitutionsmöglichkeiten der Nachfrager hinsichtlich des primären Produktes beschränkt, dann besteht für den Anbieter eines Systems der Anreiz, den Preis des sekundären Produktes signifikant anzuheben. In diesem Fall wäre der Folgemarkt als relevanter Markt abzugrenzen.
θ) Sortimentsmärkte
Märkte, auf denen mehrere unterschiedliche Güter gemeinsam nachgefragt und angeboten werden, werden in der Literatur als Sortiments- oder Clustermärkte bezeichnet. Sortimentsmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen Komponenten eines Bündels an Produkten oder Dienstleistungen eine „Transaktionskomplementarität“ besteht.118 Eine solche Transaktionskomplementarität liegt immer dann vor, wenn ein Konsument beim Kauf mehrerer Produkte von einem Unternehmen geringere Transaktionskosten hat als beim Kauf dieser Produkte bei verschiedenen Unternehmen. Anders ausgedrückt: Die Zahlungsbereitschaft eines Kunden bei einem gemeinsamen Bezug der Produkte ist größer als die Summe der Zahlungsbereitschaften bei einem Einzelbezug. Transaktionskomplementarität kann daher interpretiert werden als Verbundvorteile auf der Nachfrageseite, wobei diese Vorteile dem Konsumenten und nicht dem Hersteller zugutekommen. Diese Transaktionskomplementarität führt dazu, dass Konsumenten Bündel an Gütern oder Dienstleistungen nachfragen. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn auf der Angebotsseite Verbundvorteile vorliegen, sodass es für ein Unternehmen effizient ist, die entsprechenden Leistungen gemeinsam anzubieten statt getrennt.119 Als relevante Einheit für die Abgrenzung des relevanten Marktes könnte daher das von den Konsumenten nachgefragte und den Unternehmen angebotene Bündel an Dienstleistungen betrachtet werden, wobei zwischen den einzelnen Komponenten in einem Bündel sowohl substitutive als auch komplementäre Beziehungen bestehen.120
Das Konzept des Sortimentsmarktes ist in der amerikanischen, der europäischen und auch der deutschen Anwendungspraxis auf eine Reihe von Märkten angewendet worden, wie z.B. bei Krankenhäusern, dem Lebensmitteleinzelhandel, Bank- sowie Telekommunikationsdienstleistungen.
Die Tatsache, dass auf einem Markt Bündel an Gütern oder Dienstleistungen nachgefragt und angeboten werden, hat jedoch keine Auswirkungen auf das grundlegende Prinzip der Marktabgrenzung. Dies gilt für das Bedarfsmarktkonzept, bei dem die Austauschbarkeit aus Sicht eines verständigen Verbrauchers im Vordergrund steht. Hier bezieht sich die Austauschbarkeit nicht auf eine einzelne Komponente, sondern auf die Bündel von Dienstleistungen oder Gütern, die von den Konsumenten gemeinsam nachgefragt werden.121 Dies gilt in gleicher Weise für den hypothetischen Monopolistentest, bei dem dann von einem Produktbündel als erstem Kandidatenmarkt auszugehen wäre.122
Würde die Transaktionskomplementarität nicht berücksichtigt und würde stattdessen die Marktabgrenzung bei einer einzelnen Komponente des Bündels ansetzen, dann bestünde die Gefahr einer zu engen Marktabgrenzung. Würde der Preis einer Komponente erhöht, die Preise der anderen Komponenten jedoch konstant gehalten, dann würden die Konsumenten nicht unmittelbar auf Substitute ausweichen. Anders ausgedrückt: Die Preiselastizität der Nachfrage nach den einzelnen Komponenten innerhalb des Bündels ist geringer als die Preiselastizität der Nachfrage nach dem Bündel. Dies liegt daran, dass die Konsumenten in der Regel die Wirkung der Preiserhöhung einer Komponente auf den Gesamtpreis betrachten. Ist der Anteil des Preises dieser Komponente jedoch im Verhältnis zum Preis des gesamten Bündels gering, dann wird die Preiserhöhung zu keinem erheblichen Nachfragerückgang führen. Man würde daher vermuten, dass aufgrund der geringen Nachfragereduktion den Konsumenten keine Ausweichmöglichkeiten offenstehen und würde einen eigenständigen relevanten Markt für diese Komponente abgrenzen. Würde man jedoch weitere Komponenten aus dem Bündel in die Betrachtung einbeziehen, dann würde die Preiselastizität der Nachfrage zunehmen. Dies liegt daran, dass andere Bündel zunehmend attraktiver werden. Dies unterscheidet sich von dem Fall ohne Transaktionskomplementarität, bei dem mit zunehmender Zahl von Produkten die Preiselastizität der Nachfrage sinkt. Dies macht deutlich, dass die Nichtberücksichtigung einer Transaktionskomplementarität in der Regel zu einer zu engen Marktabgrenzung führt.
Das Konzept des Sortimentsmarktes wird in der wirtschaftstheoretischen Literatur jedoch auch heftig kritisiert, da derartige Bündel Güter und Dienstleistungen enthalten, zwischen denen keine Angebots- oder Nachfragesubstitution besteht. Sortimentsmärkte könnten daher höchstens zur Vereinfachung der Analyse herangezogen werden. So muss keine große Anzahl separater Märkte z.B. für verschiedene Pflege- oder Bankdienstleistungen definiert werden, wenn die Marktanteile und die Marktzutrittsbedingungen für jede Dienstleistung ähnlich sind oder wenn bei fehlenden Daten z.B. die Zahl der Krankenhausbetten als Grundlage für die Ermittlung der Marktanteile herangezogen wird. Sortimentsmärkte können jedoch zu fehlerhaften Einschätzungen führen, wenn der Wettbewerb von Anbietern eines Teils der Produkte den Preissetzungsspielraum der Anbieter beschränkt, die das gesamte Bündel anbieten.123
ι) Zweiseitige Märkte
Wendet man den hypothetischen Monopolistentest auf zweiseitige Märkte an, so ist zu berücksichtigen, dass sowohl die absolute Preishöhe als auch die Preisstruktur, d.h. die Preise, die von den jeweiligen Marktseiten erhoben werden, bei der Beurteilung einer profitablen Preiserhöhung von zentraler Bedeutung sind. Es stellt sich die Frage, was bei einem zweiseitigen Markt unter einer kleinen, aber signifikanten und nicht nur vorübergehenden Preiserhöhung verstanden werden soll. In diesem Zusammenhang sind mehrere Möglichkeiten denkbar: Eine Preiserhöhung des Gesamtpreises ohne Änderung der Preisstruktur oder eine optimale Erhöhung des Gesamtpreises mit oder ohne Anpassung des anderen Preises.124
In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, zwischen zweiseitigen Märkten mit beobachtbaren Transaktionen (wie z.B. bei Zahlungen mit Kreditkarten oder anderen Zahlungssystemen) und solchen mit nicht beobachtbaren Transaktionen (wie z.B. werbefinanzierten Medien) zu unterscheiden. Im ersten Fall ist es sinnvoll, den Gesamtpreis zu erhöhen und gleichzeitig die Preisstruktur optimal anzupassen. Im zweiten Fall wäre die Erhöhung eines Preises bei Anpassung des anderen vorzuziehen, da bei einer solchen sequentiellen Vorgehensweise die Substitutionsmöglichkeiten der Konsumenten besser berücksichtigt werden können.125 Ungeachtet der beiden unterschiedlichen Markttypen wird eine Preiserhöhung zu Wechselwirkungen zwischen den Nachfragergruppen führen, die eine solche Maßnahme unprofitabel machen können. Diese Effekte müssen bei der Anwendung des hypothetischen Monopolistentests berücksichtigt werden. Weiterhin muss in Rechnung gestellt werden, dass Konsumenten auf Substitute ausweichen werden, die entweder von anderen Plattformen oder von „einseitigen“ Unternehmen angeboten werden.126 In diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, dass beide Marktseiten berücksichtigt werden. Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Nachfragergruppen können so erheblich sein, dass das Substitutionsverhalten einer dieser Gruppen bereits ausreicht, um eine solche Preiserhöhung unprofitabel zu machen. Es kann jedoch auch der Fall eintreten, dass eine Preiserhöhung sich erst dann als unprofitabel erweist, wenn das Substitutionsverhalten beider Nachfragergruppen in Rechnung gestellt wird.
Noch problematischer ist eine Marktabgrenzung in Situationen, in denen die Nutzer auf einer Marktseite die Leistungen unentgeltlich, d.h. zu einem Preis von Null, erhalten, wie das beispielsweise bei Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken der Fall ist.127 Hier ist nicht klar, wie der hypothetische Monopolistentest sinnvoll angewandt werden kann – eine Preiserhöhung von 5 % bis 10 % eines Preises von Null ist ebenfalls Null. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine Marktabgrenzung mittels des hypothetischen Monopolistentests preisbasiert ist – dadurch bleiben andere Dimensionen des Wettbewerbs, wie z.B. die Qualität, die Breite des Angebots oder die Innovationstätigkeit, unberücksichtigt. Alternative Vorschläge zur Marktabgrenzung in zweiseitigen Märkten mit unentgeltlichen Leistungen stellen allerdings auch keine überzeugenden Lösungen dar. Hier ist beispielsweise der SSNIC-Test (Small but Significant Nontransitory Increase in Cost) zu nennen, bei dem nicht der Preis erhöht wird, sondern andere Kosten für den Nutzer, wie z.B. eine größere Werbefläche oder eine längere Darstellung der Werbung.128 Alternativ wurde der SSNDQ-Test (Small but Significant Non-transitory Decrease in Quality) vorgeschlagen, bei dem die Qualität des Angebots reduziert wird.129 Allerdings ist Qualität nur schwer zu messen und ist häufig subjektiv. Außerdem ist nicht klar, wie eine Veränderung in der Qualität des Ergebnisses einer Suchanfrage quantifiziert werden könnte. Zudem stellt sich bei allen genannten Tests das Problem der Datenverfügbarkeit. Diese Vorschläge, auch wenn sie auf konzeptioneller Ebene ökonomisch sinnvoll sein mögen, sind daher in der Praxis äußerst schwierig umzusetzen.
Insbesondere in der digitalen Ökonomie ist seit einigen Jahren eine Entwicklung zu verzeichnen, die es schwer macht, klar definierte traditionelle Märkte zu identifizieren, auf denen mehr oder weniger homogene Güter wie Zement, Glas oder Stahl gehandelt werden. Digitale Unternehmen haben ihre Angebote zu ganzen „Ökosystemen“ ausgebaut, die eine Vielzahl von komplementären Produkten umfassen. Diese Unternehmen haben ein Interesse daran, Kunden in ihrem Ökosystem zu halten und zu verhindern, dass sie zu einem anderen System wechseln. Häufig gibt es verschiedene Ökosysteme, in denen Plattformen mit Produktbündeln konkurrieren, wie z.B. bei den Betriebssystemen für intelligente mobile Geräte und den jeweiligen App-Stores. A priori ist dies nicht notwendigerweise problematisch, denn es lässt sich zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen der Wettbewerb zwischen Unternehmen, die mit Produktbündeln konkurrieren, intensiver sein kann, als wenn die Unternehmen ihre Produkte jeweils separat anbieten würden.130 Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass unter anderen Bedingungen der Wettbewerb durch solche Bündelungs- und Kopplungsstrategien verringert würde und dass dadurch auch erhebliche Marktzutrittsschranken entstehen.
Im wissenschaftlichen Schrifttum ist vorgeschlagen worden, in der digitalen Ökonomie statt sachlich und räumlich relevanter Märkte im üblichen Sinne einen Markt für die knappe Ressource der Aufmerksamkeit der Nutzer zu definieren.131 In einem solchen Markt konkurrieren alle Arten von Medien um die Aufmerksamkeit der Nutzer und Plattformen agieren dort als „Aufmerksamkeitsbroker“. In Fusionsfällen könnte sich ein solches Marktkonzept als hilfreich erweisen, da viele Zusammenschlüsse als horizontal aufgefasst werden müssen, da sie im gleichen relevanten Markt, dem für Aufmerksamkeit, stattfinden. Andererseits dürfte die Verwendung eines so weit gefassten Konzepts eines relevanten Marktes zu so geringen Marktanteilen der Unternehmen führen, dass selbst Plattformen wie Facebook oder Google auf diesem Markt vermutlich nur vergleichsweise geringe Marktanteile hätten, denn sie konkurrieren ja mit allen anderen Medien. Damit die Fusionskontrolle in diesen Fällen also überhaupt wirksam werden kann, müssten innerhalb eines großen „Aufmerksamkeitsmarktes“ Teilmärkte für bestimmte Arten von Aufmerksamkeit definiert werden – ein Streaming-Dienst wie Netflix würde dann nicht mehr direkt mit sozialen Netzwerken konkurrieren, sondern mit anderen Anbietern visueller Unterhaltung wie Filmen und Serien wie Amazon Prime, AppleTV oder Magenta. Dann wäre man jedoch im Grunde wieder in der gleichen Situation wie ohne das Konzept eines Aufmerksamkeitsmarkts.
Bei der Abgrenzung von zwei- und mehrseitigen Märkten treten also zahlreiche Probleme auf, die in der Praxis nur schwer und zumeist nur mithilfe heroischer Annahmen zu lösen sind. Es könnte sich daher, ähnlich wie bei Märkten mit differenzierten Produkten, als sinnvoll erweisen, auf eine Marktabgrenzung als ersten Schritt einer wettbewerblichen Untersuchung zu verzichten und sich stattdessen auf eine ökonomisch fundierte Abschätzung der Auswirkungen eines Zusammenschlusses zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Marktabgrenzung kein Selbstzweck ist, sondern lediglich ein Instrument und Werkzeug zur Feststellung von Marktmacht. Wenn dieses Instrument sich in bestimmten Situationen als wenig geeignet erweist, wie z.B. bei der Analyse von Märkten mit differenzierten Gütern oder von zwei- oder mehrseitigen Märkten, in denen Unternehmen mit ganzen Ökosystemen von Produkten und Dienstleistungen miteinander konkurrieren, dann ist zu überlegen, ob nicht auf eine Abgrenzung des relevanten Marktes verzichtet werden kann und das Augenmerk auf die Frage gerichtet wird, ob durch einen Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird.
Dieser Vorschlag ist bereits seit längerer Zeit im Schwange, hat aber insbesondere in Bezug auf zweiseitige Märkte an Bedeutung gewonnen, da sich hier die Abgrenzung des relevanten Marktes häufig als komplex und schwierig erweist. Dabei könnte zumindest rechtlich die Möglichkeit eröffnet werden, eine Fusion einer näheren Prüfung unterziehen zu können, bevor in einem ersten Schritt ein Markt abgegrenzt und die Marktanteile bestimmt worden sind.132 Dies steht im Einklang mit den Empfehlungen, die in einigen neueren Untersuchungen zur Wettbewerbspolitik in der digitalen Ökonomie geäußert wurden. Im Bericht von Crémer et al. (2019) für die europäische Kommission heißt es: „Therefore, we argue, that in digital markets we should put less emphasis on analysis of market definition, and more emphasis on theories of harm and identification of anticompetitive strategies.“133 Der als Stigler-Report bekannte Bericht ist noch expliziter: „Where there is direct evidence of harm to competition, antitrust law should not require circumstantial evidence via a defined relevant market.“134 Eine Untersuchung braucht daher nicht mit der Definition des relevanten Marktes zu beginnen, sondern mit dem Nachweis, dass aufgrund des Zusammenschlusses mit einer erheblichen Beschränkungen des wirksamen Wettbewerbs gerechnet werden muss.