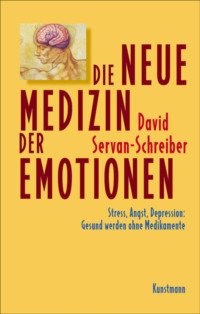Kitabı oku: «Die neue Medizin der Emotionen», sayfa 3
WENN DIE BEIDEN GEHIRNE NICHT MITEINANDER ZURECHTKOMMEN
Die beiden Gehirne, das emotionale und das kognitive, nehmen die von der Außenwelt kommende Information nahezu gleichzeitig auf. Danach können sie entweder gut zusammenarbeiten oder aber einander die Kontrolle über Denken, Gefühle und Verhalten streitig machen. Das Resultat dieser Interaktion – Kooperation oder Konkurrenz – bedingt, was wir fühlen, und bestimmt unser Verhältnis zur Welt und zu anderen Menschen. Die verschiedenen Formen von Rivalität zwischen beiden Gehirnen machen uns unglücklich. Ergänzen sich hingegen emotionales und kognitives Gehirn und gibt das eine die Richtung vor, wie wir unser Leben gestalten wollen (das emotionale), während das andere uns dazu bringt, so klug wie möglich in eben dieser Richtung vorwärts zu gehen (das kognitive), verspüren wir eine innere Harmonie – »Ich bin genau da, wo ich in meinem Leben sein möchte«–, die jeglichem dauerhaften Wohlbefinden zu Grunde liegt.
Emotionale Kurzschlusshandlungen
Die Evolution setzte Prioritäten. Evolution ist vor allem eine Frage des Überlebens und der Weitergabe unserer Gene von einer Generation an die nächste. Zu welcher Vielschichtigkeit das Gehirn sich im Lauf mehrerer Jahrmillionen auch entwickelt hat, wie erstaunlich seine Fähigkeiten zur Konzentration, Abstraktion, Selbstreflexion auch sind: Hätten diese verhindert, dass wir einen Tiger oder einen Feind wahrnehmen, oder dazu geführt, dass wir einen geeigneten Sexualpartner einfach übersehen und damit eine Gelegenheit verpassen, uns zu reproduzieren, dann wäre unsere Spezies schon längst ausgestorben. Glücklicherweise ist das emotionale Gehirn immer wachsam. Seine Aufgabe ist es, aus dem Hintergrund die Umgebung zu überwachen. Sobald es eine Gefahr oder aber eine außergewöhnlich gute Gelegenheit (vom Blickpunkt des Überlebens aus) entdeckt – einen möglichen Partner, ein Territorium, irgendetwas Nützliches –, löst es augenblicklich einen Alarm aus, der binnen weniger Millisekunden sämtliche Vorgänge im kognitiven Gehirn storniert und seine Tätigkeit unterbricht. Das ermöglicht es dem Gehirn als Ganzem, sich unverzüglich auf das zu konzentrieren, was für das Überleben von wesentlicher Bedeutung ist. Beim Auto fahren lässt dieser Mechanismus uns unbewusst einen Lastwagen, der auf uns zu kommt, wahrnehmen, selbst wenn wir uns gerade angeregt mit unserem Beifahrer unterhalten. Das emotionale Gehirn erkennt die Gefahr und bündelt unsere Aufmerksamkeit, bis diese vorüber ist. Es ist auch dafür verantwortlich, wenn das Gespräch zwischen zwei Männern auf der Terrasse eines Cafés plötzlich stockt, weil ein verführerischer Minirock durch ihr Gesichtsfeld tänzelt. Und es lässt Eltern in einem Park verstummen, wenn sie aus den Augenwinkeln bemerken, wie ein unbekannter Hund sich ihrem Kind nähert.
Wie das Team von Patricia Goldman-Rakic an der Universität Yale bewies, verfügt das emotionale Gehirn über die Fähigkeit, den präfrontalen Kortex, den am höchsten entwickelten Bereich des kognitiven Gehirns, abzuschalten (englisch: »to go offline«). Unter der Einwirkung von außergewöhnlichem Stress reagiert der präfrontale Kortex nicht mehr und verliert seine Fähigkeit, das Verhalten zu steuern. Schlagartig gewinnen die Reflexe und instinktiven Verhaltensweisen die Oberhand.21 Sie sind schneller und näher an unserem genetischen Erbe, daher hat die Evolution ihnen für Notsituationen den Vorrang eingeräumt, da sie sich offenbar besser als abstrakte Überlegungen dazu eignen, uns zu leiten, wenn das Überleben auf dem Spiel steht. Unter den gleichsam animalischen Bedingungen, unter denen unsere Vorfahren lebten, war dieses Alarmsystem von ausschlaggebender Bedeutung, und mehrere hundert Jahrtausende nach dem ersten Auftreten des Homo sapiens kommt es uns im alltäglichen Leben immer noch ungemein zustatten. Werden allerdings unsere Gefühle zu übermächtig, dann übernimmt das emotionale Gehirn, das jetzt den Vorrang vor dem kognitiven hat, allmählich die Herrschaft über unser Denken. Wir verlieren die Kontrolle über unseren Gedankenfluss und sind nicht mehr in der Lage, uns gemäß unseren eigentlichen, langfristigen Interessen zu verhalten. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn wir nach irgendwelchen Unannehmlichkeiten, im Verlauf einer Depression oder infolge eines schweren emotionalen Traumas »reizbar« sind. Das erklärt auch die »Überempfindlichkeit« von Leuten, die körperlich, sexuell oder emotional missbraucht wurden.
In der medizinischen Praxis kennt man zwei gängige Beispiele für diesen emotionalen Kurzschluss. Erstens das so genannte posttraumatische Stresssyndrom: Nach einem schweren Trauma, etwa einer Vergewaltigung oder einem Erdbeben, verhält das emotionale Gehirn sich wie ein rechtschaffener Wachtposten, der sich hat überrumpeln lassen. Danach schlägt er viel zu oft Alarm, so als sei er nicht in der Lage, sich zu vergewissern, dass keinerlei Gefahr droht. Genau dies war bei einer Überlebenden des 11. September der Fall, die sich in unserem Zentrum in Pittsburgh behandeln lassen wollte: Noch Monate nach dem Attentat war sie wie gelähmt, sobald sie einen Wolkenkratzer betrat.
Der zweite durchaus übliche Fall sind Angstanfälle, in der Psychiatrie auch als Panikattacken bezeichnet. In den westlichen Industrieländern hat eine von zwanzig Personen schon einmal einen solchen Panikanfall erlebt.22 Die Opfer haben oft das Gefühl, dass sie kurz vor einem Herzinfarkt stehen, so sehr ähneln sich die physischen Anzeichen. Das limbische Gehirn übernimmt von einem Augenblick auf den anderen die Kontrolle über sämtliche Körperfunktionen: Die Frequenz des Herzschlags, der Puls, rast plötzlich, der Magen verkrampft sich, Beine und Hände zittern, und die Opfer sind schweißgebadet. Gleichzeitig werden alle kognitiven Funktionen durch die Ausschüttung von Adrenalin aufgehoben: Auch wenn das kognitive Gehirn keinerlei Grund für einen derartigen Alarmzustand erkennen kann, wird es durch das Adrenalin völlig »abgeschaltet« und ist nicht mehr in der Lage, angemessen auf die Situation zu reagieren. Diejenigen, die solche Anfälle erlitten haben, beschreiben dies sehr gut: »Mein Gehirn war wie leer; ich konnte nicht mehr denken. Ich dachte nur noch eines: ›Gleich stirbst du. Ruf den Notarzt – sofort!‹«
Was ist wichtiger: Fühlen oder Denken?
Dem gegenüber kontrolliert das kognitive Gehirn die bewusste Aufmerksamkeit sowie die Fähigkeit, die gefühlsmäßigen Reaktionen zu dämpfen, ehe sie alle anderen überlagern. Diese Steuerung der Gefühle durch das kognitive Denken bewahrt uns vor einer möglichen Tyrannei der Gefühle und einem Leben, das ganz und gar von Instinkten und Reflexen bestimmt wäre. Eine an der Universität Stanford durchgeführte Untersuchung, die mit der Bilderwelt des Gehirns arbeitete, veranschaulicht die Bedeutung des kortikalen Gehirns sehr deutlich. Wenn sich Studenten aufwühlende Bilder ansehen – verstümmelte Leichen oder entstellte Gesichter beispielsweise –, reagiert ihr emotionales Gehirn sofort. Versuchen sie jedoch bewusst, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, so sieht man, wie die kortikalen Bereiche die Bilder ihres aktivierten Gehirns verdrängen und die Aktivität des emotionalen Gehirns blockieren.23
Die Kontrolle von Gefühlen durch das Denken ist jedoch eine zweischneidige Angelegenheit: Kommt sie allzu oft zum Zug, verliert man möglicherweise die Fähigkeit, die Hilferufe des emotionalen Gehirns zu hören. Auf die Folgen einer solchen Unterdrückung von Gefühlen trifft man häufig bei Personen, die als Kinder gelernt haben, dass Gefühle nicht zulässig sind. Typisches Beispiel dafür ist zweifelsohne die Männern so häufig eingetrichterte strenge Ermahnung: »Ein Junge weint nicht!«
Eine übertriebene Kontrolle der Gefühle kann daher zu Unempfindlichkeit führen. Doch ein Gehirn, das emotionaler Information verbietet, einen Einfluss auszuüben, verursacht andere Probleme. Einerseits fällt es einem schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn man keine Vorliebe für etwas hat, keine »innere Stimme«, die aus dem Herzen oder dem Bauch kommt, jenen Körperpartien, die ein »irrationales Echo« von Gefühlen auslösen. Aus diesem Grund verzetteln zu »mathematische« Intellektuelle – häufig Männer – sich gern in endlosem Abwägen, wenn es darum geht, sich beispielsweise zwischen zwei Automarken oder auch nur zwei Fotoapparaten zu entscheiden. In den schlimmsten Fällen – denken Sie etwa an das berühmte Beispiel von Phineas Gage im 19. Jahrhundert24 oder an den von Eslinger und Damasio beschriebenen Patienten E.V.R.25 – hindert eine Hirnverletzung den Denkapparat daran, eine gefühlsmäßige Abneigung zur Kenntnis zu nehmen. Nehmen wir den Fall von E.V.R. Der Buchhalter mit einem IQ von 130 – was ihn in die Sparte »überdurchschnittlich intelligent« platzierte – war ein geschätztes Mitglied seiner Gemeinde. Seit vielen Jahren war er verheiratet, hatte mehrere Kinder, ging regelmäßig in die Kirche und führte ein äußerst geregeltes Leben. Eines Tages musste er sich einer Gehirnoperation unterziehen, bei der sein Denk- und Wahrnehmungsapparat von seinem emotionalen Gehirn »abgekoppelt« wurde. Von einem Tag auf den anderen war er nicht mehr in der Lage, auch nur die banalste Entscheidung zu fällen. Für ihn ergab nichts einen »Sinn«. Merkwürdigerweise bewiesen Intelligenztests – die ja ausschließlich die abstrakte Intelligenz messen – einen nach wie vor bei weitem überdurchschnittlichen IQ. Dennoch, E.V.R. wusste nicht mehr, was er den lieben langen Tag mit sich anfangen sollte, da er keinerlei wirkliche, »aus dem Bauch kommende« Vorliebe für die eine oder die andere Möglichkeit hatte; alle Entscheidungen verloren sich in endlosen Detailüberlegungen. Schließlich verlor er seinen Arbeitsplatz, seine Ehe ging in die Brüche, und er ließ sich auf eine Reihe zweifelhafter Affären ein, die sein ganzes Geld verschlangen. Da er keinerlei Gefühle als Richtschnur für seine Entscheidungen hatte, geriet sein Leben völlig aus den Fugen, obwohl seine Intelligenz unbeeinträchtigt blieb.
Bei Leuten mit intaktem Gehirn kann allerdings schon eine Neigung zur Unterdrückung von Gefühlen massive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Durch eine Trennung von Denk- und Gefühlsapparat können wir die Fähigkeit verlieren, die kleinen Alarmsignale unseres limbischen Systems wahrzunehmen. Ständig finden wir tausend Gründe, nicht aus einer Ehe oder einem Beruf auszubrechen, unter denen wir in Wirklichkeit leiden, weil wir tagtäglich unseren innersten Werten Gewalt antun. Doch die Verzweiflung verschwindet keinesfalls dadurch, dass wir vor der ihr zu Grunde liegenden Bedrängnis die Augen verschließen. Da der Körper das wichtigste Betätigungsfeld des emotionalen Gehirns ist, äußert diese ausweglose Situation sich in körperlichen Problemen. Die Symptome sind die klassischen Stresskrankheiten: unerklärliche Müdigkeit, Bluthochdruck, Erkältungen, Herzkrankheiten, Magen-/Darmbeschwerden und Hautprobleme. Forscher in Berkeley sind sogar der Ansicht, nicht die emotionalen Gefühle als solche, sondern ihre Unterdrückung durch das Denken belaste unser Herz und unsere Arterien.26
»FLOW« UND DAS LÄCHELN DES BUDDHA
Um harmonisch mit anderen Menschen zusammenzuleben, gilt es, ein Gleichgewicht zwischen unseren unmittelbaren emotionalen – instinktiven – und den rationalen Reaktionen, die auf lange Sicht soziale Bindungen aufrechterhalten, zu erlangen und zu bewahren. Die emotionale Intelligenz findet dann am angemessensten ihren Ausdruck, wenn die beiden Hirnsysteme, das kortikale und das limbische, ständig zusammenarbeiten. In diesem Zustand gestalten und realisieren sich die Gedanken, die Entscheidungen, die Gesten auf ganz natürliche Weise und laufen ab, ohne dass wir dem besondere Aufmerksamkeit schenken. Wir wissen jederzeit, welche Wahl wir treffen müssen, und verfolgen unsere Ziele ohne Angestrengtheit, in einem Zustand natürlicher Konzentration, da wir entsprechend unseren Werten handeln. Und diesen Zustand des Wohlbefindens streben wir ständig an: die sichtbare und vollkommene Harmonie zwischen dem emotionalen Gehirn, das die Energie liefert und die Richtung vorgibt, und dem kognitiven Gehirn, das die Durchführung reguliert. Der große amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi, der im Ungarn der Nachkriegswirren aufwuchs, widmete sein Leben dem Versuch, das Wesen des Wohlbefindens zu verstehen. Er nannte diesen Zustand »Flow«.27
Seltsamerweise gibt es ein sehr einfaches physiologisches Anzeichen dieser Harmonie der Gehirne, dessen biologische Grundlagen Darwin vor über einem Jahrhundert untersuchte: das Lächeln. Ein falsches Lächeln – zu dem man sich aus gesellschaftlichen Gründen zwingt – stimuliert lediglich die Jochbeinmuskeln im Gesicht, die, wenn man die Lippen schürzt, die Zähne entblößen. Im Gegensatz dazu mobilisiert ein »echtes« Lächeln zusätzlich die Muskeln um die Augen herum. Diese lassen sich nicht willentlich, mittels des kognitiven Gehirns, zusammenziehen. Der Befehl dazu muss aus den primitiven, tief liegenden limbischen Bereichen kommen. Deshalb lügen Augen nie: Die Kräuselung um sie herum zeigt, ob ein Lächeln echt oder falsch ist. An einem herzlichen, einem echten Lächeln merken wir intuitiv, ob unser Gesprächspartner sich in genau diesem Augenblick in einem Zustand der Harmonie zwischen dem, was er denkt, und dem, was er fühlt, zwischen Kognition und Emotion befindet. Das Gehirn verfügt über eine angeborene Neigung zum »Flow«. Das universellste Beispiel dafür ist das Lächeln Buddhas.
Ziel natürlicher Methoden, die ich in den folgenden Kapiteln vorstellen will, ist es, dies zu ermöglichen. Im Gegensatz zum IQ, der sich in Verlauf eines Lebens kaum höher entwickelt, kann man die emotionale Intelligenz in jedem Alter pflegen und weiterentwickeln. Es ist nie zu spät zu lernen, wie man besser mit seinen Gefühlen und mit seiner Beziehung zu den Mitmenschen umgeht. Der erste hier beschriebene Ansatz ist zweifelsohne der grundlegendste. Es geht darum, den Herzrhythmus zu optimieren, um dem Stress standzuhalten, die Angstgefühle unter Kontrolle zu bringen und die Vitalität, die in uns steckt, zu maximieren. Dies ist der erste Schlüssel zur emotionalen Intelligenz.
3
HERZ UND VERNUNFT
Adieu, sagte der Fuchs.
Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry, Der Kleine Prinz4
HERBERT VON KARAJAN HAT EINMAL ERKLÄRT, er lebe nur für die Musik. Zweifelsohne war ihm selber gar nicht klar, in welchem Maße dies zutraf: Er starb in eben dem Jahr, in dem er nach dreißig Jahren an der Spitze der Berliner Philharmoniker in den Ruhestand trat. Am erstaunlichsten ist jedoch, dass zwei österreichische Psychologen dies hätten voraussagen können. Zwölf Jahre zuvor hatten sie untersucht, wie das Herz des Maestro auf dessen verschiedene Betätigungen reagierte.28 Die größten Schwankungen hatten sie verzeichnet, wenn er eine besonders gefühlsgeladene Passage der dritten Leonoren-Ouvertüre Beethovens dirigierte. Es genügte sogar, dass er diese Takte hörte, und schon konnte man die gleiche Beschleunigung des Pulses regelrecht beobachten.
Es gibt in dieser Komposition Passagen, die für einen Orchesterchef körperlich weit anstrengender sind. Karajans Herz ließen sie jedoch nur geringfügig schneller schlagen. Was seine anderen Aktivitäten anging, so schien er sie sich weniger zu Herzen zu nehmen, wenn man so sagen kann. Ob er mit seinem Privatflugzeug zur Landung ansetzte oder gar einen Fehlstart hinlegte, sein Herz schien dies kaum zur Kenntnis zu nehmen. Das Herz Karajans gehörte ganz und gar der Musik. Und als der Maestro die Musik aufgab, spielte sein Herz nicht mehr mit.
Wer hat noch nie die Geschichte von einem betagten Nachbarn gehört, der wenige Monate nach seiner Frau gestorben ist? Oder von einer Großtante, die nach dem Tod ihres Sohnes das Zeitliche segnete? Der Volksmund spricht in solchen Fällen von einem »gebrochenen Herzen«. Lange Zeit hat die medizinische Wissenschaft derlei Vorfälle verächtlich abgetan und sie auf das Konto bloßer Zufälle verbucht. Erst seit etwa zwanzig Jahren haben mehrere Kardiologen- und Psychiaterteams sich ernsthaft mit diesen »Anekdoten« befasst. Wie sie entdeckten, ist Stress, was Herzkrankheiten betrifft, ein noch größerer Risikofaktor als Rauchen.29 Man ist auch dahintergekommen, dass eine Depression nach einem Herzinfarkt den Tod des Patienten innerhalb des nächsten halben Jahres präziser vorhersagt als jede Messung der Herzfunktion.30 Wenn das emotionale Gehirn aus den Fugen gerät, leidet das Herz darunter und gibt schließlich auf. Die überraschendste Beobachtung ist jedoch, dass dieses Verhältnis umkehrbar ist. Das Gleichgewicht unseres Herzens beeinflusst ständig unser Gehirn. Manche Kardiologen gehen sogar so weit, von einem untrennbaren »Herz-Hirn-System« zu sprechen.31
Gäbe es ein Medikament zur Harmonisierung dieser engen Beziehung zwischen Herz und Gehirn, hätte es wohltuende Auswirkungen auf den Organismus als Ganzen. Es würde den Alterungsprozess verlangsamen, Stress und Müdigkeit abbauen, Angstgefühle beseitigen und uns vor Depressionen bewahren; nachts würde es uns helfen, besser zu schlafen, und tagsüber, entsprechend unseren Fähigkeiten zur Konzentration und Genauigkeit zu funktionieren. Vor allem würde es uns dann leichter fallen, jenen Zustand des Flow, der gleichbedeutend mit Wohlbehagen ist, herzustellen. Es wäre ein Mittel gegen Bluthochdruck, Angstzustände und Depressionen, »alles in einem«. Gäbe es eine solche Arznei, jeder Mediziner würde sie verschreiben. Vielleicht würden letztlich die Regierungen sie sogar dem Trinkwasser beimengen, so wie in manchen Ländern das Fluor für die Zähne.
Leider existiert dieses Wundermittel noch nicht. Dafür kennen wir seit kurzem ein einfaches und wirksames Verfahren, das jedermann zur Verfügung steht und offenbar genau die notwendigen Voraussetzungen für eine Harmonie zwischen Herz und Hirn schafft. Obwohl diese Methode erst vor kurzer Zeit entwickelt wurde, haben mehrere Untersuchungen bereits ihre günstigen Auswirkungen auf Körper und Gefühle derjenigen, die sie beherrschen, bewiesen, einschließlich einer Verjüngung ihrer Physiologie. Um zu verstehen, wie das möglich ist, müssen wir uns zunächst kurz die Funktionsweise des Herz-Hirn-Systems ansehen.
DAS HERZ DER GEFüHLE
Gefühle verspüren wir im Körper, nicht im Kopf – zumindest dies scheint selbstverständlich. Schon 1890 schrieb William James, Harvard-Professor und Vater der amerikanischen Psychologie, ein Gefühl sei vor allem ein körperlicher Zustand und erst dann eine Wahrnehmung im Gehirn. Seine Schlussfolgerungen leitete er daraus ab, wie wir normalerweise Gefühle empfinden. Sagt man nicht beispielsweise: »Mir steckt die Angst in den Knochen«, oder es sei einem »leicht ums Herz«, dass einem »die Galle überläuft«, oder auch, man sei »verbittert«? Es wäre falsch, in diesen Wendungen lediglich Stilfiguren zu sehen. Vielmehr sind es recht genaue Beschreibungen dessen, was wir in verschiedenen Gemütsverfassungen verspüren. In der Tat weiß man seit kurzem, dass Darm und Herz eigene Netzwerke von zigtausend Neuronen besitzen, die so etwas wie »kleine Gehirne« im Körper darstellen. Diese lokalen Gehirne können selber Dinge wahrnehmen, ihre Wirkungsweise in Abhängigkeit davon modifizieren und sich entsprechend ihren Erfahrungen sogar verändern, das heiß, in gewisser Weise eigene Erinnerungen ausformen.32
Doch das Herz verfügt nicht nur über ein eigenes, halbautonomes Nervensystem, sondern ist auch eine kleine Hormonfabrik. Es sondert Adrenalin ab, das es freisetzt, wenn es seine Kapazitäten voll ausschöpfen muss. Zudem schüttet es das Hormon Noradrenalin aus, das den Blutdruck reguliert, und kontrolliert dessen Freisetzung. Und es sondert sein eigenes Oxytocin ab, das Liebeshormon. Dieses wird ins Blut freigesetzt, beispielsweise wenn eine Mutter ihr Kind stillt, wenn ein Paar sich umwirbt oder auch bei einem Orgasmus.33 Alle diese Hormone wirken unmittelbar auf das Gehirn ein. Zu guter Letzt lässt das Herz den gesamten Organismus an den Veränderungen in seinem ausgedehnten elektromagnetischen Feld teilhaben, das man noch in einigen Metern Entfernung vom Körper nachweisen kann, dessen Bedeutung man jedoch noch nicht kennt.34 Man sieht also, die Bedeutung des Herzens für die Sprache der Gefühle ist nicht nur eine Metapher. Das Herz nimmt Dinge wahr und fühlt. Und wenn es spricht, beeinflusst es die Physiologie unseres gesamten Körpers, angefangen beim Gehirn.
Für die fünfzigjährige Marie waren dies nicht nur theoretische Überlegungen. Sie litt seit mehreren Jahren unter plötzlichen Angstanfällen, die sie immer wieder, gleichgültig, wo sie sich aufhielt, überkamen. Dann fing ihr Herz zu rasen an und klopfte viel zu schnell. Eines Tages überfiel sie auf einem Empfang ein plötzliches Herzjagen, und sie musste sich am Arm eines ihr Unbekannten festklammern, da die Beine ihr den Dienst versagten. Die Unsicherheit, wie ihr Herz sich aufführen würde, belastete sie sehr. Nach und nach schränkte sie ihre Aktivitäten ein. Seit dem Vorfall auf dem Empfang ging sie nur mehr in Begleitung guter Freunde oder ihrer Tochter aus. Aus Angst, ihr Herz könne sie »im Stich lassen«, wie sie es ausdrückte, fuhr sie nicht mehr allein über die Autobahn zu ihrem Landhaus. Marie hatte keine Ahnung, was diese Attacken auslöste. Es war, als beschließe ihr Herz unvermittelt, über irgendetwas, das ihr nicht bewusst war, ganz fürchterlich zu erschrecken; ihr Denken verwirrte sich, sie wurde unruhig und begann am ganzen Körper zu zittern.
Ihr Kardiologe hatte einen »Vorfall der Mitralklappe« diagnostiziert, eine meist harmlose Vorwölbung einer Herzklappe, deretwegen, so erklärte er ihr, sie sich keine Sorgen zu machen brauche. Er hatte ihr Betablocker empfohlen, um das Herzjagen zu unterdrücken, doch die machten sie müde, und sie bekam davon Albträume. Sie hatte sie daher eigenmächtig abgesetzt. Als sie zu mir in die Sprechstunde kam, hatte ich gerade im American Journal of Psychiatry einen Artikel gelesen, laut dem das Herz bestimmter Patienten gut auf Antidepressiva reagiert, so als hätten ungewollte Beschleunigungen des Herzschlags ihren Ursprung eher im Gehirn als in den Herzklappen.35 Leider hatte meine Behandlung auch kaum mehr Erfolg als die meines Kardiologenkollegen, und darüber hinaus war Marie sehr unglücklich über die Kilos, die sie nach Einnahme des Medikaments, das ich ihr verschrieben hatte, zugenommen hatte. Das Herz von Marie würde sich nur beruhigen, wenn sie lernte, es direkt zu bändigen. Fast hatte ich Lust zu sagen: »Wenn Sie mit ihm zu sprechen lernen.«
Die Beziehung zwischen dem emotionalen Gehirn und dem »kleinen Gehirn« des Herzens ist einer der Schlüssel zur emotionalen Intelligenz. Wenn wir – im buchstäblichen Sinne – lernen, unser Herz unter Kontrolle zu bringen, lernen wir, unser emotionales Gehirn zu zähmen und umgekehrt. Denn die engste Bindung zwischen Herz und emotionalem Hirn ist diejenige, die vom so genannten peripheren autonomen (vegetativen) Bereich des Nervensystems hergestellt wird, der das Funktionieren all unserer Organe reguliert und sich sowohl unserem Willen als auch unserem Bewusstsein entzieht.
Das autonome Nervensystem besteht aus zwei Strängen, die, ausgehend vom emotionalen Gehirn, alle Körperorgane anregen. Der als ›Sympathikus‹5 bezeichnete Strang setzt Adrenalin und Noradrenalin frei und steuert Kampf- und Fluchtreaktionen. Seine Aktivität beschleunigt den Herzschlag. Der andere, als ›Parasympathikus‹ bezeichnete Strang setzt einen anderen Neurotransmitter frei, der in Zusammenhang mit Entspannungszuständen wirksam wird.6 Er verlangsamt den Herzschlag. Bei Säugetieren sind die beiden Systeme – die Bremse und das Gaspedal – ständig im Gleichgewicht. Das ermöglicht es ihnen, sich außerordentlich schnell an Veränderungen in ihrer Umwelt anzupassen. Wenn ein Kaninchen vor seinem Bau Kräuter knabbert, kann es innehalten, den Kopf heben, die Ohren aufstellen, mit denen es lauscht, und schnuppern, um einen möglichen Räuber zu entdecken. Gibt es kein Anzeichen für Gefahr mehr, kehrt es rasch zu seiner Mahlzeit zurück. Über eine derartige Anpassungsfähigkeit verfügen nur die Säugetiere. Um die unvorhersehbaren Kurven des Lebens zu nehmen, braucht man eine Bremse und ein Gaspedal; beide müssen in tadellosem Zustand sein, und beide müssen gleich leistungsfähig sein, um sich gegenseitig auszugleichen.

Abbildung 2: Das Herz-Hirn-System – Das halbautonome Neuronennetz des »kleinen Gehirns des Herzens« ist eng mit dem eigentlichen Gehirn verbunden. Zusammen bilden sie ein regelrechtes »Herz-Hirn-System«, und beide beeinflussen sich ständig gegenseitig. Dabei kommt vor allem dem aus zwei Zweigen bestehenden autonomen Nervensystem große Bedeutung zu; der »sympathische « Zweig beschleunigt den Herzschlag und aktiviert das emotionale Gehirn, der »parasympathische« wirkt als Bremse.
Nach dem amerikanischen Forscher Stephen Porges hat eben dieses ausgeklügelte Gleichgewicht zwischen den beiden Strängen des autonomen Nervensystems es den Säugetieren ermöglicht, im Lauf der Evolution immer komplexere soziale Beziehungen einzugehen. Die vielschichtigste sei die Liebesbeziehung, vor allem die besonders schwierige Phase der Verführung. Wenn ein Mann oder eine Frau, die uns interessieren, uns ansieht und unser Herz zum Zerspringen klopft oder wir erröten, dann hat unser sympathisches System aufs Gaspedal gedrückt – vielleicht ein wenig zu fest. Wenn wir tief durchgeatmet und wieder einen einigermaßen klaren Kopf haben und das Gespräch ganz natürlich wieder aufnehmen, haben wir in Wirklichkeit auf die parasympathische Bremse gedrückt. Ohne diese ständigen Anpassungen wäre eine Annäherung weit schwieriger und unterläge zahlreichen Fehlinterpretationen, wie so oft bei Jugendlichen, die noch Schwierigkeiten haben, ihr Gleichgewicht zu wahren.
Das Herz nimmt jedoch den Einfluss des zentralen Nervensystems nicht nur hin, sondern schickt auch Nervenfasern zur Schädelbasis zurück, die die Aktivität des Gehirns kontrollieren.36 Außer über die Hormone, den Blutdruck und das Magnetfeld unseres Körpers kann das ›kleine Gehirn‹ des Herzens daher auch über direkte Nervenverbindungen auf das emotionale Gehirn einwirken. Und wenn das Herz aus den Fugen gerät, reißt es das emotionale Gehirn mit. Genau das passierte Marie.
Der unmittelbare Reflex dieses Kommens und Gehens zwischen dem emotionalen Gehirn und dem Herzen ist die normale Veränderung der Herzschlagfrequenz. Da die beiden Stränge des autonomen Nervensystems immer im Gleichgewicht zu sein versuchen, beschleunigen und verlangsamen sie den Herzschlag ständig. Deshalb ist das Intervall zwischen zwei aufeinander folgenden Herzschlägen nie gleich.37 Diese Veränderlichkeit ist an sich gesund, denn sie ist das Zeichen für ein gutes Funktionieren der Bremse und des Gaspedals, folglich unserer gesamten Physiologie. Mit den Herzrhythmusstörungen, an denen bestimmte Patienten leiden, hat dies nichts zu tun. Tachykardien (plötzliche Beschleunigungen des Herzschlags, die einige Minuten andauern) oder Herzjagen bei Angstanfällen sind Zeichen für eine anormale Situation, in der das Herz nicht länger der regulierenden Wirkung der parasympathischen Bremse unterliegt. Im anderen Extremfall, wenn das Herz ohne die geringsten Schwankungen mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms schlägt, ist das ein höchst gefährliches Zeichen. Geburtshelfer erkennen es als Erste: Bei einem Fötus spiegelt es während der Geburt eine möglicherweise tödliche Störung wider, die sie sorgfältig überwachen. Ebenso lässt es bei einem Erwachsenen darauf schließen, denn man weiß mittlerweile, dass das Herz erst einige Monate vor dem Tod mit einer solchen Regelmäßigkeit zu schlagen beginnt.