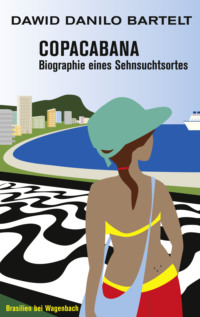Kitabı oku: «Copacabana», sayfa 3
Die zweite Eroberung Brasiliens Naturforscher und Rio-Reisende im Dienste ihrer Zivilisation
Nichts von dem, was ich bisher gesehen habe, kann sich in seiner Schönheit mit dieser Bucht vergleichen. Neapel, die Firth of Forth [in Schottland], den Hafen von Bombay und Trincomalee [im heutigen Sri Lanka] hielt ich alle für perfekt, aber alle müssen hier zurückstehen; die Bucht übertrifft sie alle in je eigener Weise. Erhabene Berge, Felsen, die sich zu Säulen auftürmen, edle Hölzer, helle Blumeninseln, grüne Ufer, dazwischen weiße Häuser; jede kleine Erhebung krönt eine Kirche oder ein Fort; Schiffe vor Anker oder auf Kurs; und unzählige flinke Boote, dazu das angenehmste Klima – all dies zusammen macht Rio de Janeiro zur bezauberndsten Szenerie, die die Einbildungskraft nur hervorbringen kann.
Hätten wir daneben gestanden, wir hätten wohl die Feder vibrieren gesehen, mit der die Engländerin Maria Graham am 15. Dezember 1821 dies notierte. Dieser Augenblick hatte über drei Jahrhunderte den Charakter einer Grenzerfahrung: »Für jeden Menschen stellt die erste Einfahrt in die Bucht von Rio de Janeiro einen prägenden Einschnitt in sein Leben dar«, war sich Reverend Daniel Parish Kidder sicher, der ihn etwa 20 Jahre später erlebte. Der Anblick der Bucht habe die Kraft, einen Menschen zur Einsicht in die Göttlichkeit der Schöpfung zu bewegen. Die Inselkette an der Buchteinfahrt erinnerte den Geistlichen an die Säulen vor dem Tempel von Luxor, die Bergkette im Hintergrund rief in ihm Alpenbilder wach. Viele Autoren bemühten Analogien aus der Weltgeschichte; der Engländer William Scully sah die Stadt »hingestreckt, wie das alte Rom über das Amphitheater seiner sieben Hügel und der dazwischenliegenden Täler«. Der englische Tuchhändler John Luccock vermutete wenige Jahre nach der Ankunft des portugiesischen Hofstaats in diesem Stück Natur-Kultur gar politisch relevante Kräfte: »Der kalte und phlegmatische Politiker des Nordens hat selten die Wirkung einer schönen Gegend auf die menschliche Seele berechnet; sonst würde er wohl nicht erwartet haben, daß der portugiesische Hof seinen neuen Aufenthaltsort verlassen sollte. Dies ist ein stiller, aber mächtiger Sachwalter; seine Wirkung ist allgemein und immerwährend; sie wird bei jedem Aufgang der Sonne erneuert und von jedem Strahl des Mondes unterstützt.«
Und noch gut einhundert Jahre später empfanden viele die Landung in Rio wie Stefan Zweig als »einen der mächtigsten Eindrücke, den ich zeitlebens empfangen«, waren »fasziniert und gleichzeitig erschüttert«.
Zweifelsohne bot und bietet die Bucht von Guanabara ein besonderes Schauspiel: ein Ensemble von Wasser, Inseln, schroffem Bergfels, üppiger Flora und Barockarchitektur, im Panoramablick vom Oberdeck aus zu erfassen. Schönheit, Erhabenheit, Panorama – das sind Schlüsselkategorien des Pittoresken, das die europäische Ästhetik seit dem späten 18. Jahrhundert bestimmte. Zwischen Französischer Revolution und Zweitem Weltkrieg war Brasilien neben Mexiko für Europäer und US-Amerikaner das beliebteste Reiseland Iberoamerikas. Das galt nicht zuletzt für solche Reisende, die ihre Erfahrungen verschriftlichen wollten. Das wohl beste Verzeichnis Bibliografia do Rio de Janeiro de Viajantes e Autores Estrangeiros von Paulo Berger nennt rund 2000 gedruckte Ausgaben von Reiseberichten (Übersetzungen eingeschlossen) zwischen 1531 und 1900, die Betrachtungen zu Rio de Janeiro enthalten. Das 19. Jahrhundert lieferte die reichhaltigste Produktion. Nach 1800 hörte das Fernreisen auf, ein aristokratisches Privileg zu sein. Es war vielleicht das Jahrhundert der Entdeckungsreisen, in dem Menschen des Nordens die Länder des Südens naturwissenschaftlich vermaßen und kartographierten. Fast alle Brasilien-Reisenden, ob sie dem Amazonas, dem dürren Hinterland des Sertão, den deutschen Siedlungen im Süden oder dem noch weitgehend unbekannten brasilianischen Zentralplateau zustrebten, wählten Rio als Start- und Zielort ihrer Exkursionen und Feldforschungen, von den in Geschäften und im Dienst der Diplomatie Reisenden einmal ganz abgesehen. Rio de Janeiro diente ihnen als Schleuse, Übergangszone zwischen Vertrautem und Fremdem; als Ort der langsamen Gewöhnung ans Klima wie an die Kultur. Zentral für die Erkundung der Neuen Welt durch diese Reisenden aber war etwas, was sich in der Bucht von Guanabara in schönster Verklärung zeigte: die Natur.
Kleingeschrieben: Wirkungen europäischer Wissenschaft
»Der allgemeine Eindruck ist wahrhaft erhaben. Aber als der Segler sich der kahlen Küste nähert, sehen wir die besonderen hellblättrigen Bäume Brasiliens, hier und da einen purpurblühenden Quaresma-Baum, wir beobachten die schlangenartigen cacti, wir sehen, wie die reich wuchernden Parasitenpflanzen sogar von den steilen und schroffen Wänden des Zuckerhuts herunterhängen …«
Pfarrer Kidder war durchaus keiner der vielen Botaniker, die Brasilien auf der Suche nach Katalogisier- und Benennbarem durchkämmten, wie die Deutschen Prinz zu Wied-Neuwied, Johann Baptist von Spix und Carl Friedrich von Martius, der Schweizer Louis Agassiz oder der Brite George Gardner, um nur einige der bekannteren zu nennen. Dennoch war die tropische Flora und Fauna ihm besondere Aufmerksamkeit wert, denn in ihr spiegelte sich die Seele dieser Neuen Welt und zugleich ihre Unterlegenheit. Die Lehre des französischen Naturforschers Georges-Louis Leclerc de Buffon, wonach Amerika als feuchter Erdteil ein ungesunder, seine Fauna degenerierender Kontinent sei, war im Europa des 19. Jahrhunderts noch weithin akzeptiert. Für viele andere Autoren war die Bevölkerung des neuen Kontinents zivilisatorisch notwendig unterlegen. Wenige Seiten in Henry Thomas Buckles voluminöser History of Civilization in England über ein Land, das der Autor nie gesehen hatte, stürzten brasilianische Intellektuelle in Verzweiflung. Buckle, der in »Klima, Boden, Nahrung und dem allgemeinen Aspekt der Natur« die wichtigsten Einflussfaktoren auf die menschliche Rasse sah, zählte Brasiliens Natur in ihrer unvergleichlichen Fruchtbarkeit und Üppigkeit zu den Weltwundern. Doch das übermäßige Zusammentreffen von Hitze und Feuchtigkeit überfordere eine unfähige Bevölkerung, so der 1862 verstorbene Brite:

Blick auf die Bucht von Guanabara (um 1880)
»Wie alle Menschen in der Kindheit ihrer gesellschaftlichen Entwicklung stehen die Einheimischen der Unternehmung ablehnend gegenüber … Entlang der Küste Brasiliens hat europäischer Einfluss zu einem gewissen Grad von Zivilisation geführt, den die Einheimischen aus eigener Kraft nie erlangt hätten. Aber diese sehr unzulängliche Form von Zivilisation hat hintere Winkel des Landes nie erreicht … In ganz Brasilien lassen sich keine Monumente einer Zivilisation auffinden, nicht einmal einer niedrigen; es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Menschen sich jemals über den Stand erhoben hätten, in dem sie sich befanden, als man ihr Land entdeckte.«
Buckles vernichtendes Urteil ist in Brasilien mehrfach übersetzt und weithin gelesen worden. Das gilt auch für die Reisebeschreibung des bekannten Naturforschers Louis Agassiz. Anders als Buckle oder auch Buffon hatte sich Agassiz immerhin in Brasilien aufgehalten – und dort eine paradigmatische Bestätigung der Rassentheorien europäischer Wissenschaft vorgefunden:
»Ein jeder, der an der schädlichen Wirkung der Rassenmischung zweifelt, und aus falsch verstandener Philanthropie die Schranken zwischen den Rassen niederreißen will, sollte nach Brasilien kommen. Dann wird er die üblen Folgen nicht mehr leugnen, die aus der Verschmelzung der Rassen entstehen, einer Verschmelzung, die hier weiter reicht als in jedem anderen Land der Welt, und die die besten Qualitäten des weißen Mannes, des Negers und des Indio auslöscht, um sie durch einen undefinierbaren Bastard-Typuszu ersetzen, dem es an körperlicher wie seelischer Energie gebricht.«
Die Natur ringt mit der Kultur oder, wie man damals eher sagte, mit der Zivilisation. Europäer und US-Amerikaner sehen darin den Urkonflikt jener überseeischen Länder und Völker, und einen, den sie nur verlieren können. So erhaben sich die Natur darstellt, so unzulänglich zeigt sich den Reisenden das, was an Zivilisatorischem, wie beispielsweise in der nachlässigen Pflege der Kaffeeplantagen, erkennbar ist.
Beständig konstatieren Europäer in ihren Texten über Rio einen Mangel: Rio ist kaum herrschaftlich, als Kaiserresidenz nicht präsentabel, hat kaum Straßen, die den Namen verdienen, und die Abwasserentsorgung ist ein Gräuel.
Brasilien war nicht nur der zu erwartenden Fülle von Eindrücken wegen als Reise- und Forschungsland besonders beliebt. In den meisten der jungen hispanoamerikanischen Republiken herrschte politische Unrast. Im Ringen um die Macht war die Waffe schnell bei der Hand. Das Kaiserreich Brasilien wartete hingegen mit politischer Stabilität und mehr Sicherheit auf. Das große Territorium versprach vielfältige Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Klimazonen, ohne die Unbill von Grenz- und Zollschranken fürchten zu müssen.
Das lange 19. Jahrhundert ist als das »Jahrhundert der Wissenschaften« gekennzeichnet worden, und diesem Trend hatte sich auch Brasiliens Kaiser Pedro II. verschrieben. »Die Wissenschaft bin ich«, soll er einmal gesagt haben, wohl mit Augenzwinkern in Richtung eines berühmteren Amtskollegen im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Im Zuge der Aufklärung differenzierten sich Natur- und Gesellschaftswissenschaften im 19. Jahrhundert aus, Voraussagen anhand empirisch ermittelter Fakten wurden zum neuen Glauben der Zeit, und der Wissenschaftler zur gesellschaftlich relevanten Figur. Nach Brasilien gelangten die vielen neuen Ideen mit Verspätung und fanden nur selektive Aufnahme: Bei den Intellektuellen einer postkolonialen, »rassisch gemischten« Gesellschaft standen Positivismus, Sozialdarwinismus und rassistische Theorien hoch im Kurs. Unter Pedro II. entstanden die ersten rechtswissenschaftlichen und medizinischen Fakultäten, historisch-geographische Institute und naturwissenschaftliche Forschungs- und Bewahrungseinrichtungen. Mit Ausnahme des von Pedros Großvater João VI. gegründeten Nationalmuseums in Rio wurden Naturkundemuseen und Botanische Gärten allerdings erst im letzten Drittel des Jahrhunderts verwirklicht. Bis dahin war das Sammeln und Bezeichnen der brasilianischen Flora und Fauna ausschließlich Sache der ausländischen Experten, und Pedro II. unterstützte sie kräftig dabei.
In ihrem Hochzeitsgefolge brachte die Habsburgerin Leopoldine von Österreich im Juli 1817 zahlreiche deutschsprachige Künstler und Wissenschaftler mit nach Rio. Die bekanntesten waren wohl die Deutschen, darunter die bereits erwähnten von Spix und von Martius, die neben Gesteins- und Mineralienproben 85 Säugetiere, 350 Vogelarten, 130 Amphibien, 116 Fische, 2.700 Insekten und 6.500 Pflanzenarten sammelten. Ihre dreibändige Reise nach Brasilien in den Jahren 1817 – 1820 wurde auf Jahrzehnte hin zum Standardwerk für naturwissenschaftliche Forschung zu Brasilien. Die Sammlung wurde vollständig in den Botanischen Garten von München verfrachtet, und an Pflanzen hatten beide alsbald geadelten Forscher so viel Dubletten dabei, dass auch Herbarien in Berlin, Leipzig, Wien, Petersburg, Leiden, Genf und das British Museum in London bedacht werden konnten. In Brasilien verblieb nichts – oder doch: das von den Europäern freundlicherweise vermittelte Wissen, wie die vielen Arten, die schon immer da waren und auch schon einmal Namen gehabt hatten, denn nun hießen.
Die Botaniker und Zoologen beschränkten sich in ihren Texten keineswegs auf ihren Forschungsgegenstand im engeren Sinne. Wie die anderen Autoren traten sie auch an, die Geschichte und Gesellschaft, Ökonomie und Politik Brasiliens systematisch und vor allem so »wahrhafftig« zu beschreiben, wie es schon frühe Reisende des 16. Jahrhunderts betonten. Beispiele hierfür sind der hessische Landsknecht Hans Staden und seine Wahrhafftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen von 1557 oder wenig später der Bayer Ulrich Schmidel, der die Wahrhafftige und liebliche Beschreibung etlicher fürnemen Indianischen Landtschaften und Insulen … vorlegte.
Die Autorinnen und Autoren des 19. Jahrhunderts hielten sich ausnahmslos für berufen und befähigt, Brasilien »als solches« mit Autorität und Wahrhaftigkeit zu beurteilen. Ihr unauflösliches Amalgam aus individuellen Erfahrungen, Gefühlen und vorgeprägten Vorstellungen verwandelte sich in kollektives Wissen mit Echtheitssiegel. Aus heutiger Sicht vereinigen die Reiseberichte jener Zeit oft verschiedene Textarten in sich: Forschungsbericht, Reportage, Roman, Geschichtsschreibung, Manifest und Drama.
»Der Reisende ist zwar aus seiner Heimat gefahren, aber nicht aus seiner Haut«, wie Friedrich Katz in seinen Begegnungen in Rio 1945 feststellt. Wenn sie über Fernes und Fremdes schreiben, berichten Reisende auch immer über sich selbst, und manchmal mehr als über ihren Gegenstand. Das Fremde in ihren Texten entsteht, indem sie den anderen Europäern daheim von dem erzählen, was ihnen bekannt vorkommt, und das Gesehene so bewerten, wie sie und die Leser es gewohnt sind. Das ist kaum anders möglich und bedeutet doch, dass die Neue Welt, wie sie in diesen Texten erscheint, auch eine Erfindung durch den spezifisch europäischen Blick ist. Dieser ist geprägt von der tiefen Überzeugung zivilisatorischer Überlegenheit, von Jahrhunderten selbstverständlicher kolonialer Praxis und dem unerschütterlichen Glauben an einen Determinismus, nach dem »Rasse«, »Natur« und »Klima« Faktoren sind, die die Tropen und ihre Bewohner im Wettstreit der Nationen unrettbar hintanstellen.
Man könnte auch sagen: Die Reiseliteratur trägt dazu bei, die globale Peripherie zu produzieren; das, was später »Dritte Welt« genannt werden sollte. Daher sind die europäischen und US-amerikanischen Reiseberichte wichtiger und fortwirkender Teil der lateinamerikanischen Wirklichkeit zwischen dem 18. und dem frühen 20. Jahrhundert. Sie setzen Wahrheiten, mit denen sich die also Beschriebenen auseinandersetzen müssen. Mit Blick auf die Reisenden, die Geschäftsleute, Maler und Zeichner, Naturwissenschaftler, Söldner und auch die vielen Einwanderer aus Europa hat der brasilianische Historiker Sérgio Buarque de Holanda von einer »zweiten Entdeckung Brasiliens« gesprochen. Die Schriften und ihre Folgen für die Entstehung einer brasilianischen Literatur und Wissenschaft, aber auch für die Auseinandersetzung um nationale Identität und die richtige Gesellschaftspolitik könnte man auch als eine zweite, semantische Eroberung bezeichnen. Der europäische Spiegel steht weiterhin im brasilianischen Schlafzimmer, und er wird uns noch mehrmals begegnen.

Das Bild von Johann Moritz Rugendas, »Praya Rodriguez: près de Rio de Janeiro« (1835), zeigt Copacabana als unberührtes, palmenbestandenes Areal mit einem einzigen sichtbaren Haus
Sandbank und Fels – Copacabana wird noch nicht entdeckt
Zurück in die Bucht von Guanabara: Es gibt eine große Gemeinsamkeit der Rio-Reisenden des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie verschwenden bei ihrem Erstkontakt keinen eigenen Blick auf die Vielzahl der Strände, die die Fächer der Bucht zu bieten haben. Und auch im Zweitkontakt vermögen die Strände Rios wenig zu beeindrucken. Maria Graham, in Rio bald Zofe der späteren portugiesischen Königin Dona Maria, besuchte in der Umgebung von Rio nicht nur Kaffeeplantagen. Bei ihrem zweiten Rio-Aufenthalt zwei Jahre später stattete sie auch Copacabana einen Besuch ab:
»Ich schloß mich einem angenehmen Ausritt nach Copacabana an, einem kleinen Fort, das eine der kleinen Buchten hinter der Praia Vermelha verteidigt. Von dort hat man eine der schönsten Aussichten hier. Die Wälder der näheren Umgebung sind wunderschön und bringen eine exzellente Frucht in großen Mengen hervor, die Cambucá genannt wird; und zwischen den Hügeln finden sich Opossums und Gürteltiere in großer Zahl.«
Zehn Jahre später erlebte der Franzose Jean-Baptiste Debret Copacabana so:
»Mitten im Sand erblickt man die kleine Kirche, die sich auf einem kleinen Plateau erhebt. Rechts davon bildet eine Berggruppe eine zweite Ebene. Sie fällt zum Meer ab und verdeckt den Bogen dieser Sandbank. Dahinter taucht ihr äußerstes Ende auf mit seinen Feldern, geschätzt für ihre köstlichen Ananas-Früchte …«
Auf der Suche nach dem Pittoresken schweift der Blick auch über die »Sandbank« hinweg. Maria Graham erlebte den Strand von Gamboa sogar als »einen der angenehmsten Orte, die ich je betrachtet habe, mit einem wunderschönen Panorama, das alle Richtungen beherrscht«. Gamboa wurde im 20. Jahrhundert erst vom Hafen absorbiert, dann ganz eingedeicht und ist heute ein Stadtteil im Zentrum Rios.
Doch nicht einmal John Luccock, wiewohl als Brite aus dem Land der Seebadpioniere, war beim Anblick eines wahrhaftigen Badeparadieses der Gedanke an ein Eintauchen zu entlocken: Mit seinen Begleitern gelangte er zu einer »Bai, die unserer Beachtung wert schien. Sie wird auf der einen Seite vom festen Lande begrenzt, auf der anderen durch eine Restinga oder Sandbank, welche die See als Grenze sich gebildet hat. Diese Bank besteht aus weißem Sand, erhebt sich 20 Fuß über die Oberfläche der See und ist im Durchschnitt 400 Ruten breit und 20 englische Meilen lang. Größtenteils, besonders in der Mitte, ist sie ganz kahl, an andern Seiten ist sie mit verschiedenen Flechtenarten bedeckt, welche den Boden zusammenhalten, auf dem Gipfel wachsen ein wenig Unterholz und am nördlichen Ende etwas Mangle [Mangrovenbäume, D.B.]. Nach der See zu ist sie steil und die Brandung heftig; nach der Bai zu ist sie eben und sanft abhängig.«
Der Blick geht immer weg vom Strand. Der Sand hat keinen Wert, so weiß er auch ist. Weder Wellen noch ruhiges (und sicher angenehm warmes) Wasser wecken Lust auf ein Bad. Copacabana besticht durch das Panorama, interessiert aber vor allem unter militärischen Gesichtspunkten:
»Wer die Mühe nicht scheut und eine mannigfache Aussicht liebt, wird sich reichlich belohnt finden, wenn er den Telegraphen besteigt. [Dort] steht auf einem vorspringenden Felsen ein kleines Fort, welches sehr fest durch seine Lage ist, aber in jämmerlich zerfallenem Zustande sich befindet, und ohne eine einzige brauchbare Kanone, obgleich es eine Korporalwache hat. Diese Vernachlässigung ist indeß verzeihlich, indem es zu weit abliegt, um die Küste zu bestreichen, wo überdies auch die heftige Brandung die sicherste Vertheidigung ist, an den beiden äußersten Punkten der Bai ausgenommen. Der südlichste wird durch die runde, fast verfallene Kapelle Copo Cabano [sic!] verschönert. Diesen Ort sollen Schleichhändler sehr oft benutzen, indem die Wege ins Innere schmal und schwer zu passiren sind.«
Berufsspezifisch ist der Blick, den der Franzose Francis de Laporte de Castelnau um 1850 über Copacabana schweifen lässt. Auch er kommt über den Telegraphenhügel, den heutigen Babilônia, und findet sich nach steilem Abstieg »inmitten einer weißen Sandzunge, und das registriert man mit Interesse in diesen großen Ebenen: man findet keinen höheren Baum, nur hier und da einige Büsche, die wie Oasen aus dem Sand wachsen und sich aus sehr unterschiedlichen Pflanzen zusammensetzen, offenbar vor allem den Familien der Myrtazeen, der Guttiferen und der Leguminosen zugehörig …«
Es folgen lange Ausführungen über Beschaffen- und Besonderheiten von Früchten, Kakteen und anderen diesen Familien zugehörigen Pflanzen, über welchen der Botaniker gänzlich vergisst, dass er sich an einem sanft geschwungenen weißen Sandstrand befindet, der ihn auch anders entzücken könnte.
Auch das Buch des Deutschen Carl Schlichthorst über Rio de Janeiro, wie es ist legt vor allem Zeugnis ab über Schlichthorst und wie es ihm geht: schlecht natürlich, ist er doch ein arbeitsloser Soldat, der in Brasilien auf Reichtum und eine steile Karriere in der Kaiserlichen Armee hoffte und sich nun stattdessen, vor Heimweh krank, als Fremdenlegionär niedrigeren Patents und als Dolmetscher durchschlagen muss. Das Selbstbewusstsein, mit dem er seine mehr visionären als beobachtenden Beschreibungen dem Leser präsentiert, verhält sich proportional zum Mangel an Portugiesischkenntnissen. Das verschafft uns Einsichten von unfreiwilliger Komik. So sei die außerordentliche Fruchtbarkeit der Brasilianerinnen, die angeblich nicht selten zwölf bis 16 Kinder gebären, dem Zusammentreffen dreier Umstände zu verdanken: Die Frauen sitzen mit untergeschlagenen Beinen, sie schnüren sich nicht die Brüste ab, wie in Europa üblich, und sie baden sehr häufig. Die örtliche Geographie erfährt bei Schlichthorst eine einzigartige Benennung, und so wird aus Copacabana »Punto da Cabana«. Aus seinen Träumen von einer baldigen Heimreise weckt ihn sanft ein »liebliches Negermädchen«, das eine in Brasilien ansonsten unbekannte »Marimba« spielt und dieses schwere Standinstrument aus Holz und Kalebassen überraschend zwischen den Fingern hält; ein Mädchen »in der Blüthe ihrer Jahre, von herrlichstem Gliederbau, Augen wie Sterne, einem Mund, frisch wie eine eben aufgebrochene Rosenknospe, und Zähnen, welche Perlen an Glanz und Weiße übertreffen«. Sie übergibt das Instrument einer zweiten Frau, »dem Gewichte nach auch eine wahre afrikanische Schönheit«, und beginnt einen »Faddo« zu tanzen, womit der Fado gemeint sein dürfte, der im 18. Jahrhundert immerhin in einer brasilianischen tanzbaren Variante bekannt war. Das Ganze schaut sich Schlichthorst nach eigener Auskunft »mit aller Behaglichkeit eines westindischen Pflanzers« an, gemütlich auf einer Bank vor der Kirche ausgestreckt und eine Zigarre rauchend. Das »schöne Mohrenkind« singt zum Tanze dem Deutschen zufolge dieses Lied: »Auf Erden giebt’s kein Paradies! / Doch wär’ am Cariocanerstrand / Mein heißgeliebtes Vaterland, / Ich träumt’, ich wär’ im Paradies!«
Es ist hier nicht die Absicht, sich über den Autor lustig zu machen, sondern zu belegen, wie die Reisenden des 19. Jahrhunderts auch reisten: auf dem Eisbrecher ihrer Vorstellungen, der noch jedes Gestade erreicht hat. Indem sich in und an Copacabana seine erotischen Phantasien entzünden, macht Carl Schlichthorst allerdings eine für den Ort zukunftsweisende Vorläufererfahrung.