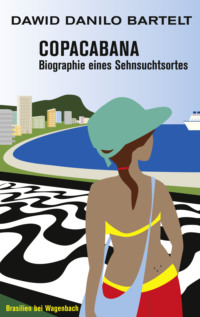Kitabı oku: «Copacabana», sayfa 4
Der König geht baden Die späte Lust am Strand in Rio de Janeiro
Der Sand dieses Strandes ist weiß, wie die Schaumkronen der Wellen, die sich auf ihm brechen. Wer es liebt, vom tiefen, starken Grollen der Wellen unterhalten zu werden, die vom grünen Atlantik heraufrollen, wird kaum einen besseren Ort dafür finden. Und wer einmal die erhabene Herrschaft der Wellen genossen hat, die sich hier beeilen, ihm zu Füßen zu liegen, wird sich danach sehnen, diese Szene wieder und wieder zu erleben.
Reverend Kidder, der Methodist aus Darien, New York, hat unter den Reisenden seiner Zeit wohl den zärtlichsten und zukunftsträchtigsten Blick auf Copacabana. Man ahnt, welch pure, intime und trotzdem verdrängte Lust am Strand in diesen Worten mitschwingt. Doch die niedergeschriebene Geschichte des Meerbades in Brasilien beginnt nicht mit dem Seufzer des Ästheten angesichts der ihn umgebenden Erhabenheiten. Ihr Anfang ist weitaus nüchterner, man möchte fast sagen: klinisch. Zepter und Äskulapstab gingen eine prägende Verbindung ein, als den Herrscher des portugiesischen Weltreiches João VI. um 1817 – der Berichterstatter Calmon gibt kein genaues Datum an – im brasilianischen Exil eine Zecke biss.
Der Biss entzündete sich, den König warf ein hohes Fieber darnieder, der Hof fürchtete um sein Leben. Die Ärzte verordneten ein Salzwasserbad, was – wie wir noch sehen werden – keineswegs ein altbewährtes Heilverfahren war. König João VI. hatte das Meer vor der Tür, also ließ er eine große Holzkiste – vermutlich eher eine Art Holzkäfig – fertigen und sich darin am Strand von Caju von einigen starken Seeleuten ins Wasser tragen, sodass er sich gesichert und etwa hüfthoch dem therapeutischen Fluidum aussetzen konnte.
Der König stieg also nicht freiwillig ins Wasser. Und in der Tat kam selbst in der positiv wahrgenommenen Landschaft Rios im 19. Jahrhundert der Badestrand praktisch nicht vor.
Der Strand, den wir mit »Copacabana« assoziieren, ist ganz jung. Die »Traumstrände« waren zwar schon immer da, nur träumte niemand von ihnen.
Kaum einer der großen Seefahrer aus Portugal wäre wohl auf die Idee gekommen, freiwillig im Meer zu baden. Cabral, Gonçalves und Co. konnten nicht verstehen, dass die brasilianischen Indios so oft und offenbar mit Vergnügen in die Flüsse sprangen und sich ausgiebig reinigten, aber auch gerne in der Brandung ihres Ozeans plantschten.
Die Angst des Europäers vor dem Meer
Über Jahrhunderte hinweg ging den Europäern ein Bad im Meer wider alle Vernunft, aber auch wider allen Mythos. Denn das Meer war offen, noch nicht von Menschen durch- und vermessen und geprägt von einem unberechenbaren Chaos, das in der Vorstellungswelt der Zeitgenossen unter seiner Oberfläche tobte. Die mythologische Meeresfauna kennt gewaltige Schlangen, Wale oder den Leviathan, den biblischen Drachen. Überhaupt prägt die Bibel das Bild vom Meer als Hort von Unordnung und Instrument göttlicher Strafe, so zum Beispiel durch die Sintflut.
»Sein Brausen, sein Brüllen, die tosenden Ausbrüche seines Zorns können immer aufs neue als Erinnerung an die Sündhaftigkeit der ersten Menschen verstanden werden, die in den Fluten untergehen mußten«, wie es der Kulturhistoriker Alain Corbin in Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750 – 1840 (im französischen Original: Le territoire du vide) beschreibt.
Man darf nicht vergessen, dass die Mythologie höchst realen Verlusterfahrungen entsprach. Seefahrt war ein äußerst riskantes Unternehmen. Piraten, vor allem aber Stürme lauerten auf die Mutigen. Im Zeitalter der Entdeckungsreisen hatte sich die Schiffstechnik verbessert, doch zugleich nahmen Entfernungen und Wagnis zu. Die Flotte unter dem Kommando Pedro Álvares Cabrals, die im April 1500 Brasilien »entdeckte« und dann nach Indien weitersegelte, startete in Lissabon am 9. März 1500 mit 13 Schiffen. Am 23. Juni 1501 hatten es sechs, möglicherweise gar nur vier Schiffe geschafft, nach Lissabon zurückzukehren.
Noch bis etwa 1840 standen die Meereskatastrophen im Zentrum der Naturgeschichte der Erde und dann der Geologie. Im Angesicht des Meeres bleibt die Naturbetrachtung nicht bei der Naturwissenschaft stehen; Meer ist im Wortsinn Metaphysik. Erst die Expeditionen der Frühen Neuzeit, die ein ganzes Weltbild umstoßen, weil ihr Entdeckergeist das grenzenlose Meer einhegt, und die Ordnungsleistungen der Kartographie (wie die Erfindung der Längengrade im 18. Jahrhundert) machen den Ozean für das aufgeklärte Individuum beherrschbar.
»Küste«, »Ufer« und »Strand« hingegen scheinen fest umrissene und abgrenzbare Fix- und Orientierungspunkte zu sein. Doch auch die Küste ist ein Raum mit unscharfen Rändern, an denen sich die Elemente in unterschiedlicher Weise durchdringen.
Die Definition des Strandes im Duden trägt dieser Unsicherheit Rechnung: »Das flache und sanft ansteigende Ufer des Meeres, seltener eines Flusses oder Sees, das beim höchsten Wasserstand gewöhnlich noch überflutet wird; im allgemeinen besteht es aus Sand und kann von unterschiedlicher Länge und Breite sein; wird häufig mit dem Wort ›Küste‹ gleichgesetzt, bezeichnet aber nicht so sehr das rein sachlich Festgestellte und Gegebene, sondern beschreibt das dem Sprecher in irgendeiner Weise freundlich oder belebt erscheinende Ufer.«
Der Strand ist also weniger ein Faktum oder eine topographische Gegebenheit, sondern eher das Ergebnis einer Haltung. Der Strand ist ein kulturelles Produkt mit einer eigenen veränderlichen Materialität, jenseits von Sand, Salzluft, Sonnenschein und Brandung – und in Europa galt die Küstenlinie, das Grenzgebiet des monströsen Meeres, eben lange als ein Panoptikum der Katastrophen, an dem Wrackteile und Leichen einzusammeln waren. Und noch im 17. und 18. Jahrhundert glaubten Mediziner fest daran, dass das Meer Fäulnis errege.

Badekarren in Brighthelmstone um 1790 – Stich von Samuel Alken
Es wäre allerdings falsch zu sagen, dass die späte Sympathie für den Strand eine originäre Erfindung der Neuzeit wäre. Selbst wenn wir uns auf die europäische Kultur beschränken und bekennen, dass wir nicht wissen, ob die Tupinambá-Jugend, der Polynesier »als solcher« und die Hawaiianerinnen nicht seit jeher die Freuden des Strandes genossen haben: Schon die alten Römer hatten eine Art, sich zur Küste zu verhalten, die uns sehr bekannt vorkommt. Dieses Konzept nannte sich otium und meinte einen der römischen Oberschicht vorbehaltenen Zeitvertreib von Niveau, wie zum Beispiel Lektüre, philosophisches Gespräch, Spaziergänge und andere körperliche Ertüchtigungen. Diese Form der Selbstfindung brauchte besondere Orte. Gegen Ende der Republik kamen bei Cicero, Cäsar, Mark Anton und vielen anderen Villen in der Umgebung des kampanischen Küstenortes Pozzuoli in Mode. Dort standen Lustfahrten über das Meer, Wassersport, Bankette im Freien und Musik an.
Mit dem Untergang des Römischen Reiches aber schwand die Lust am Strand in Europa, und das Interesse an der Küste als »Landschaft« wich der mittelalterlichen Angst und Abscheu vor Ufer und Meer.
Dass Einzelne immer Vergnügen darin gefunden haben, sich am Strand aufzuhalten, dürfen wir annehmen. Doch von einer Konvention des Strandbesuchs oder einer ästhetisch verarbeiteten Naturanschauung der Küste kann erst im 18. Jahrhundert die Rede sein. Dafür brauchte es, so Corbin, das Ineinander von drei Entwicklungen, um Abscheu in Bewunderung zu verwandeln. Eine neue theologische Naturauffassung rechnete Meer und Küste nun dem Gesamtwerk der göttlichen Schöpfung zu, und die Grand Tourists entdeckten in Italien auf der Suche nach der Antike die Schönheiten der Strände. Doch vor allem war eines ausschlaggebend: Ärzte schickten ihre Patienten ans Meer, als sie die Heilkraft seines Wassers wie seiner Luft für Lungenkranke und Nervenleidende erkannten.
Die Europäer bedurften also der strengen Aufforderung jener Autorität, der sich auch João VI. unterwarf: der Medizin. Mitte des 18. Jahrhunderts folgten Lords und Earls dem Anraten britischer Hofärzte und ließen vorsichtig die See an ihre Haut heran. Der Landarzt Richard Russell hatte im Fischerdorf Brighthelmstone die spätere Thalassotherapie entwickelt, die Drüsenkranken Meerwasser verordnet. Der Gedanke war wirklich revolutionär: Das todbringende Meer konzentrierte nun in sich die Lebenskraft, die Meerluft ließ den Körper gesunden. Brighthelmstone wurde zu Brighton, dem bis heute wohl berühmtesten Seebad.
In vielen Seebädern entstanden auch Krankenhäuser, die die Badetherapie medizinisch flankierten, der Reichtum an Salzen, dazu Plankton, Algen und anderes aquatisches Kleingetier machten Meerwasser zum Multivitamin-Powerdrink des 18. Jahrhunderts.
Für die Entwicklung in Deutschland machte Georg Christoph Lichtenberg mit dem Besuch der englischen Seebäder eine »gute Entdeckung«, die er 1793 im Göttinger Taschen-Calender kundtat. Lichtenberg spielte die bereits etablierten Kur- gegen die neuen Seebäder aus, indem er erstere lobte, jedoch auf die noch heilsamere Wirkung des Meerblicks hinwies. Der Umweg über das Spa erleichterte mit Rücksicht auf kulturelle Gewohnheiten den Weg zum Strand erheblich. Nach einem positiv verlaufenen Probebad des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin in der Ostsee entstand 1794 in Heiligendamm das erste deutsche Seebad.
Doch von Sinnlichkeit war der Strandaufenthalt auch nach Entdeckung der Seebäder noch weit entfernt. In Europa kamen zunächst die sogenannten bathing machines zum Einsatz, die teils noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch waren. Das waren mobile Bretterverschläge mit angeschlossenem Zelt, die vier bis sechs Personen aufnahmen. Ein Fuhrmann leitete das einspännige Gefährt ins Wasser, und die Badegäste, die sich unterwegs entkleidet hatten, stiegen, vor den Blicken der Umwelt geschützt, über eine am Gefährt befestigte Treppe hinab in die heilenden Fluten. Das Wasser musste übrigens kalt sein. John Floyer, Autor des Standardwerks History of Cold Bathing, empfahl 1702 eine Badetemperatur von unter zehn Grad Celsius!
Der Strand selbst hatte als Kulisse der Seebäder lediglich funktionalen Charakter, da er den Übergang ins flache Therapeutikum ermöglichte. Die Lust am Strand stellte sich mit den Seebädern keineswegs sofort und zwingend ein, begegnete man dort einer aufkeimenden »Vergnügungssucht« doch mit rigiden Baderegeln und beschränkte so den Strandbesuch auf das medizinisch notwendige Minimum. Da die Mediziner auch für die Seebäder von Anbeginn das Nacktbaden forderten, wird man leicht einsehen, dass jede Kulturgeschichte des Strandes zugleich auch seine Sittengeschichte ist. Seitdem die Lust am Meer erwacht war, hatten Behörden mit der Regelung der Geschlechter- und Textilienfrage zu tun. Historikern zufolge war Nacktbaden an englischen Küsten im 18. Jahrhundert die Norm, bei Männern noch weit ins 19. Jahrhundert verbreitet. In deutschen Seebädern war der ärztliche Rat nur mit Hilfe der Badekarren, also individuell und bei vollem Sichtschutz, umzusetzen. Am Strand trennten sich die Geschlechter und verhüllten sich in Ganzkörperwolle, die die Zeitläufte dann von Knöcheln und Handgelenken aufwärts Zentimeter für Zentimeter auflöste – bis zum Tanga und dem fio dental (»Zahnseide«), jenem textilen Nichts aus drei kleinen Nylondreiecken und etwas dünner Schnur, das die Brasilianerinnen in den 1970er Jahren zu tragen begannen. Wir kommen darauf zurück.
Lange waren die Bäder der (englischen) Aristokratie vorbehalten und damit tatsächlich so »exklusiv«, wie es in Zeiten des Massentourismus in der unnachahmlichen Paradoxie der Werbesprache heißt. Doch dann folgten die nouveaux riches nach, und damit war, in den Augen der Aristokraten, Snobismus und Vulgarität die Tür geöffnet. Um 1850 befand sich die britische Oberklasse in freiem Rückzug aus den heimischen Bädern und überließ die englische Küste der Mittelklasse und, später, von der Eisenbahn herbeigekarrt, den tuberkulösen Industriearbeitern aus den ungelüfteten Proletarierquartieren Manchesters oder Londons. So gewann die Meeresluft gesamtgesellschaftlich sanatorischen Wert. Den hatte sie auch für João VI.
»Das Bad tat ihm gut«, vermerkt der Berichterstatter knapp, und noch knapper: »Das Salzwasserbad machte Mode.« Der erleichterte Monarch ließ am Ort ein Badehaus errichten, das noch heute steht und das Museum der Stadtreinigung beherbergt.
Das Baden beginnt
Dass das königliche Bad schnell Nachahmer fand, ist leicht vorstellbar. Denn dank Telegraph und den immer dichter aufeinanderfolgenden Reisenden aus Europa kam die Kunde von der so erfolgreichen Thalassotherapie über den Atlantik. Und es war leicht zu erkennen, dass in Rio ideale Bedingungen für das Meerbad bestanden.
Hinzu kommt eine grundsätzlich andere Einstellung zum Bad. Kulturhistorisch neutralisierten sich in einem Durchschnittsbrasilianer gewissermaßen die indianische Badeleidenschaft auf der einen, das Erbe der wasserscheuen europäischen Vorfahren sowie das aus dem Mittelalter herübergerettete katholische Misstrauen gegenüber (gemeinsamen) Vollbädern auf der anderen Seite. Ganz praktisch wird unter der Tropenhitze die Abkühlung und Reinigung zum dringlichen Bedürfnis. Der junge deutsche Fremdenlegionär Schlichthorst will bereits in den 1820ern wissen, dass »jedes Frauenzimmer in der Regel vor dem Schlafengehen ein warmes Bad nimmt und in den Sommermonaten häufig vor Sonnenaufgang in der See badet«. Er findet selbst großen Gefallen am Seebad, denn er leidet an der ortsüblichen Hitze und Fauna. Ein Ausflug hat ihn zur Festung an der Praia Vermelha am Urca-Hügel geführt, von dem heute die Seilbahn zum Zuckerhut abfährt. Der Ort lag zu Schlichthorsts Zeiten zwei Wegstunden außerhalb der Stadt. Von der Festung schlängelt sich ein steiler Pfad den Telegraphen-Hügel hinauf. Schlichthorst befindet sich an der Nordspitze Copacabanas, auf dem Leme-Hügel.
Im Süden überblickt der Betrachter die Bucht von Copacabana und kann das Auge auf das weite Meer hinausschweifen lassen, wenn es nicht am Leuchtturm der kleinen, der Bucht vorgelagerten Insel hängen bleibt. Schlichthorst zieht es nach unten, denn »das Meer lockt mit süßen Schmeicheltönen zu sich herab … Blühende Myrthenwälder bekränzen das schneeweiße Gestade. Schnell sind die Kleider abgeworfen, der balsamische Hauch der See weht der brennenden Haut eine wohlthätige Kühlung entgegen.«
Sofern Schlichthorst hier um 1825 berichtet und nicht fabuliert hat, war er sicher einer der ersten Europäer, die in Copacabana – genauer: in Leme – den Sprung ins Meer wagten. Für Schlichthorst allerdings weniger Wagnis als Wohltat und Anlass für eine Theorie über die Textillosigkeit der Indios:
»Diese belebende Frische, womit das Wasser den Körper durchdringt, dieser sanfte Gegenreiz, der die verbrannte Haut erneuert und gegen den Stich von Millionen Insecten undurchdringlich macht – man muß beides erfahren haben: die Genüsse und die Beschwerden der tropischen Natur, um begreifen zu können, wie wohlthätig ein Bad unter diesem Himmelsstriche wirkt. Wie wäre es sonst auch möglich gewesen, daß dieser Theil der Erde von Menschen bewohnt wurde, die nackend gingen, wie die Natur sie schuf, hier, wo Alles zur Plage der Menschen lebt … Aber das Meer, die Flüsse, jeder Bach schützen gegen diese rastlosen Verfolgungen und so sehen wir die Urvölker, welche unter den Wendezirkeln wohnen, mehr im Wasser lebend als auf der Erde, und Kleider gänzlich verschmähend, weil sie wohl wissen, daß diese keine Sicherheit gewähren.«

Strandgäste in Copacabana (1918)
Medizinische Erfordernis und freiwillig-lustvolles Erleben begegnen sich in der Folgezeit jeden Morgen am Strand, und der Zwang hebt sich im Vergnügen auf. 1838 werben Schulen für höhere Töchter in Glória und Botafogo mit der »frischen und reinen Luft« und dem therapeutischen Meeresbad für die Mädchen. »Herrliche Bademöglichkeiten bot Botafogo«, erinnert sich der britische Diplomat William Gore Ouseley an seinen Rio-Aufenthalt in den 1830er Jahren:
»Auch bei schlechtestem Wetter keine zu hohen Wellen, der Strand sanft abfallend, das Wasser seicht. Bestens geeignet vor allem für die Damen. Daher reihte sich im Sommer Badezelt an Badezelt, für die Familien, die sich in diesen sicheren und vor allem fischreichen und für die Kleinschiffahrt geeigneten Wassern tummelten, da sie vor Strömungen geschützt waren.«
König João und seine Familie haben später, ohne Käfig, in den ruhigeren Wassern von Botafogo gebadet. Sein Sohn Pedro zog Flamengo vor und nahm die Gastfreundschaft des englischen Botschafters in Anspruch, um sich in dessen Villa umzuziehen. Kidder und sein Mitreisender James Cooley Fletcher beschreiben zwei Jahrzehnte später den nahegelegenen Strand von Flamengo als »beliebteste Badeanstalt« Rios. Sie legen ihren Fokus auf die Organisation des Bades, die im europäischen Seebad im Vordergrund steht. Den Badestrand als Sehnsuchtsort hätten sie fast übersehen, wenn nicht Kinder und Sklaven sie mit Geschrei darauf gestoßen hätten. Das nach ärztlicher Vorschrift durchgeplante Bad kennt weiterhin Regeln, aber kaum noch Scheu. »Bevor die Sonne über die Bergrücken lugt, strömen Männer, Frauen und Kinder zum Strand, um ein Bad im klaren Salzwasser zu genießen.« Sklaven schlagen Zelte in den Sand, in denen die Damen ihre Badekleidung aus schwarzem Tuch anlegen. »Die Damen sind gut bekleidet«, urteilen die Pfarrer, »jedoch ohne die Koketterie, die wir aus französischen Bädern kennen, wo die Damen sich der passenden Garderobe ebenso hingebungsvoll widmen wie der für den Ballsaal. Für die Herren gelten polizeiliche Bekleidungsvorschriften, doch einige hindert dies nicht, sich im Badeanzug in die Wellen zu werfen.« Kinder rennen durch die Brandung und kreischen vor Vergnügen, wenn eine Welle sie auf den Sand wirft. Zuweilen ruft ein Spaßvogel »Da! Ein Hai!« und lacht über die Frauen, die auf den Strand zurückhasten.
»Um sieben Uhr steht die Sonne schon hoch am Himmel, und das ganze weiße Getümmel ist fort. Doch hier und da sieht man einen lockigen Kopf zwischen den Wellen auftauchen, dessen wollige Bedeckung der Angst vor einem Sonnenstich trotzt. Die Negerinnen, die ihre Herrinnen begleiten, baden zur selben Zeit wie diese. In mondhellen Nächten ist die See schwarzgefleckt: Das sind die Köpfe der Sklaven aus der Nachbarschaft. Sie plantschen und kreischen und vergnügen sich nach Herzenslust. Sie alle können bemerkenswert gut schwimmen, und es erfreut, ihre juchzenden Stimmen zu vernehmen, so fröhlich, als kennten sie weder Sorge noch Leid.«
Kidders und Fletchers Beschreibung ist die vielleicht erste, die in Richtung der heutigen offiziellen brasilianischen Selbstwahrnehmung geht: der Strand als Ort der offenbar verwirklichten sozialen wie rassischen Demokratie. Der Strand ist sogar den Sklaven zugänglich, wenn auch vor allem nachts und vielleicht nicht völlig legal. Doch die schwarzen Dienerinnen dürfen offenbar morgens kurz ins Wasser, zeitgleich mit ihren Herrinnen. Die räumliche Segregation des Strandes ist strikt: Es gibt Abschnitte für die Dienerschaft, so wie es einen für die Lasttiere gibt. Unklar bleibt, ob der Gesellschaftsabschnitt nach Geschlechtern getrennt war, doch ist dies wahrscheinlich. »Gut gekleidet« waren die Damen, wenn das Badekostüm aus dunkelblauem Serge oder Wollflanell mit weißem Band (oder, gewagter, einem roten Saum) die Beine mindestens bis über das Knie, die Schultern und den Hals bedeckte und sie so vor Sonne, Wind und Skandalen schützte. Schuhe aus Segeltuch waren im Wasser üblich wie Hauben oder Hüte.
Und noch eines können wir schließen: Für einige, ja für viele war das Bad im Meer vermutlich schon lange ein Vergnügen. Zwar begegneten auch im brasilianischen Volk viele dem Meer mit Zurückhaltung oder Abscheu. Volkskundler wie Luís da Câmara Cascudo haben zusammengetragen, dass Fischer im Meer eine Persönlichkeit sahen, und zwar eine wankelmütige, außerdem sei das Meer »nicht getauft und daher heidnisch«. Andere wiederum betrachteten das Meer als Heiligtum, das nicht durch badende Frauen verunreinigt werden dürfe. Vor solchem Strand fange man keine Fische mehr. Im Umgangsbrasilianisch ist der Strand negativ konnotiert; »am Strand gestorben« ist ein wenig aussichtsreiches Geschäftsvorhaben, und wer sich verziehen soll, geht »am Strand singen«.
Dennoch dürfen wir vermuten, dass Sklaven und Arme zwar allen möglichen Zwängen unterworfen waren, aber nicht jenen gesellschaftlichen, die das Meeresbad lange zur reglementierten Veranstaltung unter ärztlichem Blick verengten. Einige können schwimmen, weil sie es schon als Kinder gelernt haben, und sie erfreuen sich an der Besonderheit des Meeres, der Bewegung der Wellen und den Kräften der Brandung. Für sie war der Strand schon geboren, als sein Embryo im Abendland noch im Schlick der mythischen Angst schlummerte. Für Küstenbewohner warmer Breiten dürften Meer und Strand immer schon alles gleichzeitig gewesen sein: Arbeitsplatz, an dem tödliche Unfälle nicht selten waren, und Quelle der Freude. Immerhin sind Strände, auch die schönen, in Brasilien immer (mehr oder weniger) öffentlich zugänglich gewesen. Vielleicht waren sie nicht im Wasser, aber ein paar Stunden am Strand konnten für die Armen schon des 18. und 19. Jahrhunderts zu den wenigen erreichbaren, da kostenlosen Vergnügungen gehören – wenn sie denn den Strand als Ort des Vergnügens erkannten.
Dass sich für bürgerliche Brasilianer der Kontakt mit den Wellen zur Lust ausbildete, erschwerten – aber verhinderten keineswegs – der Überfluss beziehungsweise der Mangel zweier anderer Natureinflüsse: Sonne und Süßwasser. Die Frauen pflegten die Blässe, sich zu schminken widersprach dem damaligen Ehrbegriff einer Dame. Da die Sonne der Blässe entgegenwirkte, begegneten sie den Wellen im Ganzkörperschutz. Und ein Meeresbad verlangt eigentlich nach einer Dusche, da sonst das angetrocknete Salz auf der Haut, zumal mit frischem Schweiß vermischt, zu Juck- und anderen Hautreizungen führt. In der Stadt Rio de Janeiro fehlte es aber im Verlauf seiner Geschichte fast immer an Süßwasser. Seine Flüsse waren schnell verseucht und verödet, der Transport von Wasser aus den Bergen mühsam und prekär. Noch bis ins 20. Jahrhundert gehörten zum Straßenbild fahrbare Wassertanks, die ihr Gut nach Litern verkauften.
Rio kennt also um die Jahrhundertmitte bereits mehrere eingerichtete Badeorte. Eine Amtsmitteilung von 1850 empfahl der Bevölkerung dringend wiederholte Meeresbäder zum Schutz vor Epidemien. Einige Jahre lang ankerte im Hafenbecken nahe des von Ausländern bevorzugten Hotel Pharoux eine schwimmende Badeanstalt; in zwei Reihen standen darauf je 16 Individualkabinen, getrennt nach Damen und Herren. »Alle Kabinen haben eine eigene Tür, die rechteckigen Badewannen sind zwei Meter auf 1,20 Meter groß und sehr sauber«, schrieb der Diplomat José Maria da Silva Paranhos 1851 an einen Freund im Ausland.
»Jede Kabine bietet alles, was man zum An- und Entkleiden sowie zum Verschnaufen braucht: Strohstuhl, Fußmatte und Bügel. Das Wasser läuft beständig durch die Gitter an den Längsseiten; Licht und Luft kommen ausreichend hinein durch das Fenster, das auf das Meer hinaus geht. Jede Kabinenreihe verfügt über eine Toilette, die der Damen zusätzlich über ein Kosmetikkabinett.«
Man konnte natürlich auch einfach Badekleidung anlegen und von der Plattform ins Meer springen, auf der sich »Bankreihen befinden, die 300 Personen bequem Platz bieten, auf daß sie die gute Luft atmen, den Blick auf den Hafen genießen und die angenehmen Klänge eines Klaviers vernehmen können«. Solche Einrichtungen wie die Individualkabinen dienten allerdings weniger dazu, die Bequemlichkeit, als vielmehr die guten Sitten zu befördern. »Das Badeschiff steht Personen aller sozialen Schichten offen, solange sie die Regeln von Moral und Anstand beachten«, informierte das Hotel Pharoux seine Gäste.
Und deshalb ist es »Herren verboten, eine Kabine mit einer Dame zu betreten, solange ihre eheliche Verbindung nicht nachgewiesen ist. Das Betreten der Kabine einer Dame ist den Herren generell verboten, ebenso ein längerer Aufenthalt ohne besonderen Grund im Bereich der Kabinen für Damen.«
Damen ohne Herrenbegleitung durften eine Dienerin mitführen, dieser war das Baden aber nicht gestattet. Kidder und Fletcher zufolge bedurfte es allerdings wahren Muts, diese Badeanstalt zu nutzen, zumindest vor der Verbesserung des Abwassersystems der Stadt. Nach und nach entstanden entlang der Strände vom Stadtzentrum bis Botafogo Hotels, die auf Badegäste setzten; Antonio Francioni war 1828 wohl der Erste, der für sein neues Hotel mit dem belebenden Effekt des Meerwassers warb, und wo konnte sein Etablissement anders gelegen sein als am Strand von Caju, den der königliche Kranke für solche Unternehmungen geadelt hatte. Einige Jahrzehnte später hat das Meerbad eine andere Referenz. »Ihr Meeresbad in Luxus und nach heutigem Kenntnisstand ist der Hauptzweck dieses wichtigen Hotels; unser System entspricht dabei dem der Seehotels in den USA, England, Frankreich und der Schweiz«, wirbt das Große Seehotel von Botafogo 1883. Die Parameter der großen Seebäder Europas – medizinische Wissenschaft und Regelhaftigkeit einerseits, soziale Exklusivität, Luxus und Komfort andererseits – sind bindend geworden für das organisierte Salzwasserbad in den Tropen. In dieser Zeit wirbt auch schon ein kleines Hotel in Copacabana mit medizinischen Meeresbädern.
Viele kleinere Strände des 19. Jahrhunderts liegen heute unter Hafenbeton, Geschäftsvierteln oder dem Asphalt der Avenida Beira-Mar, wie der Strand von São Cristóvão oder der Strand von Santa Luzia. Die gleichnamige Kirche stand damals direkt am Strand, vom Portal führte eine Treppe bis ans Wasser, und ausweislich eines Photos sprangen junge Kühne noch 1917 von hohen Holzgerüsten hinein. Santa Luzia war ein Strand für die einfachen Leute und nicht zuletzt deswegen so populär, weil dort, gegen ein paar Groschen, Holzkabinen zur Verfügung standen: anderthalb auf zwei Meter, eine Bank, ein Spiegelchen, aneinandergebaut in langen Reihen. Santa Luzia und Boqueirão – der etwas weiter westlich verlief, wo sich heute der Passeio Público befindet – hatten eingangs des 20. Jahrhunderts zusammen sieben solcher Badehäuser. Sie gehörten Franzosen und Italienern. Madame Dordeau, die 1870 mit 50 Kabinen in Santa Luzia anfing, hatte 1904 mit 400 Kabinen die größte casa de banho. »Die schmalen Korridore so dunkel, daß es Gaslaternen brauchte; überall hing nasse Badekleidung, und es roch beständig und gesund nach Algen, nach Meer«, so der Chronist und Flaneur Paulo Barreto alias João do Rio 1911.

Vor dem großen Ansturm: Copacabana und der Zuckerhut (um 1910), in der Bildmitte der erst in den 1950ern gänzlich abgetragene Inhangá-Felsen
»Es gab einen Moment, da nahm ganz Rio ein Bad im Meer«, beschreibt Barreto die Entwicklung zum Ende des Kaiserreichs. Und zwar vor allem am Boqueirão, einem Strand, der geographisch wie sozial mitten im Leben liegt. Einige Jahrzehnte lang führte dieser Strand die Cariocas zusammen, zu einer gemeinsamen, wenn auch subtil differenzierten und segmentierten Veranstaltung:
»Am Boqueirão, in jenem Winkel der Bucht, machten sich nun die gesellschaftlichen Schichten sichtbar. Die Ärmsten badeten noch im Dunkel, vor vier Uhr, gratis, denn sie zogen sich direkt im Sand um. Ab fünf wurde es voll: bleiche Damen im Mantel, den Korb mit der Kleidung in der Hand, ganze Familien vom Stöpsel bis zur kleinen schwarzen Amme, Herren, die noch nicht im Bette waren, Damen zweifelhafter Lebensführung, die Rheumatiker, die Ausgezehrten. Mit Sonnenaufgang trafen im Gefolge der Invasion der Handelsangestellten die Wohlhabenderen ein: Beamte, Familien mit großem Namen, Titelträger. Einige kamen aus Botafogo mit dem Wagen … Von acht bis neun Uhr die Apotheose, im Meer wie in den Kabinen und im Café. In den Umkleidebereichen herrschte ein geschäftiges Kommen und Gehen, noch Nasse liefen an schon Bekleideten vorbei, Grüße und Gelächter flogen hin und her, Hände wurden geschüttelt, die Herzlichkeit menschlicher Gruppenbildung, die durchaus zu dauerhafter Bindung, zu Liebe und zu emotionaler Verwirrung führen kann. Im Meer konnte man die Gruppen der verschiedenen Umkleidehäuser erkennen; die Gruppen begegneten sich nicht, außer am Sonntag.«
Dieses getrennte Miteinander mitten in der Stadt war ausgangs des Jahrhunderts schon wieder Geschichte. Die Damen der Gesellschaft und die Titelträger mieden den Boqueirão; sie waren an die standesgemäßeren Strände von Flamengo und Copacabana weitergezogen. Übrig blieben die Armen, die etwas zu Lauten und die jungen Ruderer mit ihren starken Muskeln, die sie den Mädchen vorführten, auch den leichten.
So näherte sich die Elite im Verlauf des 19. Jahrhunderts langsam dem Strand an, während das Volk schon längst vergnügt plantschte. Noch vor der großen urbanen Aufräumaktion eines Francisco Pereira Passos, dessen Reformen die Stadt buchstäblich umkrempelten, entwickelte sich der Strand Rio de Janeiros zu einem Praxisraum städtischer Hygiene, die medizinisch wie sozialpsychologisch aufgefasst wurde und daher das »Genau-Fünf-Minuten-Bad« vor Tagesanbruch auf nüchternen Magen, wie es der Arzt verschrieb, ebenso meinte wie das Sichtreibenlassen auf morgensonnenglitzernder Welle. Bürgermeister Pereira Passos erließ 1906 die erste städtische Verordnung für die Bäder der Stadt. Danach musste jedes einen großen und gut belüfteten Raum vorweisen können, für die Ertrunkenen oder fast Ertrunkenen. Ebenso mussten sie über eine gut ausgestattete Apotheke verfügen, einschließlich Mundöffner und Mundsperren, Pinzetten, Spritzen, Verbänden und Klinikhandschuhen. Die Baderegeln des Doktor Debay von 1907 empfahlen dringend, nicht mehr als ein Bad täglich zu nehmen, nach einer Mahlzeit drei bis vier Stunden zu warten, beim Bad ganz einzutauchen, sich dabei zu bewegen und beim ersten Frieren das Wasser zu verlassen. Einen Skandal verursachte die französische Starschauspielerin Sarah Bernhardt 1886 nicht nur, weil sie sich bei ihrem ersten Rio-Aufenthalt zum Meerbad an den entlegenen, wilden und nur beschwerlich zu erreichenden Strand von Copacabana begab. Wie der Tourismushistoriker Marcelo Machado berichtet, verweilte sie außerdem noch Stunden im Badeanzug und schaute einfach hinaus bis zum Horizont. Und sie ging nach sieben Uhr morgens ins Wasser – schlichtweg undenkbar in jener Zeit.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.