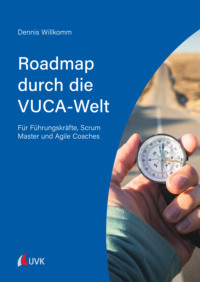Kitabı oku: «Roadmap durch die VUCA-Welt», sayfa 4
Fakt ist jedenfalls, dass man nicht viel Fantasie benötigt, um vorherzusagen, dass sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren grundlegend verändern wird. Schon allein die sukzessive Ablösung einer Generation durch die nachfolgende, die ganz andere Wertesysteme hochhält, spricht dafür. Betrachten Sie dies nun in der sich ständig veränderten VUCA-Welt, so wird klar, wie unvorhersehbar und spannend die kommenden Jahre sein werden.
➤ Tipps für VUCA-Helden
Die Digitalisierung kommt mit einem großen Paradigmenwechsel daher. Die Werte und Prinzipien, mit denen zu Zeiten der Industrialisierung auf Arbeit und Gesellschaft geschaut wurden, passen nicht zu den Gegebenheiten, die die VUCA-Welt mit sich bringt. Die Wissensarbeit unterliegt gänzlich anderen Gesetzmäßigkeiten.
1 Verändern Sie Ihre Sicht auf Effizienz und Effektivität.
Das Zeitalter der Industrialisierung war geprägt von dem Diktat der Effizienz. Jegliche Optimierung diente dazu, effizienter und somit schneller und kostengünstiger zu sein.
Bei komplexen Aufgaben ist dieser Fokus auf Effizienz aber hinderlich. Hier bedarf es neuartiger, emergenter Praktiken und Lösungen. Diese benötigen Kreativität und Innovation, die nicht erzwungen werden können. Hier geht es darum, günstige Rahmen zu schaffen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass entsprechende Lösungen schnell entstehen. Dies kann aus dem Paradigma der Industrialisierung als ineffizient und verschwenderisch wirken, ist aber aus dem Paradigma der Digitalisierung effektiv und zielführend.
Aus welchem Paradigma betrachten Sie Ihre Umwelt?
Was ist Ihnen wichtiger? Effizienz oder Effektivität?
Welche Auswirkungen haben lokale Optimierungen der Effizienz auf das Gesamtsystem?
1 Hinterfragen Sie das vorherrschende Führungsverständnis.
Die Industrialisierung zeichnet sich durch starre Strukturen und hohe Arbeitsteilung aus. Dies war den damaligen Verhältnissen entsprechend förderlich und sinnvoll. Die Voraussetzungen haben sich aber verändert.
Die beschäftigten Mitarbeiter sind heute in der Regel sehr gut ausgebildet und sich ihren Stärken bewusst. Die Aufgaben sind komplexer geworden. Die Annahme, dass derjenige, der in der Hierarchie weiter oben steht, auch mehr Wissen oder Fähigkeiten besitzt als diejenigen darunter, ist nicht mehr gültig.
Begegnen Sie Ihren Kollegen auf Augenhöhe? Auch wenn Sie Führungskraft sind?
Worauf gründen Sie Ihren Führungsanspruch?
Verstehen Sie Führung als Statussymbol und Privileg oder als Dienstleistung?
1 Machen Sie sich die Unterschiede der verschiedenen Generationen bewusst.
Wahrscheinlich arbeiten Sie mit vielen Angehörigen unterschiedlicher Generationen zusammen. Von der statistischen Wahrscheinlichkeit her sind die meisten Führungspositionen von Mitgliedern der Babyboomer und der Generation X besetzt. Deren Wertesystem wird daher auch einen Einfluss auf das Führungsverständnis und die Entscheidungen haben.
Die nachfolgenden Generationen sind mit anderen Voraussetzungen und Wertesystemen ins Berufsleben gestartet. Dies kann unter Umständen zu Konflikten führen, wenn konträre Ansichten aufeinanderprallen.
Gleichzeitig ist dies aber auch eine große Chance, da Teams, die sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Generationen zusammensetzen, eine viele größere Diversität aufweisen können und somit voneinander profitieren können.
Dem Wertesystem welcher Generation würden Sie sich selbst zuordnen?
Wo entstehen Probleme, die auf die unterschiedlichen Generationen zurückzuführen sind?
Welche Vorteile können Sie sehen, wenn Sie Mitarbeiter unterschiedlicher Generationen zusammenbringen?
Bewältigungsstrategien für eine VUCA-Welt
Viele Menschen sind auf der Suche nach einem Patentrezept, wie man in dieser VUCA-Welt erfolgreich sein kann. Wir befinden uns aber in einer komplexen Umwelt, da gibt es keine Best Practices. Was es jedoch gibt, sind übergeordnete Prinzipien und Werte, die hilfreich sein können, wenn Sie sich an ihnen orientieren.
Ein Quartett aus Prinzipien, die dabei helfen können geht auf Bob Johansen zurück und nennt sich VUCA Prime (Johansen 2007). Auch hier stellt VUCA ein Akronym dar (Vision, Understanding, Clarity, Agility). Es stellt ein Rahmenwerk dar, das ein Führungsverhalten repräsentiert, das als Antwort auf die vier Bestandteile der VUCA-Welt zu sehen ist.
Vision
Langfristige Pläne erweisen sich in der schnelllebigen, volatilen Umwelt oftmals als problematisch. Unvorhergesehene Veränderungen und veränderte Voraussetzungen sind für viele Unternehmen keine Seltenheit. Aber wie können Sie strategisch in die Zukunft planen, wenn Pläne zum Scheitern verurteilt sind? Eine Antwort auf Volatilität ist das Finden und Verfolgen einer VisionVision. Durch das Fokussieren auf ein Ziel bleiben Sie auf Kurs, selbst wenn die Welt um Sie herum sehr unruhig ist. Dabei ist die Vision nicht gleichzusetzen mit dem Ziel selbst, das ja der Volatilität ausgesetzt ist. Eine Vision ist vielmehr ein Nordstern, den Sie wie die Seefahrer nutzen können, um in eine bestimmte Richtung zu navigieren und ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wo aber liegen nun die Unterschiede zwischen konkreten langfristigen Zielen, die der Volatilität unterworfen sind und einer Vision? In Abbildung 8 sehen Sie die Pyramide, an deren Spitze die Vision steht, die als starker Motivator und Richtungsgeber dient. Lassen Sie uns einmal genauer die unterschiedlichen Ebenen der Pyramide betrachten.
Eine Vision beschreibt einen optimalen und idealen Zustand in der Zukunft. Dabei wird eine Vision in der Regel so formuliert, als sei dieses Ziel schon erreicht. Bekannte Visionen sind zum Beispiel die ursprüngliche Vision von Microsoft („Ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause“) oder von Wikipedia („Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat“). Auch die ambitionierte Vision von Oxfam passt hier gut („Eine gerechte Welt ohne Armut“).
 Abb. 8:
Abb. 8:
Von der Vision zu Zielen
Simon SinekSinek, Simon untersuchte, was motivierende Visionen ausmacht und entwarf das Bild des goldenen Kreises1goldener Kreis (Sinek 2014). Im Zentrum dieses Kreises steht, dass die Vision immer das „Warum“ erklären sollte. Eine starke Vision sollte sinngebend sein und erklären, warum und wozu man ihr folgen sollte. Der zweite Kreis stellt dann das „Wie“ dar. Hier geht es um Werte und Prinzipien, wie diese Vision verfolgt wird. Erst der äußere Kreis beschreibt das „Was“, also wie die Vision sich in Produkten, Dienstleistungen oder Handlungen ausbildet. Schwachen Visionen fehlt oftmals der Kern. Sie beschreiben nur den äußeren Kreis, das „Was“. Damit besitzen sie nicht die Strahlkraft und das Motivationspotenzial von Visionen, die nach den Prinzipien des goldenen Kreises formuliert wurden.
 Abb. 9:
Abb. 9:
Der goldene Kreis nach Sinek
In Unternehmen dient die Vision in der Regel dazu, eine gewünschte Position im Markt oder eine Wahrnehmung bei der Zielgruppe zu beschreiben. Die Mitarbeiter des Unternehmens können dann ihre konkreten Handlungen und nächste Schritte an dieser Vision prüfen und somit anhand dieser ausrichten.
In vielen Unternehmen gibt es neben der Vision auch eine explizit ausformulierte Mission. In dieserMission wird beschrieben, wie man die Vision umsetzen möchte. Häufig wird die Vision in Form der Mission nach draußen kommuniziert und in markigen Slogans verpackt. Unternehmen beschreiben hier beispielsweise, was sie tun, also Tätigkeiten, die zur Erfüllung der Vision ausgeführt werden. Die Mission von Google lautet beispielsweise „Googles Mission ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und sie universell verfügbar und nutzbar zu machen“. Es können aber auch einfache Aussagen sein, wie die Vision von TED: „Spread ideas“, also Ideen verbreiten. Schaut man sich die „Mission Statements“ der Unternehmen einmal genauer an, wird man feststellen, dass diese Unterscheidung zwischen Vision und Mission gar nicht so leicht ist und beides gerne vermischt wird.
Die WerteWerte, die eine Gruppe als wichtig erachtet, werden oftmals gar nicht explizit verschriftlicht. Selbst wenn Werte irgendwo schriftlich hinterlegt werden, was viele Unternehmen gerne auf großen Postern in Besprechungsräumen tun, zeigen sich Werte nicht in gedruckten Lettern, sondern im Verhalten der Menschen. Daher gibt es viele Firmen, die diese Werte in ihren Mission- oder Vision-Statements verankern und auch sehr stark darauf achten, dass alle Mitarbeiter sich diesen Werten entsprechend verhalten.
Konkreter wird es, wenn eine StrategieStrategie entwickelt wird. Eine Strategie konkretisiert bestimmte Aspekte der Vision und der Mission und blickt nicht mehr in eine ferne Zukunft, sondern nur noch mittelfristig voraus. Dazu werden der Kontext und vorherrschende Rahmenbedingungen, sowie handelnde Personen (Stakeholder, zum Beispiel Kunden, Aktionäre) in die Überlegungen mit einbezogen. Dies erfolgt so konkret, dass es den Handelnden Personen möglich ist, ihre Tätigkeiten in diese Strategie einzupassen.
Die kleinste Einheit stellt dann konkrete ZieleZiele dar. Diese beschreiben kleine Schritte bei der Erfüllung der Strategie. Ziele sind viel kurzfristiger zu betrachten und sollten in Summe dazu führen, dass die Strategie eingehalten wird.
Wie Sie an diesem Aufbau erkennen können, sind die konkreten Ziele am anfälligsten für die Volatilität. Wenn ein Ziel nicht erreicht werden kann, dann ist immer noch nicht die gesamte Strategie in Gefahr, wenn man sie gut durchdacht hat. Aber auch hier sollte sich niemand in trügerischer Sicherheit wiegen. Denn wenn zu viele Ziele plötzlich nicht zu erreichen sind, dann wird sich auch die Strategie als nicht umsetzbar erweisen. Hat man sich aber bewusst Gedanken gemacht über seine Vision und Mission, dann wird man auch davon nicht umgeworfen. Denn man hat immer noch die Vision, an der man sich orientieren kann und die, wie der Nordstern für den Seefahrer, den Weg weist und bei der Entwicklung einer neuen Strategie hilft.
Passen Sie Ihre Pläne und Ziele an, wenn Sie neue Erkenntnisse haben. Werfen Sie den Plan komplett weg, wenn Sie merken, dass Sie auf dem Holzweg sind. Begehen Sie nicht den Fehler zu glauben, dass Ihr Plan Ihnen wirklich Sicherheit gibt. „Pläne sind nichts, Planung ist alles“, wusste schon Dwight D. Eisenhower.
Understanding (Verstehen)
Je mehr Verständnis in unsicheren Situationen aufgebaut wird, desto geringer wird die Unsicherheit. Dies gilt sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, wo der Faktor Vertrauen eine große Rolle spielt.
In vielen klassischen Unternehmen gilt es als Versagen, wenn Ziele nicht erreicht werden. Wenn das Umfeld plötzlich mit Komplexität konfrontiert ist, wo Experimente gefordert sind, dann steigt die Unsicherheit noch mehr, wenn ein fehlgeschlagenes Experiment als Scheitern und nicht als Lerngelegenheit bewertet wird.
Wie schwer sich damit noch viele klassische Unternehmen tun, zeigt die Popularität von Veranstaltungen, die dazu ermutigen sollen, vom Scheitern zu berichten und die Erfahrungen mit anderen zu teilen. Dadurch sollen Menschen ermutigt werden, Dinge anzugehen, deren Ausgang ungewiss ist. Stellt sich der gewünschte Erfolg nicht ein, so sollte dies nicht als Fehler, sondern als Erfahrung bewertet werden. Eine Bühne dafür wird zum Beispiel durch die immer populärer werdenden Fuck-up-NightsFuck-Up-Night2 weltweit geboten. Dabei berichten Menschen über ihre persönlichen „Fuck-ups“, also Projekte oder schwierige Situationen in ihrem Leben, die anders verliefen, als erhofft oder erwünscht. Somit wird das Erlebte nicht als etwas Negatives präsentiert, sondern als Reifeschritt auf dem Weg zu neuer Stärke und die interessierten Zuhörer können daraus lernen.
Hierbei sollten Sie allerdings im Hinterkopf behalten, dass Sie in der Lage sein müssen, die Aufgaben und Probleme richtig einzuschätzen. Fehlerkultur im komplexen Umfeld bedeutet, schnell Fehler zu machen, um daraus zu lernen, während Fehlerkultur im komplizierten Umfeld die absolute Vermeidung von Fehlern bedeutet. Dies stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen, die in der Vergangenheit mit komplizierten Aufgaben zu tun hatten und nun zunehmend mehr komplexe Herausforderungen bewältigen müssen.
Clarity (Klarheit)
Um KlarheitKlarheit zu erlangen, sollten für alle Beteiligten einige Dinge beantwortet sein. Besonders wichtig ist die Klarheit darüber, worauf man sich fokussieren möchte und welche Ziele man verfolgt. Dann kann man sehr genau unterscheiden, ob das, was man gerade tut, eine sinnvolle Aktion ist, die hilft, das große Ziel zu erreichen, oder ob es eine Aktion ist, die sich in Nebenkriegsschauplätzen verfängt.
Klarheit hat auch wiederum sehr viel mit Kultur zu tun. Gibt es ein geteiltes Ziel oder verfolgen verschiedene Parteien unterschiedliche Ziele? Auch die Art und Weise der Kommunikation ist ein wichtiger Faktor, denn eine klare und offene Kommunikation schafft die geforderte Klarheit. Nachrichten, die missverstanden werden können oder falsch interpretiert werden, führen zum genauen Gegenteil. Daher lohnt es sich, Kommunikation so zu gestalten, dass sie zielführend ist und Klarheit schafft. Schwammige Aussagen und Ausflüchte, wie sie in Politik und Unternehmenskommunikation leider oft Realität sind, sollten daher vermieden werden. Dies hat viel mit einer entsprechenden Führung zu tun, worauf wir später noch im Detail schauen werden.
Agility (Agilität)
Um der vorherrschenden Ambiguität zu begegnen, ist AgilitätAgilität gefordert. Agilität kann helfen, Unsicherheit und Mehrdeutigkeit durch schnelle und kurze Feedbackzyklen zu begegnen. Das Thema Agilität ist in den letzten Jahren immer mehr zum Synonym für die (digitale) Transformation vieler Unternehmen geworden. Im nächsten Kapitel werden wir das Thema Agilität genauer unter die Lupe nehmen.
➤ Tipps für VUCA-Helden
Wir leben in einer VUCA-Welt, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen bietet. Auf ein Rezept, wie Sie auf jeden Fall erfolgreich sein werden, brauchen Sie nicht zu hoffen, das gibt es einfach nicht. Aber Sie können erfolgsversprechenden Prinzipien und Werte folgen, die helfen, den Herausforderungen zu begegnen und die Chancen zu erkennen und zu nutzen, wenn sich Gelegenheiten ergeben.
1 Entwickeln Sie Visionen.
„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ gab Altkanzler Helmut Schmidt einst zu bedenken. Was damals schon eher fragwürdig erschien, lässt sich heute daran angelehnt vielleicht als „Wer keine Visionen hat, kann nach Hause gehen“ formulieren. Visionen helfen Ihnen auf Kurs zu bleiben und Klarheit in Ihre Ziele zu bringen. Sie beschreiben, warum, wie und was Sie tun. Eine gute Vision fördert die Motivation und gibt dem Handeln Sinn.
Daher sollten Sie versuchen, die Vision zu verstehen, die Ihr Unternehmen verfolgt. Können Sie keine Vision erkennen, dann ist es eine gute Idee, danach zu fragen und eine Diskussion über eine gemeinsame Vision zu starten. Ein Unternehmen ohne eine starke, gemeinsame Vision verschenkt sehr viel Potenzial. Zudem kann es sehr aufschlussreich sein, sich zu fragen, welcher Vision Sie selbst folgen. Können Sie Ihre persönliche „Mission“ formulieren?
Kennen Sie die Vision, die Ihrem beruflichen Umfeld Sinn gibt?
Ist die Vision allen Beteiligten bekannt und wird geteilt?
Gibt die Vision Antworten auf die Fragen „Warum?“, „Wie?“ und „Was?“?
Kennen Sie Ihre eigene, persönliche Vision?
1 Verstehen Sie, was um Sie herum geschieht.
Versuchen Sie ein Gefühl dafür zu entwickeln, was um Sie herum geschieht. Wie fühlen sich die Menschen? Welche Sorgen und Nöte treiben sie um?
Hören Sie mit echtem Interesse zu? Schenken Sie Ihrem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit?
Bilden Sie Hypothesen über Ihre Umwelt und überlegen Sie sich, wie Sie möglichst schnell herausfinden können, ob diese Hypothesen korrekt sind.
Gehen Sie mit Experimenten so um, dass ein Fehlschlag als Lerngelegenheit gesehen wird?
1 Schaffen Sie Klarheit.
Komplexität können Sie nicht beseitigen oder reduzieren. Aber Sie können dafür sorgen, dass es nicht noch komplexer wird. Ganz wichtig dabei ist eine saubere und klare Kommunikation. Durch Missverständnisse und verschleierte Aussagen werden die Empfänger Ihrer Nachrichten sich sehr vorsichtig oder sogar kontraproduktiv verhalten. Wenn Sie aber offen und transparent, ehrlich, direkt und klar kommunizieren, dann stehen die Chancen gut, dass Ihnen vertraut wird.
Kommunizieren Sie direkt und offen? Sind Sie sicher, dass Ihre Zuhörer Ihre Botschaft richtig verstanden haben?
Wenn Sie Informationen nicht weitergeben dürfen, was können Sie darüber mitteilen, wann und wer diese Informationen weitergeben wird? Können Sie vielleicht schon etwas über die nächsten Schritte sagen?
Grundlagen von Agilität
Wenn wir uns mit der Digitalisierung und den Veränderungen beschäftigen, die damit für Arbeitsweisen, Unternehmen und auch jeden einzelnen einhergehen, dann spielt das Thema Agilität eine zentrale Rolle. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Überblick über die Grundlagen geben. Schauen wir uns dafür zunächst einmal die historischen Wurzeln an.
Lean Management
Im Zusammenhang mit Agilität wird sehr häufig auch der Begriff „Lean“ verwendet. Teilweise werden diese Begriffe sogar synonym verwendet, was allerdings nicht korrekt ist. Lean stammt aus der Produktion und hat einen sehr starken Fokus darauf, Verschwendung zu reduzieren. Dabei wird oft das Toyota-Produktionssystem, das untrennbar mit dem Namen seines Erfinders Taiichi ŌnoŌno, Taiichi verbunden ist, als Vorbild herangezogen (Ōno 2013). Toyota war es gelungen, ein System einzuführen, dass es dem Unternehmen erlaubte, ganz neue Qualitätsmaßstäbe zu setzen. Viele Unternehmen aus dem Westen unternahmen Reisen zu Toyota, um sich Dinge von diesem Vorzeigemodell abzuschauen.
Heutzutage gibt es in sehr vielen Unternehmen, besonders in der Produktion, Lean Initiativen, die auf den gleichen oder sehr ähnlichen Prinzipien beruhen. Die Gestaltungsprinzipien dieser Produktionssysteme sind dem nachempfunden, was Toyota zum Vorbild gemacht hat. Dabei steht die Vermeidung von Verschwendung an vorderster Stelle. Hier wird versucht, alles, was nicht direkt oder indirekt zur Wertschöpfung beiträgt, zu vermeiden. Ōno nennt diese Arten von Verschwendung MudaMuda. Zusammen mit MuriMuri (Überbeanspruchung) und MuraMura (Unausgeglichenheit) bildet Muda (Verschwendung) das sogenannte 3M des Toyota-Produktionssystems.
| Verschwendung | Beschreibung | Beispiel |
| Muda | Verschwendung | Transport Bestände (Inventory) Bewegung (Motion) Warten Überproduktion (Overproduction) falsche Technologie (Overengineering) Nacharbeit (Defects)1 |
| Muri | Überbeanspruchung | unrealistische Fristen falsche Markteinschätzung (Nachfrage) schlechter Ausbildungsgrad |
| Mura | Unausgeglichenheit | Folge aus Muda und Muri Ermüdungserscheinungen im Team |
Tab. 3:
Das 3M des Toyota-Produktionssystems
Ein weiteres Gestaltungsprinzip ist die Standardisierung. Durch Standardisierung versucht man, möglichst alle unnötigen Arbeitsschritte aus dem Prozess zu entfernen. Dadurch soll zum einen die Effizienz erhöht werden, zum anderen aber natürlich auch die Qualität. Standardisiert wird alles, was wiederholt durchgeführt wird und festen Abläufen und Fertigungsschritten zugeordnet werden kann.
Das Null-Fehler-Prinzip ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Dieses hat zur Folge, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, die komplette Produktion anzuhalten, wenn er einen Fehler entdeckt. Dann ist jeder Beteiligte angehalten, an der Behebung des Fehlers mitzuwirken. Vorher wird nicht weiter produziert. Was auf den ersten Blick wie Verschwendung erscheinen mag, weil andere Produktionsschritte vielleicht gar nicht betroffen sind von dem aufgetretenen Fehler, ist eine Grundlage für die hohe Qualität, die so erreicht wurde.
Natürlich sollten Fehler, die das gesamte System lahmlegen, die absolute Ausnahme darstellen. Denn der möglichst geschmeidige Fluss der Arbeit durch das System ist ein weiteres Gestaltprinzip von Ganzheitlichen Produktionssystemen. Dieser Fluss wird immer wieder auf möglichst geringe Durchlaufzeiten hin optimiert und angepasst.
Ein grundlegender Bestandteil ist auch das Pull-Prinzip. Dieses sieht vor, dass Arbeit jeweils vom nächsten Prozessschritt gezogen wird und nicht vom vorherigen in den nächsten Schritt gedrückt wird. Somit fließt die Arbeit im Optimalfall, durch einen Kundenauftrag gezogen, durch das Fertigungssystem.
Ein sehr anschauliches und greifbares Beispiel für diese Art der Produktion können Sie in dem Roman „Das Ziel“ von Eliyahu Goldratt (Goldratt/Cox 2013) nachlesen. Hier wird die Geschichte eines Fabrikleiters erzählt, dessen Fabrik kurz vor dem Aus steht, weil der Konzern schlechte Zahlen schreibt. Durch einen glücklichen Zufall trifft der Fabrikleiter seinen ehemaligen Physikprofessor wieder, der ihn dadurch beeindruckt, dass er nicht nur ziemlich schnell durchschaut hat, wie schlecht es um die Fabrik eigentlich steht, sondern dem Fabrikleiter auch ein paar Denkanstöße mit auf den Weg gibt. Im Laufe der Geschichte arbeitet der Fabrikleiter immer enger mit dem Professor zusammen und lernt so die Grundzüge der Theory of Constraints kennen, die Sie später noch genauer ansehen werden (siehe Seite 57). So lernt er zum Beispiel, warum Überproduktion ein Problem darstellt und in welchen unterschiedlichen Erscheinungsformen sich Muda zeigt.2
Lean spielt seine Stärken in der Produktion aus. Hier sind sehr viele Dinge geradlinig und vorhersehbar. Zu den Zeiten, als das Toyota Produktionssystem erfunden wurde, befand man sich noch in der Taylorwanne. Und in vielen Produktionsbereichen, die standardisierte Produkte herstellen, besteht diese Taylorwanne auch noch heute. Da, wo wenig Variabilität gefordert ist, hat man es mit komplizierten Systemen zu tun, und dort funktioniert eine Lean Produktion sehr gut. Müsste man hingegen täglich sehr flexibel auf seinen Kunden neu eingehen, weil er etwas komplett anderes fordert, dann müsste man auch täglich seine Produktionsstraße anpassen. Zwar gibt es gewisse Kundenwünsche, die auch in der Produktion viele Produkte zu Unikaten machen, aber diese sind vorhersehbar und durch Techniken wie Just-in-Time (JIT) Produktion behandelbar.