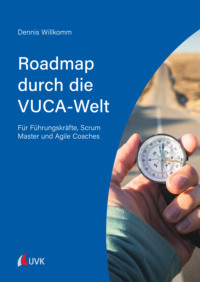Kitabı oku: «Roadmap durch die VUCA-Welt», sayfa 8
Design Thinking
Design ThinkingDesign Thinking ist, auch wenn es erst in den letzten Jahren zu seiner großen Bekanntheit gelangt ist, kein ganz junger Ansatz mehr. Schon seit 1991 finden Tagungen zu dem Thema statt. Zu den Vordenkern und Verbreitern von Design Thinking gehören David Kelley, Terry Winograd und Larry Leifer von der Stanford Universität. Kelley ist auch Gründer des Unternehmens IDEO, das für den Design Thinking Ansatz steht.
Im Design Thinking spielen interdisziplinäre Teams und die direkte Nähe zum Kunden und seinen Bedürfnissen eine tragende Rolle. In Abbildung 17 sind die einzelnen Schritte im Design Thinking Prozess schematisch dargestellt.
 Abb. 17:
Abb. 17:
Design-Thinking-Schritte
Die ersten beiden Schritte, Understand (Verstehen) und Observe (Beobachten) werden gerne auch durch ihre enge Verbundenheit als ein Schritt zusammengefasst (Empathie). Gestartet wird mit einem interdisziplinären Team, in dem viele unterschiedliche Perspektiven zusammentreffen. Je diverser, desto besser. Im ersten Schritt müssen alle Teammitglieder Wissen zum Umfeld aufbauen. Der Kontext wird geklärt und Fragen beantwortet. Das Team erlangt ein einheitliches Verständnis und klärt Begrifflichkeiten.
Der zweite Schritt besteht darin, die Zielgruppe möglichst genau kennenzulernen. Dies geschieht durch direkten Kontakt. Das Team kann die Zielgruppe bei der täglichen Arbeit beobachten und so die Probleme selbst wahrnehmen. Oder es kann die Zielgruppe (oder Vertreter dieser Gruppe) befragen und in den direkten Austausch treten. Vielleicht ergeben sich sogar Möglichkeiten, selbst am Alltag der Zielgruppe teilzunehmen und somit ein noch tieferes Verständnis für die Bedürfnisse aufzubauen. Dabei sollten dem Team möglichst wenig organisatorische Grenzen gesetzt sein. Je freier es sich bewegen kann, desto besser.
Im dritten Schritt, der Synthese, werden nun die Beobachtungen, Annahmen und Hypothesen, die die einzelnen Teammitglieder gewonnen haben, mit den anderen geteilt und zusammengeführt. Ziel ist es, ein Gesamtbild zu erstellen, welches von allen geteilt wird. Diese Aktivitäten werden unterstützt durch Praktiken und Methoden, wie zum Beispiel Storytelling, Visualisierung und ganzheitliches Zuhören. Nach und nach entwickelt sich so ein großes, gemeinsames Bild. In diesem versucht das Team nun, Muster zu erkennen. Auch eventuelle Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Ansichten sind hier willkommen, denn sie dienen dazu, das gemeinsame Bild zu hinterfragen. Am Ende sollte dann aber ein Bild entstanden sein, das alle Widersprüche integriert hat und das alle Teammitglieder als gemeinsame Ausgangsbasis teilen.
Nun wird es richtig spannend, denn als nächsten Schritt beginnen die Teammitglieder, Ideen zu generieren. Dabei greifen sie auf eine große Auswahl wirksamer Kreativitätstechniken zurück. In der Welt der Beratung und des Trainings finden sich mittlerweile unzählige gute Angebote, in denen neben den Grundlagen des Design Thinking auch viele Methoden und Techniken vermittelt werden, die man in der Praxis anwenden kann. Aber der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und alles, was gute Ideen produziert, gehört in diese Phase.
Die so entstandenen Ideen werden dann strukturiert und mit dem gesamten Team diskutiert. Oftmals fasst man hier noch einmal ähnliche Ideen zusammen oder nimmt Erweiterungen vor, um Aspekte anderer Ideen zu integrieren. Dann werden aus den Ideen diejenigen ausgewählt, die bezüglich Attraktivität, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit am vielversprechendsten erscheinen. Eine Grundannahme des Design Thinking besteht nämlich darin, dass Innovation in der Schnittmenge der drei Domänen Technologie, Wirtschaft und Menschen entsteht. Diese sind repräsentiert durch die Eigenschaften Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Attraktivität. Die drei Faktoren müssen in einem gesunden Gleichgewicht sein, damit sich eine Innovation auch wirklich etablieren kann. Daher sollte das Team bei der Ideenauswahl auf die Ausgewogenheit der drei Faktoren achten.
Im nächsten Schritt spiegelt sich das Prinzip der kurzen und schnellen Feedbackzyklen wider. Das Team entwirft einen ersten Prototyp, aus dem es Erkenntnisse gewinnen kann. Dabei werden Hypothesen formuliert, die schnell getestet werden können. Auch hier sollten der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt sein. Prototypen haben dabei nicht den Anspruch schon ein fertiges Produkt zu sein. Eine App kann zum Beispiel einfach simuliert werden oder es werden Hypothesen durch Rollenspiele getestet. Wichtig ist, dass das Feedback von der Zielgruppe erfolgt, für die die Lösung gedacht ist.
Man erzählt, dass ein großer Versandhändler für Schuhe als ersten Prototypen eine Webseite geschaltet habe, über die Bestellungen abgegeben werden konnten. Ziel war es, zu überprüfen, ob es Akzeptanz finden würde, Schuhe online zu bestellen. Denn es wäre ja durchaus möglich, dass die Kunden es bevorzugten, vor Ort den Schuh auch anprobieren zu können. Daher wurde noch kein großer Aufwand betrieben, sondern mit minimalistischen Mitteln erst einmal ein Prototyp erstellt und Feedback gesammelt. Die Bestellungen wurden dann im Schuhladen um die Ecke eingekauft und per Post an die Onlinekunden versendet. Nachdem die Hypothese, dass Menschen die Möglichkeit einer Onlinebestellung attraktiv fanden und nutzen würden, zumindest nicht widerlegt wurde, ging man dann den nächsten Schritt und legte auch eigene Lager an. Hätte sich herausgestellt, dass keine Akzeptanz für diese Art des Schuhkaufs bestand, dann wären die Verluste sehr klein und gering gewesen, da noch keine Lagerkosten entstanden und Bestände aufgebaut wurden.
An diesem Beispiel erkennen Sie auch den nächsten Schritt in der Kette: das Team muss seinen Prototyp ordentlich testen, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Sie sollten keine Scheu davor haben, einen Prototyp zu verwerfen, wenn Sie feststellen, dass die ursprüngliche Hypothese nicht zuzutreffen scheint. Hier haben Sie dann immerhin eine wichtige Erkenntnis gewonnen und können sich auf die Entwicklung einer neuen Idee fokussieren.
Der Innovationsprozess muss an dieser Stelle aber noch lange nicht abgeschlossen sein. Auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauend, kann das Team nun wieder starten und den Prozess von vorne durchlaufen. Design Thinking lässt sich somit auch gut mit Scrum oder anderen (agilen) Vorgehensmodellen kombinieren.
Design Thinking steht an dieser Stelle stellvertretend für eine Reihe von Kreativtechniken, die Unternehmen verwenden, um Kreativität und Innovation zu fördern. Sehr bekannt sind zum Beispiel auch die Google Designsprints1, die einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgen wie Design Thinking. Dabei werden die verschiedenen Phasen innerhalb eines Sprints von einer Woche durchgeführt. Am Ende der Woche sollte ein Learning stehen, das weitere Schritte ermöglicht. An anderer Stelle finden Hackathons statt, bei denen Menschen die Möglichkeit haben, an innovativen Themen zusammenzuarbeiten, die nicht zum Tagesgeschäft gehören.
Disruptionen
Eine DisruptionDisruption ist eine Veränderung, die sich so verheerend auswirkt, dass sie alles bisher als gegeben Angesehene wie aus heiterem Himmel angreift und ablöst. Diese können so überraschend und unerwartet auftreten, dass sie alles, was bisher als gesetzt angesehen wurde, mit einem Mal auf den Kopf stellen. Ganz so, wie die Entdeckung des ersten schwarzen Schwans, wie Nassim Nicholas Taleb es beschrieben hat (Taleb 2015).
Wir alle haben solche Disruptionen schon erlebt. In meiner Jugend ging ich, wenn ich die neuste Musik unterwegs hören wollte, zuerst in einen Supermarkt und kaufte mir eine Audiokassette. Dann setzte ich mich ans Radio und wartete, bis mein Lieblingslied gespielt wurde. Hier musste ich sehr auf Zack sein, um den Anfang mitzubekommen und rechtzeitig die Aufnahmetaste am Kassettenrecorder zu betätigen. Dann hieß es Daumendrücken, dass der Moderator nicht mitten in den Song hineinredete oder ein Falschfahrer sich auf die Autobahn verirrt hatte, so dass der Verkehrsfunk sich meldete. Wenn alles gut lief, hatte ich am Ende des Tages eine schön bespielte Kassette, die ich in meinen Walkman stecken konnte. Wenn ich mir ansehe, wie die junge Generation heute diese Herausforderung angeht, dann entdecke ich da kaum noch Gemeinsamkeiten. Die meisten Jugendlichen kennen so etwas wie Musikkassetten gar nicht mehr. Und Radio ist auch nicht unbedingt das Medium, das sie begeistert. Heute sind Streamingdienste auf jedem Smartphone zu finden. Und die Abos kosten kaum mehr als die Musikkassetten früher. Was für ein Luxus.
Veränderungen vollziehen sich oft schleichend. Wenn die etablierten Unternehmen es bemerken, ist es oft schon zu spät. Von Musikkassetten ging man über zu CDs, die mehr Komfort boten und auch mobil mit einem Discman abgespielt werden konnten. Dann folgten die wilden Jahre des Musikdownloads und die goldenen Zeiten des MP3-Tausches. Die Musik wurde erst auf tragbaren MP3-Playern mitgenommen, dann wurden auch diese durch die Smartphones ersetzt. Irgendwann traten dann die Musik Streamingdienste ihren Siegeszug an. Und wem das nicht reicht, der kann gleich auf dem Smartphone noch das Musikvideo dazu streamen, was in meiner Jugend noch MTV übernahm. Auch wenn wir hier von einer Evolution sprechen können, die sich über mehrere Jahre hingezogen hat, so war doch der Schritt zu einer neuen Technologie eine Disruption, denn sie veränderte den Markt grundlegend.
Disruptionen sind dabei keine Neuheit in der Menschheitsgeschichte. Zu allen Zeiten haben sie stattgefunden. Ob es die Erfindung neuer Werkzeuge in der Steinzeit war, oder die Ablösung des Segelschiffs durch das Dampfschiff. Disruptionen haben zu allen Zeiten für gesellschaftliche Veränderungen gesorgt. Wie zum Beispiel einer großen Veränderung in der Landwirtschaft durch die Einführung starker Maschinen, die die Handarbeit auf ein Minimum reduzierten.
Allerdings bieten die technischen Entwicklungen der heutigen Zeit neue Möglichkeiten und beschleunigen diese Disruptionen enorm. Viele große Disruptionen der Vergangenheit waren nur großen Unternehmen oder sehr reichen Einzelpersonen möglich und der Wandel vollzog sich über einen längeren Zeitraum. Die Herstellung eines Dampfbootes, eines Automobils oder von Traktoren benötigte ein hohes Kapital. Durch die Digitalisierung haben sich hier die Grenzen verschoben. Start-ups können mit cleveren und smarten Ideen teilweise etablierte und finanziell um ein Vielfaches überlegene Konkurrenten angreifen und das Geschäftsmodell sogar ganz ablösen. Und das braucht auch je nach Geschäftsfeld nicht mehr Jahre, wie in meinem Beispiel mit der Musik, sondern kann auch über Nacht geschehen.
Dabei spielen Plattformen eine große Rolle. Unternehmen wie Facebook, Amazon, Airbnb und Uber sind hier sehr anschauliche Beispiele. Ein Taxiunternehmen muss eine Menge Geld in die Hand nehmen, um Taxis anzuschaffen und so seine Fahrdienste anbieten zu können. Uber stellt nur eine Plattform zur Verfügung, über die Fahrdienstleistungen angeboten und in Anspruch genommen werden können. Sie müssen nicht ein einziges Taxi besitzen, um Dienstleistungen anzubieten und damit Geld zu verdienen. Für die Taxifahrer ist hier aus dem Nichts eine ernstzunehmende Konkurrenz entstanden. Ähnliches kann man auch über AirBnB sagen, die die Hotels unter Druck setzen, ohne eine einzige Immobilie besitzen zu müssen. Selbst Amazon bietet seine Online-Plattform gegen Gebühr auch für andere Händler an und kann so von deren Verkäufen mitprofitieren. Das Schöne dabei ist, dass Plattformen gut skalieren, das heißt, je mehr Leute daran teilnehmen und auf der Plattform vertreten sind, desto besser ist es für alle Beteiligten.
Disruptionen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie einen Vorteil für die Kunden bringen und dadurch gegenüber dem klassischen Geschäftsmodell bevorzugt werden. Ein Blick in Wikipedia ist heute von überall aus möglich und die Informationen in dem Nachschlagewerk sind hochaktuell. Wer kauft da noch einen Brockhaus oder vergleichbare Lexika? Bei Netflix können Sie bequem vom heimischen Sofa aus den nächsten Blockbuster auf Ihren Fernseher holen, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen. Wer braucht da noch eine Videothek? Über Amazon können Sie sich die neusten Waren per Knopfdruck bestellen und in vielen Gegenden werden sie Ihnen noch am gleichen Tag zugestellt. Wofür sollte man sich da den Stress antun und in die Stadt fahren?
Viele Unternehmen scheinen dann, wenn tatsächlich ein Disruptor erscheint, sehr überrascht zu sein. Hat Kodak die Digitalfotografie nicht kommen sehen? Doch, und Kodak war sogar aktiv an der Entwicklung beteiligt. Aber am Ende haben sie sich nicht getraut, ihr eigenes Geschäftsmodell – welches die klassische Filmfotografie betraf – anzugreifen. Und die menschliche Eigenart, Dinge, die Angst machen, einfach zu ignorieren oder herunterzuspielen, tat ihr übriges. Und so kam der Tag, an dem es zu spät war.
Heute belächeln noch viele Supermärkte die ersten Amazon-fresh-Transporter, die ganz vereinzelt durch die Straßen rollen. Das Angebot ist noch relativ klein und die Verbreitung ist auch noch nicht gegeben. Es stellt keine Konkurrenz für die Frischetheken im heimischen Supermarkt dar. Aber man sollte den Worten des Autors und Omnisophen Gunter Dueck Glauben schenken, wenn er in seinen Vorträgen immer wieder darauf hinweist: „Die üben nur!“2 Hier werden erst einmal Kenntnisse gesammelt. Und wenn das Geschäftsmodell vom Establishment dann irgendwann als Konkurrenz wahrgenommen wird, weil es plötzlich ausgereift ist, flächendeckend angeboten und auch genutzt wird, dann ist es für die schlafende Konkurrenz zu spät. Denn den Wissensvorsprung können sie kaum noch aufholen. Vielleicht stellt sich das Geschäftsmodell aber auch als nicht praktikabel heraus. Selbst dann hat Amazon einen Vorteil, denn sie haben daraus gelernt und können dieses Wissen verwenden, um ein besseres, tragfähigeres Geschäftsmodell zu finden.
Um diesem Schicksal zu entgehen, beginnen einige Unternehmen aktiv ihr Geschäftsmodell zu hinterfragen und im Optimalfall sogar selbst anzugreifen (Keese 2018). Somit bleiben sie auf Augenhöhe mit möglichen Angreifern und im Falle des Erfolgs ist man selbst an der Speerspitze mit daran beteiligt und kann davon profitieren. In vielen Fällen bilden sich dann kleine Einheiten, die zwar in irgendeiner Form noch an die Mutterorganisation angeschlossen sind, im Grunde aber sehr autark und losgelöst agieren. Diese Inkubatoren werden nicht durch die Prozesse und Regeln belastet, die das Mutterunternehmen so träge gemacht haben, sondern finden ähnliche Verhältnisse vor, wie die Start-ups, die als kleine, wendige und innovative Angreifer gesehen werden.
Dieses Mindset, sich nie allzu sicher zu fühlen und sein eigenes Geschäftsmodell anzugreifen (oder sogar zu Kannibalisieren), ist eine grundlegende Fähigkeit, die jeder Unternehmer mitbringen sollte: „Das Crossover, das Zusammenführen von Gegensätzlichem, wird zu einer Schlüsselfähigkeit für das 21. Jahrhundert“ (Mutius 2017).
Dabei entstehen neue Innovationen und Geschäftsfelder oftmals genau aus dem, was wir am Anfang anhand des Beispiels der Pommes Frites in dem kleinen Restaurant gesehen haben: durch Vernetzung. So wie das Smartphone Kommunikation und Entertainment zusammengebracht hat. Und man sieht einmal mehr, wie wichtig es ist, Gegensätze vereinen zu können. Auf der einen Seite ist man einem großen Marktdruck und einer sehr starken Konkurrenzsituation ausgesetzt, auf der anderen Seite sind Zusammenarbeit und Integration enorm wichtig geworden.
Die Frage für die Zukunft wird sein, wie sich die neuen technologischen Entwicklungen auswirken werden. Zum einen kann es nicht falsch sein, in die Vergangenheit zu schauen und daraus Schlüsse zu ziehen. Die vergangenen technischen Revolutionen haben die Arbeit vieler Menschen erleichtert und generell eher dazu geführt, dass neue Jobs geschaffen wurden. Die Angst, Maschinen würden Arbeitsplätze stehlen und zu Massenarbeitslosigkeit führen, ist unbegründet gewesen. Dies heißt aber nicht, dass sich die Arbeitswelt nicht verändert. War es noch vor ein paar Jahren erstrebenswert und völlig normal, von der Lehre bis zur Rente im gleichen Beruf zu arbeiten, so sprechen Experten und Berufsverbände heute davon, dass Arbeitnehmer deutlich flexibler sein müssen. Das lebenslange Lernen bekommt eine immer stärkere Bedeutung. Was in der Lehre gelernt wird, ist nicht zwangsläufig auch der Beruf zum Renteneintritt. Darauf müssen die jungen Menschen vorbereitet werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Berufswahl.
Wie wahrscheinlich Ihr eigenes Berufsbild einer Automatisierung zum Opfer fällt, können Sie im Internet sehr einfach herausfinden.3 Hier sehen Sie, dass zum Beispiel der Beruf eines Steuerfachangestellten aus 12 verschiedenen Tätigkeiten besteht, die schon heute komplett von einem Roboter übernommen werden könnten. Die Automatisierbarkeit in diesem Beruf ist also enorm hoch und die Wahrscheinlichkeit, in absehbarer Zukunft etwas anderes suchen zu müssen, ist damit auch sehr groß. Zumindest, wenn die Automatisierung billiger oder qualitativ besser ist als die Arbeit eines Menschen. Trotzdem empfehlen viele Berufsberater jungen Menschen immer noch, in diese Berufe zu gehen. Schaut man sich die Entwicklung der Stellen als Steuerfachangestellte an, so sieht man, dass diese in den letzten Jahren gestiegen sind. Und ebenso ist das Gehalt nach oben gegangen. Nur weil ein Beruf also irgendwann vielleicht automatisiert werden könnte, muss es heute keine schlechte Berufswahl sein.
Allerdings gibt es auch Stimmen, die davon ausgehen, dass die neuen Technologien und künstliche Intelligenz eine ganz neue Dimension der Veränderung darstellen, die nicht mit den bisherigen Revolutionen vergleichbar ist. Schließlich wird hier nicht nur die Muskelkraft ersetzt, sondern auch viel Kopfarbeit. Also das, was der Mensch bisher den Maschinen voraushatte. Während es hier sehr optimistische Zukunftsbilder gibt, die den Menschen von der Notwendigkeit einer Erwerbstätigkeit befreit sehen (Precht 2018), gibt es auch die etwas pessimistischere Sicht, die den Menschen am Rande seiner Nützlichkeit für Evolution sieht (Harari 2018).
Was immer die Zukunft auch bringen mag, Disruptionen gehören zum Alltag und können zukünftig noch stärkere Umwälzungen hervorrufen als bisher. Mit den daraus entstehenden Unsicherheiten werden wir umgehen müssen und Strategien entwickeln. Das „disruptive Denken“ und das Gestalten der Zukunft ist ein guter Startpunkt. Denn überall da, wo Sie Raum zur Gestaltung vorfinden, da entstehen Chancen, die Sie nutzen können.
➤ Tipps für VUCA-Helden
Auch wenn Digitalisierung sich sehr technologiebezogen anhört, so ist vielleicht die zentrale Botschaft, den Kunden in das Zentrum allen Bemühens und aller Innovation zu stellen. Die Bedürfnisse des Kunden beherrschen den Markt.
Wenn Sie den Kunden aber nicht nur als Konsumenten, sondern als wichtigen Partner sehen, dann können Sie daraus sehr viele Vorteile ziehen. Mit kurzen Feedbackzyklen und kreativen, innovativen Herangehensweisen können Sie neue Geschäftsmodelle erschließen und selbst disruptiv ganze Märkte verändern.
1 Sehen Sie den Kunden als Partner und stellen Sie ihn in den Fokus.
Versuchen Sie Ihre Kunden oder Zielgruppen möglichst gut zu verstehen. Das klassische Anforderungsmanagement hatte seit jeher damit zu kämpfen, dass die Kunden oft selbst nicht genau wussten, was sie wollten. Bringen Sie Ihre kreativen Teams direkt in Kontakt mit der Welt des Kunden, so dass diese mit den Kunden gemeinsam erarbeiten können, was benötigt wird. Bringen Sie Teams und Kunden auch während des Erstellungsprozesses zusammen, so dass frühzeitig Feedback gegeben werden kann.
Welches Bedürfnis hat der Kunde wirklich?
Gibt es noch eine andere Perspektive?
Wie können Sie den Kunden möglichst nah an das kreative Team bringen?
1 Digitalisierung bedeutet Beziehungen und Verbindungen.
Oftmals benötigt man keine bahnbrechende neue Erfindung. Manchmal ist das, was zu einem echten Gamechanger wird, eine Kombination aus schon vorhandenen Dingen, Produkten oder Dienstleistungen.
Erinnern Sie sich an die Familie in dem Restaurant. Hier haben zwei Restaurants zusammengearbeitet und somit den Kundenwunsch bedient. Niemandem ist daraus ein Nachteil entstanden.
Wo sehen Sie mögliche Verbindungen, die vorteilhaft sein könnten?
Gibt es Konkurrenten oder Mitbewerber, die sich als Partner anbieten können?
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie erkennen, dass ein Kunde von einem Produkt (einer Dienstleistung) profitieren könnte, die er nur bei einem Wettbewerber bekommt?
1 Ermöglichen Sie Kreativität und Innovationsgeist.
Beschäftigen Sie sich mit Innovations- und Kreativitätsmethoden wie Design Thinking oder ähnlichen. Bringen Sie Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen und geben Sie ihnen Freiräume und Möglichkeiten, verrückte Ideen zu entwickeln und zu testen.
Schauen Sie sich ab, was die innovativen Vorreiter wie Google, Adobe oder andere Unternehmen zu diesem Zwecke ermöglichen.
Wie können Sie Innovation und Kreativität fördern?
Haben Sie genug Raum, Zeit und finanzielle Fördermittel für kreative Workshops?
Können Sie innovative Strukturen in Ihrem Umfeld aufbauen oder sollten Sie über einen Inkubator nachdenken?
Wie können Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell angreifen?