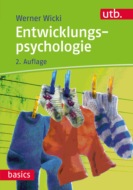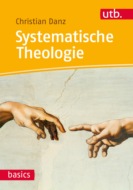Kitabı oku: «Politikwissenschaft», sayfa 2
| 1.3.2 | Forschungsheuristiken |
Akteurorientierte Ansätze
Zur Analyse politischer Zusammenhänge wird häufig auf methodologische Anleitungen zurückgegriffen (Methodologie = Lehre von den wissenschaftlichen Methoden). Es werden also Anleitungen herangezogen, die theoretisch fundierte Methoden zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung enthalten. Sie arbeiten meist mit bestimmten Variablen und Kategorisierungen, die die Forschung anleiten sollen. So wird beispielsweise vorgeschlagen, hauptsächlich vom Handeln der zentralen Akteure auszugehen. Akteure sind damit die handelnde Einheit. Dies können einzelne Individuen wie der Bundespräsident, der Bundeskanzler, ein Ministerpräsident, der Vorsitzende eines Verbandes, aber auch Institutionen sein wie beispielsweise der ADAC, der Bundesrat, die Finanzministerkonferenz oder die Europäische Kommission. Akteurorientierte Ansätze beziehen sich also auf das Handeln der Akteure. Dabei wird jedoch nicht das Handeln nur eines Akteurs betrachtet, sondern vor allem wie die verschiedenen Akteure miteinander umgehen und sich u.U. gegenseitig beeinflussen.
Die methodologischen Anleitungen, in denen die zentralen Variablen sowie die expliziten und impliziten Hypothesen über ihr Verhältnis zueinander enthalten sind, kann man auch als Forschungsheuristiken bezeichnen. Hiervon gibt es in der Politikwissenschaft eine ganze Reihe. An dieser Stelle werden zwei dieser Forschungsheuristiken näher betrachtet:
1 der Rational Choice-Ansatz, der bestimmte Annahmen über das Verhalten der Akteure macht und Vorkommnisse auf das Handeln von Akteuren zurückführt,
2 der akteurzentrierte Institutionalismus, der davon ausgeht, dass materielle Politik nicht nur von Akteuren, sondern auch von den Institutionen beeinflusst wird, die die Akteure umgeben.
Rational Choice-Ansatz
Mit dem Rational Choice-Ansatz werden Ereignisse im Wesentlichen auf das Handeln von Akteuren (= die jeweils Handelnden) oder Akteursgruppen zurückgeführt. In solchen Handlungstheorien werden Akteure als die zentralen Gestalter der Umwelt betrachtet. Sie handeln auf der Basis von vorher getroffenen Entscheidungen. Damit dies überhaupt möglich ist, wird davon ausgegangen, dass sie eine gewisse Wahlfreiheit besitzen. Zentrale Annahme des Rational Choice-Ansatzes ist jedoch, dass die Akteure rational handeln; mit anderen Worten, die Akteure haben klare Vorlieben und Ziele (Präferenzen) und verfügen über alle wichtigen Informationen, um diesen Vorlieben und Zielen entsprechend entscheiden zu können. Dies heißt dann auch, dass den Akteuren alle wichtigen Handlungsmöglichkeiten bekannt sind und sie auch abschätzen können, welche dieser Möglichkeiten ihnen den größten Nutzen bringt. Dass diese Annahme nicht besonders realistisch ist, wurde vielfach kritisiert. Allerdings machen ihre Verfechter geltend, dass sie so lange mit dieser Annahme arbeiten können, bis es einen Ansatz gibt, der die tatsächlich beobachtbaren Ergebnisse menschlichen Handelns besser erklären und prognostizieren kann. Wenn die Erklärungskraft groß sei, wäre es nicht schädlich, so zu tun, als ob die Annahme tatsächlich gegeben sei.
Das grundlegende Problem, das schon Hobbes umtrieb, nämlich die Annahme, dass die reine Verfolgung von Eigeninteressen ins Chaos führt, wenn nicht ein gegenseitiger Vertrag geschlossen wird greift für die Verfechter des Rational Choice-Ansatzes unter Hinweis auf Adam Smith und sein grundlegendes Werk »The Wealth of Nations« (1776) nicht. Smith und mit ihm die klassische und neoklassische Wirtschaftswissenschaft nehmen nämlich an, dass sich das größte Gemeinwohl einstellt, wenn die Akteure nur ihre Eigeninteressen verfolgen. Allerdings gilt dies nur unter gewissen Annahmen wie dem Schutz des Eigentums, der Freiheit des Handels usw., weswegen auf den Leviathan des Thomas Hobbes nicht ganz verzichtet werden kann (→ vgl. Kapitel 2.3.2).
Rational Choice-Ansätze gehen also von rationalen Erwartungen der Akteure aus und führen Entwicklungen wie beispielsweise den vielfach beklagten Bürokratisierungsprozess auf Entscheidungen dieser Akteure zurück. Will man entsprechende Prozesse erklären, müsste man – folgt man der »Forschungsanleitung« des Rational Choice-Ansatzes – die Vorlieben und Ziele sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der beteiligten Akteure analysieren.
Akteurzentrierter Institutionalismus
Einen anderen »Bauplan« für Forschungsanstrengungen gibt der akteurzentrierte Institutionalismus an die Hand. Er sagt, dass nicht nur die Akteure betrachtet werden sollen, sondern auch die Institutionen, die diese umgeben. Auch wird nicht davon ausgegangen, dass Akteure stets rational handeln; es wird auch nicht so getan, als ob sie dies täten. Vielmehr werden beispielsweise die Handlungsorientierungen (z. B. Wohlstand, Reputation oder Nächstenliebe) der Akteure betrachtet und es wird berücksichtigt, dass diese nur über begrenzte Kapazitäten der Informationsverarbeitung verfügen. Dabei interessieren insbesondere die aus Einzelakteuren zusammengesetzten Akteure (z. B. Verbände und Unternehmen), denn sie verfügen über verhältnismäßig großen Einfluss auf Politikprozesse und damit auch auf das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen.
Wie schon erwähnt, werden neben diesen Akteuren auch Institutionen in die Analyse einbezogen. Dabei wird ein weiter Institutionenbegriff zugrunde gelegt. Es werden nicht nur die Institutionen wie der Bundestag, der Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht mit den jeweils geltenden Verfahrensregeln (etwa: was schreibt das Grundgesetz über den Gesetzgebungsprozess vor?) betrachtet. Vielmehr interessieren auch die vielen formellen und informellen Regeln, die helfen, Verhalten zu erklären oder vorherzusagen. Dazu gehört das Demonstrationsrecht genauso wie beispielsweise der Umstand, dass im Bundestag im Rahmen der Aussprache über den Haushalt des Bundeskanzleramts immer auch eine Generaldebatte über die Politik der jeweiligen Bundesregierung stattfindet.
In welchem Verhältnis stehen Akteure und Institutionen im akteurzentrierten Institutionalismus zueinander? In einer eher kurzfristigen Betrachtung muss man davon ausgehen, dass Akteure innerhalb eines gegebenen institutionellen Kontextes handeln. Die Institutionen können das Handeln der Akteure fördern, aber auch hemmen und kanalisieren. Ist beispielsweise für die Verabschiedung eines Gesetzes die Zustimmung des Bundesrats erforderlich und besitzen die Parteien, die die Bundesregierung tragen, nicht die erforderliche Mehrheit im Bundesrat, ist die Bundesregierung in ihrer politischen Gestaltungsfähigkeit beschränkt. Auch wenn Institutionen als kurzfristig nicht veränderbar betrachtet werden müssen, können sie doch in einer mittel- und längerfristigen Perspektive auch selbst Gegenstand der politischen Auseinandersetzung mit dem Ziel einer Veränderung werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Bemühungen um die Reform des deutschen Föderalismus (→ vgl. Kapitel 3.5.3).
Leistungen von Forschungsheuristiken
Welche Leistungen erbringen Forschungsheuristiken wie der Rational Choice-Ansatz und der akteurzentrierte Institutionalismus für den Forschungsprozess? Sie leiten diesen an. Sie sagen, auf welche Faktoren insbesondere zu achten ist. Allerdings erschließt sich aus dem Hinweis, dass im Wesentlichen Akteure (Rational Choice-Ansatz) bzw. Akteure und Institutionen (akteurzentrierter Institutionalismus) wichtig sind, noch kein genauer Bauplan für die eigene Forschung. Konkrete systematisierende Anleitungen müssen erst aus der jeweiligen Fragestellung entwickelt werden. Möchte man beispielsweise wissen, wie verschiedene Formen des Föderalismus (→ vgl. Kapitel 3.5) auf die Reformfähigkeit eines Nationalstaats wirken, leitet sich daraus ab, welche institutionellen Vorgaben genauer zu betrachten sind. Dies können beispielsweise die Regeln sein, aus denen sich das Ausmaß der Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung des Bundes ergibt. Wichtig ist auch die Eigenständigkeit der Länder, die sich z. B. anhand der Gesetzgebungskompetenzen und dem Ausmaß ihrer Finanzhoheit ablesen lässt.
Neben den institutionellen Gegebenheiten wirken jedoch auch andere Faktoren auf die Reformfähigkeit eines Nationalstaats. Folgt man dem akteurzentrierten Institutionalismus, sind auch die wichtigen Akteure zu betrachten. Damit gelangen die Verbände ins Blickfeld und ihre Fähigkeit, den politischen Prozess zu beeinflussen (→ vgl. Kapitel 3.1). Wichtig für die Reformfähigkeit dürfte auch das Parteiensystem sein und die Chance, stabile Mehrheiten im Parlament zu organisieren (→ vgl. Kapitel 3.2). Von Interesse könnte zudem die Weltmarktoffenheit sein. Im jeweiligen Forschungsdesign (= Plan für eine systematische empirische Forschung) müssten diese verschiedenen, als relevant herausgearbeiteten Variablen berücksichtigt werden. Wie dieses Forschungsdesign im Einzelnen zu gestalten ist, wird in entsprechenden Methoden-Lehrveranstaltungen und Lehrbüchern vermittelt.
Zusammenfassung
Was leisten Forschungsheuristiken?
Eine Forschungsheuristik hilft, die jeweils relevanten Variablen zu ermitteln. Sie weist den Forschungsprozess in die »richtige« Richtung. Die tatsächlich erklärungskräftigen Variablen ergeben sich aus der Forschungsfrage. Sie können nicht ohne Vorkenntnisse, die aus der einschlägigen Literatur gewonnen werden müssen, benannt werden. Das konkrete Forschungsdesign schließlich legt fest, wie die Untersuchungsfälle auszuwählen sind.
Lernkontrollfragen
| 1 | Was unterscheidet die Politikwissenschaft von einem Alltagsverständnis von Politik? |
| 2 | Welche zentralen Aspekte geben die klassischen Politikbegriffe vor und was folgt aus diesen für die konkrete Forschung? |
| 3 | Welche Ausdifferenzierung hat der empirisch-analytische Politikbegriff gefunden? |
| 4 | Nennen Sie bitte Beispiele für eine Beschreibung, eine Erklärung und eine Prognose. |
| 5 | Erfüllt Ihrer Meinung nach die Unterscheidung von Polity, Policy und Politics die Kriterien für eine sinnvolle Kategorisierung? (Diskussionsfrage; gut geeignet für Arbeitsgruppen.) |
| 6 | Welche Funktion erfüllen Forschungsheuristiken? Verdeutlichen Sie dies anhand von Beispielen. |
Literatur
Alemann, Ulrich von/Forndran, Erhard (2005), Methodik der Politikwissenschaft, 7. Auflage, Stuttgart.
Eingeführtes Lehrbuch zur Methodik der Politikwissenschaft, in dem neben vielen praktischen Fragen (Arbeitstechniken, Aufstellung eines Forschungsplans, Arten der Erhebung von Daten usw.) auch die klassischen Politikbegriffe behandelt werden.
Behnke, Joachim/Baur, Nina/Behnke, Natalie (2010), Empirische Methoden der Politikwissenschaft, 2. Auflage, Paderborn u.a. Systematisch aufgebautes Methodenlehrbuch, das ausgeprägt mit politikwissenschaftlichen Beispielen arbeitet.
Böhret, Carl/Jann, Werner/Kronenwett, Eva (1988), Innenpolitik und politische Theorie, 3. Auflage, Opladen, insbesondere S. 1–12. Immer noch äußerst lohnendes Lehrbuch, in dem auf den hier interessierenden ersten Seiten die unterschiedlichen Politikbegriffe sehr schön verdeutlicht werden.
Braun, Dietmar (1999), Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft. Eine kritische Einführung, Opladen.
Lehrbuch, das in einen wichtigen Theoriebereich der Politikwissenschaft einführt. Es werden sowohl die Grundlagen der ökonomischen Theorie der Politik als auch Anwendungen in einzelnen Teilbereichen dargestellt.
Frantz, Christiane/Schubert, Klaus (Hrsg.) (2010), Einführung in die Politikwissenschaft, 2. Auflage, Münster.
Amerikanischen »Textbooks« nachempfundenes, großformatiges Lehrbuch, das in seinem Aufbau den drei Dimensionen des wissenschaftlichen Politikbegriffs folgt. Der Band ist mit seinen zahlreichen Karikaturen, Grafiken und Fotos sehr anschaulich.
Habermas, Jürgen (1968), Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/Main.
Habermas wendet sich in seinem Buch gegen die Vorstellung von einer »objektiven Erkenntnis«. Denn jedes Bemühen um Erkenntnis sei von theoretischen Grundannahmen und vom jeweiligen Interesse an einer spezifischen Erkenntnis vorgeprägt.
Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W. (1995), Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, in: Renate Mayntz/Fritz W. Scharpf (Hrsg.), Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/Main u. a., S. 39–72. Der zentrale Aufsatz, in dem der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus erstmalig von den seinerzeitigen Direktoren des Max- Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln entwickelt wird. In dem Sammelband, in dem der Aufsatz erschienen ist, finden sich weitere Beiträge, in denen der Ansatz bereits angewandt wurde.
| Theorien der Politik(wissenschaft) | 2 |
Inhalt
| 2.1 | Theorie und Politik |
| 2.2 | Die Politik des guten Lebens |
| 2.3 | Legitimation von Herrschaft: Vertragstheorie |
| 2.4 | Parlamentarische Repräsentation und Gewaltenteilung |
| 2.5 | Das System der Demokratie |
| 2.1 | Theorie und Politik |
| 2.1.1 | Theorie zwischen Problemlösung und kritischer Orientierung |
Erwartungen an Theorie
Die Antwort auf die Frage, was Theorie innerhalb der Politikwissenschaft leistet bzw. leisten soll, hängt immer auch davon ab, welcher Politikbegriff zugrunde gelegt wird. Bei allen Ähnlichkeiten und vielfältigen Überschneidungen lassen sich empirische und normative Konzeptionen von politischer Theorie unterscheiden. Empirisch-analytische Ansätze sehen Theorie als Mittel zur Erklärung politischer Phänomene. Normative Ansätze betonen die eigenständige moralische Dimension politischer Realität.
| 2.1.1.1 | Theorie: empirisch-analytisch |
Wenn Politik vor allem als der gesellschaftliche Teilbereich begriffen wird, in dem für die ganze Gesellschaft verbindliche Entscheidungen getroffen werden, dann soll Theorie bei der Erklärung dieses Phänomens helfen. Sie leistet einen Beitrag für die Formulierung praktischer Politik, darf sich aber gerade deshalb nicht zu weit von der politischen Realität entfernen und muss immer an ihr überprüfbar sein. Durch diese strenge Forderung nach der Überprüfbarkeit der Aussagen anhand der Realität sollen ideologische Verzerrungen verhindert werden. Ausgehend von solchen Überlegungen verlangt der Hauptvertreter des Kritischen Rationalismus, Karl Popper (1902 –1994), dass alle wissenschaftlichen Aussagen widerlegbar sein müssen (Falsifikation). Eigene Wertungen und weltanschauliche Vorurteile der Forscher sollen möglichst vollkommen ausgeschaltet werden (Wertfreiheit). Das diesem Konzept zugrunde liegende Bild von Politik und Politikwissenschaft ist das von trial and error. Angeleitet von wissenschaftlichem Wissen, das selbst allerdings immer der Überprüfung und Verbesserung bedarf, steuert Politik die gesellschaftliche Entwicklung und lernt aus ihren Fehlern. Ziel von Theorie ist es in diesem Kontext, der empirischen Forschung Orientierung zu geben. Normative Aussagen sind im strengen Sinn in diesem Ansatz nicht begründbar, können aber Gegenstand der Untersuchung sein.
Logik von Versuch und Irrtum
Zusammenfassung
Theorie: empirisch-analytisch
Politische Theorie wird im Kontext empirisch-analytischer Ansätze zu einer Tätigkeit, die:
● Forschungsaktivitäten auf eine pragmatische Konzeption hin orientiert;
● Aussagen über mögliche Ereignisse und Entwicklungen macht, die überprüft werden können;
● Wertorientierungen der Forscher aus der Forschung ausschließen will.
Was damit gemeint ist, lässt sich beispielhaft am Theorieverständnis des Kritischen Rationalismus zeigen. Karl Popper formuliert in »Die Logik der Sozialwissenschaften«:
»[…]
| a) | Die Methode der Sozialwissenschaften […] besteht darin, Lösungsversuche für ihre Probleme […] auszuprobieren. […] Wenn ein Lösungsversuch der […] Kritik nicht zugänglich ist, so wird er […] ausgeschaltet, […]. |
| b) | Wenn er einer sachlichen Kritik zugänglich ist, dann versuchen wir, ihn zu widerlegen; denn alle Kritik besteht in Widerlegungsversuchen. |
| c) | Wenn ein Lösungsversuch […] widerlegt wird, versuchen wir einen anderen. |
| d) | Wenn er der Kritik standhält, dann akzeptieren wir ihn vorläufig; […]. |
| e) | Die Methode der Wissenschaft ist also die des tentativen Lösungsversuches (oder Einfalls), der von der schärfsten Kritik kontrolliert wird. […] (»trial and error«). |
| f) | Die […] Objektivität der Wissenschaft besteht in der Objektivität der kritischen Methode; […].« (Popper (1969) 1993: 103–123, gekürzt). |
Nach Karl Popper macht Theorie einen kritisierbaren Erklärungs- bzw. Lösungsvorschlag. Wenn er nicht widerlegbar ist, wird er versuchsweise (= tentativ) und für eine bestimmte Zeit als handlungsleitend akzeptiert. Der Vorschlag kann auf der theoretischen Ebene widerlegt werden, wenn sich beispielsweise Widersprüche ergeben oder sich grundlegende Annahmen als unzutreffend erweisen. Er kann aber vor allem durch die Auswertung von praktischer Erfahrung widerlegt werden. Die Verfahren (Methoden), mit denen jeweils die Ergebnisse gewonnen werden, müssen in jedem Fall transparent und nachvollziehbar sein.
| 2.1.1.2 | Theorie: normativ |
Ordnung und Orientierung
Wenn Politik als ein gesellschaftlicher Teilbereich verstanden wird, in dem Menschen vor dem Hintergrund höherwertiger Prinzipien ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln, dann müssen diese Prinzipien und die von ihnen abgeleiteten Verfahren der Entscheidungsfindung in das Zentrum der Forschung rücken. Es geht dann um die Frage, ob und wie solche höherwertigen Prinzipien (z. B. die Menschenrechte) selbst noch mal begründet werden können und welche politischen Institutionen den bereits anerkannten Normen am ehesten entsprechen. Ziel normativer Theorie ist das Verständnis und die Begründung von Ordnungskonzeptionen. Diese Ordnungskonzeptionen lassen sich in der gesellschaftlichen Realität nie ganz verwirklichen, sie sind aber als Orientierungsrahmen für alle politischen Gemeinwesen notwendig. Der Ursprung dieser Ordnungskonzepte wird je nach der Ausrichtung der Theorie in unterschiedlichen Bereichen gesucht. So kann beispielsweise ein göttliches Gebot, die menschliche Vernunft in all ihren Spielarten oder der Sozialtrieb des Menschen als Ausgangspunkt der Begründung von Ordnung herangezogen werden.
Als Beispiel für eine normative Perspektive kann die neoklassische Theoriekonzeption von Eric Voegelin gelten. In »Die neue Wissenschaft der Politik« heißt es:
»Politische Gesellschaften müssen, um handlungsfähig zu sein, eine innere Struktur besitzen, […]. Dieser Prozess, in dem eine Vielzahl von Menschen sich zu einer handlungsfähigen Gesellschaft gestaltet, soll die Artikulierung einer Gesellschaft, […] genannt werden. Als Ergebnis der politischen Artikulierung gibt es dann Menschen, die wir Herrscher nennen, die für die Gesellschaft handeln […].
Zusammenfassung
Theorie: normativ
Politische Theorie wird im Kontext normativer Ansätze eine Tätigkeit, die:
● Forschungsaktivitäten auf eine moralisch-normative Konzeption hin orientiert;
● Begründung und Auslegung von Ordnungskonzeptionen untersucht;
● die Wertdimension der Politik und der Politikwissenschaft herausarbeitet und bejaht.
Gibt es wirklich so etwas wie Repräsentation der Wahrheit in der Gesellschaft? […] Dann würde zu unterscheiden sein zwischen der Repräsentation einer Gesellschaft durch ihre existenziellen Repräsentanten, und einer zweiten Relation, in welcher die Gesellschaft selbst etwas, das über sie hinausgeht, eine transzendente Wirklichkeit, repräsentiert.« (Voegelin (1959) 1991: 61 u. 83).
Nach Eric Voegelin geht normative Theorie davon aus, dass Gesellschaft durch Institutionen der Herrschaft (z. B. Krone, Parlament) und die jeweiligen Amtsinhaber (z. B. Herrscher, Parlamentarier) repräsentiert wird. Sie machen die Gesellschaft handlungsfähig und sind Stellvertreter des gesellschaftlichen Willens (= Repräsentation 1). Gleichzeitig gibt es aber eine grundlegende Ordnungskonzeption, die nie ganz in der verwirklichten Ordnung aufgeht (z. B. Menschenrechte, göttliche Ordnung) und als deren teilweise Realisierung sich Gesellschaft verstehen kann (= Repräsentation 2). Weil wir in der Politik immer auch Ordnungen verwirklichen, die über den Moment hinausweisen und uns als Menschen angehen, existiert in jeder konkreten politischen Realität ein normativer Horizont.
| 2.1.2 | Theorie – historisch oder systematisch? |
| 2.1.2.1 | Theorie als Ideengeschichte |
Was untersucht die Ideengeschichte
Zahlreiche Lehrbücher und Nachschlagewerke zur politischen Theorie sind historisch aufgebaut und bieten eine Geschichte des politischen Denkens, die dann als politische Ideengeschichte bezeichnet wird. Politische Ideengeschichte geht davon aus, dass eine Vielzahl kultureller und sozialer Bedingungen auf die verschiedenen Konzepte von Politik eingewirkt haben. Neben diesen meist außertheoretischen Faktoren richtet die Ideengeschichte ihr Augenmerk nicht nur auf den Kontext, in dem die jeweilige politische Ordnungsvorstellung entstanden ist, sondern sie achtet besonders darauf, wie und warum bestimmte Autoren sich auf ihre Vorgänger beziehen. Die Gründe für die Ablehnung vorheriger politischer Ordnungen werden untersucht und die jeweilige spezifische Eigenleistung des Autors in seiner Zeit herausgearbeitet.
Archäologie der Politik
Politische Ideengeschichte geht auch den Wirkungszusammenhängen einer Theoriekonzeption nach. Sie fragt nach deren Einfluss auf spätere Theorien und auf die praktische Ordnung von Politik (z. B. Verfassungen, politische Erklärungen und Weltanschauungen). Politische Ideengeschichte ist damit eine Art Archäologie des politischen Denkens. Sie rekonstruiert die früheren Schichten gegenwärtiger Ordnungskonzeptionen und gibt damit einen Einblick in die historische Dynamik ihrer Entstehung. So kann gezeigt werden, wie voraussetzungsvoll und schwierig die Entwicklung moderner Demokratien war, welche abgestorbene Zweige der Entwicklung es gibt, wo Rückschritte und Fehlentwicklungen verzeichnet werden müssen. Sie kann aber auch das Verständnis für die Genese außereuropäischer politischer Kulturen unter dem Blickwinkel ihrer besonderen Entwicklung wecken.
Wenn sie so verstanden wird, ist die Ideengeschichte keine Wissenschaft der toten Körper, sondern ein Beitrag zum Verständnis lebendiger Politik aus der Perspektive ihrer Entwicklung. Auf keinen Fall kann aber die Geschichte politischer Ideen eine Begründung geltender Ordnungen ersetzen.
| 2.1.2.2 | Systematische politische Theorie |
Systematik der Politik
An diesem Punkt wandelt sich politische Ideengeschichte, wenn sie Teil einer modernen Sozialwissenschaft bleiben will, in politische Theorie mit einem systematischen Erkenntnisinteresse. Systematische politische Theorie behandelt die historische Genese der Theorien als einen Materialbestand und trennt scharf zwischen der Entwicklung und der Geltung eines Ansatzes. Sie kann am historischen Material die wechselseitige Abhängigkeit von Ideen und gesellschaftlichen Konstellationen diskutieren. Außerdem bieten die vorliegenden Theoriebestände einen gewaltigen Vorrat an möglichen Konzepten und Argumenten, die zwar nicht ohne Vermittlungsleistung auf die Gegenwart angewendet werden können, die aber gleichwohl gewürdigt werden müssen, wenn nicht Traditionsverlust drohen soll.
Theorie als Problemlösung
Theorie in systematischer Absicht stellt allerdings nicht die Entwicklung eines Denkansatzes in den Mittelpunkt. Vielmehr geht es ihr um die Mobilisierung der Geschichte des politischen Denkens zu systematischen Zwecken. Die Ausgangsfrage ist dabei nicht, was der oder jener Theoretiker gedacht hat, sondern welchen Beitrag sein Werk zur Lösung eines bestimmten politischen Problems darstellt. Gefragt wird, wie Politik als Gegenstandsbereich überhaupt theoretisch modelliert werden kann und welche Aussagen sich normativ oder beschreibend über bestimmte Teilbereiche des Politischen machen lassen.
| 2.1.2.3 | Politisches Denken |
Politik und Kultur
Den weitesten Rahmen einer Beschäftigung mit den intellektuellen und kulturellen Formen der Auseinandersetzung mit dem Politischen setzt wohl der Begriff des politischen Denkens. Er zeigt an, dass die systematische wissenschaftliche Beschäftigung mit Politik nur eine der kulturellen Formen des Umgangs mit Politik darstellt. Die Reflexion des Politischen ist aber nicht allein ein Geschäft der »professionellen Wissenschaft«. Sie findet sich in zahlreichen anderen Kommunikationsformen, hinterlässt Spuren in der Literatur, Kunst oder in audio-visuellen Medien. Immer dient sie der Selbstverständigung der Gesellschaft Bezug auf die politische Ordnung, egal ob sie in Texten, kulturellen Praktiken oder im Spielfilm stattfindet. Auch wenn diese Formen der Selbstauslegung des Politischen nicht unbedingt den Anforderungen wissenschaftlicher Argumentation in Hinblick auf Methode und Widerspruchsfreiheit genügen, sind sie oft mächtige Beiträge zum politischen Diskurs.
Die griechische Tragödie und Komödie sind der ästhetische Ausdruck der attischen Demokratie, Shakespeares Dramen spiegeln die Politik des elisabethanischen Zeitalters und Fritz Langs »Metropolis« bearbeitet gesellschaftliche Probleme der entwickelten Moderne. Auch aktuelle Produkte der Unterhaltungskultur können Beiträge zum Verständnis der gesellschaftlichen und politischen Ordnung in einem fiktiven Diskurs sein. Erwartet man vom politischen Denken nicht primär die Tugenden der akademischen Wissenschaft, so eröffnet sich die politische Dimension zahlreicher kultureller Leistungen, die mächtige Ordnungsentwürfe darstellen.
Abb. 3 |
Die Beziehung von politischer Ideengeschichte, politischer Theorie und politischem Denken

| 2.1.3 | Ideologie und Selbstbeschreibung des Systems |
Reflexivität der Theorie
In jeder Theoriekonzeption wird die Frage, was Theorie sein und leisten soll, unterschiedlich beantwortet. Das heißt: Theorie diskutiert immer, was Theorie ist. Dieses Phänomen nennt man Reflexivität. Die grundsätzliche Reflexivität der Theoriebildung führt zu einer fast unüberschaubaren Vielzahl von Konzepten, von denen im folgenden Abschnitt zwei exemplarisch vorgestellt werden.
| 2.1.3.1 | Ideologielehre |
Das kollektive Unbewusste
Der Philosoph und Soziologe Karl Mannheim (1893 –1947) arbeitete in den 1920er-Jahren an einer wissenssoziologischen Ideologielehre. Dabei ging er davon aus, dass jede gesellschaftliche Gruppierung eine eigene Welterklärung benötigt, um sich ihren Ort in der Geschichte und ihre Lebensmöglichkeiten verständlich machen zu können. Es ist Kennzeichen der modernen Welt, dass nach dem Zeitalter der Aufklärung religiöse Welterklärungen ihre verbindliche Kraft verloren haben. Zunehmend treten von politischen Gruppen getragene Weltanschauungen, die der jeweiligen sozialen Lage der Menschen entsprechen, an ihre Stelle. Man teilt mit den Mitgliedern der gleichen sozialen Klasse bzw. Gruppierung nicht nur eine bestimmte Lebensform, sondern auch eine politische Weltinterpretation. Es ist das gesellschaftliche Sein, das – wie Marx das bereits formuliert hatte – das Bewusstsein bestimmt. Das Ergebnis dieses von der sozialen Lage und den Gruppenanschauungen beeinflussten Denkens nennt Karl Mannheim Ideologie und zählt als deren wichtigste Vertreter Konservativismus, Sozialismus, Liberalismus und Faschismus auf
Allen politischen Ideologien ist gemeinsam, dass sie einen Herrschaftsanspruch aus einer bestimmten Art der Welterklärung ableiten und denselben Anspruch anderer Ideologien wegen deren angeblich fehlerhafter Weltinterpretation ablehnen. Ein wirklich ideologisches Bewusstsein erhebt Anspruch auf die alleinige Herrschaft und verzerrt damit ganz grundsätzlich die politische Realität:
»Der Begriff der Ideologie reflektierte die dem politischen Konflikt verdankte Entdeckung, dass herrschende Gruppen in ihrem Denken so intensiv mit ihren Interessen an eine Situation gebunden sein können, dass sie schließlich die Fähigkeit verlieren, bestimmte Tatsachen zu sehen, die sie in ihrem Herrschaftsbewusstsein verstören könnten. In dem Wort Ideologie ist implizit die Einsicht enthalten, dass in bestimmten Situationen das kollektive Unbewusste gewisser Gruppen sowohl diesen selbst wie anderen die wirkliche Lage der Gesellschaft verdunkelt und damit stabilisierend wirkt.« (Mannheim (1929) 1952: 36).
Definition
Ideologie
Mit dem Begriff »Ideologie« bezeichnet man eine aufgrund der eigenen sozialen, ökonomischen oder politischen Interessen verzerrte Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität.
Politisches Denken als Ideologie schafft die Rechtfertigung für die Herrschaft einer bestimmten Gruppe und dient als Blaupause für die entsprechende politische Gestaltung der Realität. Auch in der Gegenwart, die gerne als nachideologisches und »postmaterialistisches« Zeitalter bezeichnet wird, spielen Ideen und Ideologien immer noch eine gewichtige Rolle. Auch wenn der Anspruch auf alleinige Wahrheit und das einzig angemessene Gesellschaftsbild in der entwickelten Demokratie nicht mehr opportun ist, so zeigt doch jede politische Programmatik immer auch bestimmte ideologische Schwerpunktsetzungen. Mit Karl Mannheim kann man die wichtigsten Ideologien entlang zentraler Begriffe der Politik von einander abgrenzen (s. a. Abb. 4):
Freiheit als Ordnung
● Liberalismus: Die individuelle Freiheit des Bürgers steht hier im Vordergrund. Er soll sich als Wirtschaftsbürger entfalten können und der Staat garantiert ihm die hierfür nötigen Rechte und Spielräume. Der Bürger genießt Schutz vor staatlichen Übergriffen und hat ein Recht auf Mitwirkung bei der politischen Entscheidungsfindung.
Vorrang des Gewordenen
● Konservativismus: Zentraler Bezugspunkt des politischen Denkens sind hier organisch gewachsene Einheiten wie Familie und Volk und nicht das vereinzelte Individuum. Der Staat ist eine aus eigenem Recht existierende Einheit, die über den Einzelnen hinausreicht. Die Menschen sind prinzipiell nicht gleich. Trotzdem besteht für die Starken eine Fürsorgepflicht gegenüber den Schwachen. Politische Mitwirkung wird auf ein Mindestmaß beschränkt.