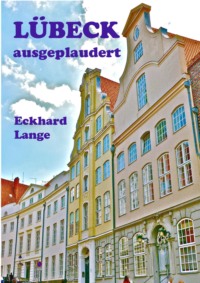Kitabı oku: «Lübeck - ausgeplaudert», sayfa 2
3. Lübeck und die hohe Politik
Neben all den Luxuswaren gab es seit langem ein Handelsgut, das nicht nur bei den Reichen begehrt war im Reich: Getrockneter oder gesalzener Fisch. Denn er konnte jene Nahrungsmittel aus dem Fleisch von Tieren ersetzen, deren Genuß allen Christenmenschen an den Fastentagen untersagt war – und davon gab es viele, nicht nur die vierzig Tagen vor dem Osterfest, sondern auch zu anderen Zeiten und an jedem Freitag ohnehin, weil er an die Kreuzigung des Herrn erinnerte. Schon lange war auf dem Handelsweg von Bardowiek, der letzten großen Stadt des Frankenreiches, über Liubice und die Ostsee Hering in großen Mengen nach Süden verbracht worden. Aber er wollte zunächst einmal gesalzen werden, und dieses wichtige Produkt mussten die Skandinavier aus dem Reich, genauer: aus Lüneburg einführen. So wanderten tausende Salztonnen hin und her – mit dem weißen Gold nach Norden und den gut gesalzenen Fischen zurück nach Süden. Und bald lief Lübeck dem sächsischen Bardowiek den Rang ab: Denn hier trafen nun Land- und Seeweg zusammen, hier wurde umgeschlagen und entsprechend Gewinn gemacht.
Herzog Heinrich sah es mit wachsendem Unmut, denn die entsprechenden Steuern kassierte jetzt nicht mehr der herzogliche Vogt in Bardowiek, sondern Graf Adolf als Stadtherr von Lübeck. Nun war der Schauenburger zwar Lehnsmann des Herzogs, doch teilen wollte er den Gewinn nicht, im Gegenteil: Im nahen Oldesloe fanden sich Salzquellen, so wurde auch Lüneburg und damit wiederum der Herzog geschädigt. Aber Heinrich hatte ein wirksames Mittel in der Hand, ohne dass er zur Waffe greifen mußte: die Privilegien Lübecks. Er hatte sie ausgestellt in Vertretung des Kaisers, also konnte er sie auch wieder zurücknehmen. So verbot er 1156 der Stadt den Fernhandel, ob auf dem Markt oder am Hafen. Der Graf verlor viel Geld, die Lübecker aber noch mehr: nämlich die Grundlage ihrer Existenz. Als dann im Jahr darauf eine gewaltige Feuersbrunst die gesamte Stadt niederbrannte, schien ihr Ende nach nur wenigen Jahren besiegelt.
Die Häuser hätte man wieder aufbauen können, aber was ist ein Kaufmann, wenn er nicht handeln darf? Also schickten die Lübischen zum Herzog: Wenn er etwas gegen den Grafen habe, dann würden sie ja bitte schön auch da ihre Stadt anlegen, wo er das Sagen habe. Heinrich wies ihnen einen Platz an der Wakenitz zu, dort, wo ihre Schiffe allerdings nicht mehr hin segeln konnten angesichts der Wasserstände, und wir dürfen vermuten, genau das war auch gewollt.
Denn weder Herzog noch Graf hätten dabei letztlich etwas gewonnen. Verhandlungen folgten, die beiden feilschten, aber endlich trat Graf Adolf seine Rechte an Lübeck, jetzt nur noch ein wertloser Trümmerhaufen, an seinen Herzog ab, gegen gutes Geld, versteht sich, und der Löwe gründete die Stadt von neuem, jetzt also zum vierten Mal, eben dort, wo sie hingehörte: auf dem Hügel Buku. Das war im Jahre 1159. Nun saß also ein herzoglicher Vogt in der Burg von Lubeke. Aber wichtiger war, dass alle alten Privilegien bestätigt wurden, dass der Handel wieder florierte. Und dass man jetzt einen weitaus mächtigeren Schutzherren hatte.
Doch der wurde irgendwann zu mächtig – zunächst in den Augen vielen Fürsten des Reiches und vor allem der sächsischen Adligen, endlich jedoch auch seines Kaisers Friedrich I, genannt Barbarossa. Die beiden waren zwar Vettern, und der Rotbart hatte den Löwen lange Zeit gewähren lassen, sicherte er doch das Heilige Römische Reich gegen die Dänen und die slawischen Obotriten. Aber als der Herzog ihm die Heerfolge verweigerte bei seinen Kämpfen in Oberitalien, war der Bogen überspannt: Der Kaiser ließ den Unbotmäßigen auf dem Hoftag in Gelnhausen 1180 verurteilen und ächten, sein Herrschaftsgebiet wurde aufgeteilt und anderen übertragen. Doch noch gab der Löwe sich nicht geschlagen, also mußte der Kaiser ihn mit Waffengewalt vertreiben.
Und so war Lübeck plötzlich hineingezogen in die große Politik: 1181 erschien Barbarossa mit Heeresmacht vor den kürzlich errichteten Mauern der Stadt und ließ schon einmal einige Bliden heranschaffen, um große Steine gegen die Mauern und darüber hinweg auch in die Stadt zu schleudern - damals eine gefürchtete Waffe. Nicht jede Stadt ließ sich schließlich mit einem trojanischen Pferd erobern.
.......................................................................................................................................
Im Saal über der Tuchhalle am Markt versammelten sich die Ratsherren, allesamt Fernkaufleute. Man war besorgt, sehr besorgt sogar. „In wenigen Tagen wird der Kaiser mit seinen Truppen vor dem Burgtor stehen,“ sagte Herr Gerhard und nahm auf dem Stuhl des Bürgermeisters Platz. „Graf Simon wird die Tore nicht freiwillig öffnen, schließlich vertritt er den Herzog.“
„Dem wir einen feierlichen Treueid geschworen haben,“ ergänzte Herr Albrecht, der Älteste unter den Ratsherren. „Wir werden wohl oder übel unsere Stadt verteidigen müssen.“ - „Um dann von den Kaiserlichen erstürmt zu werden! Nein, Albrecht, das wird nicht gut ausgehen. Wir sollten die Sächsischen samt dem Grafen in der Burg einschließen und den Kaiser würdig empfangen,“ schlug ein anderer vor. „Die römische Majestät ist schließlich Lehnsherr auch des Herzogs, und sie hat ihn in die Acht getan.“
„Und wie wollt Ihr einst vor den himmlischen Richter treten - als Eidbrüchige?“ erregte sich Albrecht, der wahrscheinlich als erster diesen Gang anzutreten hatte.
Bürgermeister Gerhard hob beide Hände: „Das mit dem Schwur bei allen Heiligen ist eine Sache, da mag jeder sein Gewissen befragen. Aber wir sollten auch etwas anderes bedenken in dieser Stunde: Wir alle sind Kaufleute, jeden Tag schließen wir Verträge mit Käufern und Kunden, und nicht nur mit Händlern, sondern auch mit Städten und Fürsten, leisten einen Eid, um uns für den Vertrag zu verbürgen. Ich frage Euch, ihr Herren: Wer wird uns noch trauen, uns für ehrbare Kaufherren halten, wenn wir einen so wichtigen Eid leichtfertig brechen? Und wissen wir, ob der Herzog nicht einmal zurückkehren wird? Was wird er dann mit dieser Stadt tun? Denkt nur an Halberstadt! Das hat er grausam niederbrennen lassen, als er mit Bischof Ulrich in Streit geraten war.“
Nun mischte sich Herr Johann ein. Er war weit herumgekommen mit seinen Schiffen, war welterfahren und klug: „Gerhard hat recht,“ sagte er, „aber es gibt einen Weg: Wir sollten Herzog Heinrich bitten, uns von diesem Eid zu entbinden. Bitte, haltet das nicht für einfältig! Er wird einwilligen, eine vom Rotbart zerstörte Stadt nützt ihm wenig. Noch hofft er ja, gegen die kaiserliche Majestät zu gewinnen. Und wir sollten den Kaiser um Waffenruhe bitten - und um Erlaubnis, dass wir Boten nach Stade zum Herzog schicken mit diesem Anliegen. Sind sie zurück, würden wir ihn mit allen Ehren in unserer Stadt begrüßen.“
War es so? Oder war es so ähnlich? Vielleicht.
.......................................................................................................................................
Zum ersten Mal war also hohe Diplomatie gefragt. Und die übernahm ein anderer Heinrich: Lübecks Bischof, aus dem fernen Oldenburg inzwischen an die Trave übergesiedelt und mit dem Herzog seit langem freundschaftlich verbunden. Er handelte mit dem Kaiser eine Waffenpause aus, damit der Lübecker Rat nach Stade schicken konnte. Der Kaiser mag gerührt gewesen sein über so viel Biederkeit - da war er aus den eigenen Kreisen anderes gewohnt - Heinrich war da das beste Beispiel. Doch der geschasste Herzog gewährte gnädigst das Erbetene.
So empfingen nun die Bürger Lubekes den hohen kaiserlichen Herrn mit aller Ehrerbietung: Feierlich wurde er in die Stadt geleitet, mit Hymnen und Lobgesängen, wie die Chronik vermeldet, und das nicht ohne Grund: Denn was würde mit all den wichtigen Privilegien geschehen, die Heinrich gewährt hatte, wenn es nun keinen Sachsenherzog mehr gab? Wer würde Stadtherr werden, Schutzherr in gefährlichen Zeiten? Und der Kaiser gab sich großzügig: Nicht nur all diese Rechte gewährte er, sondern auch manches mehr. Vor allem Land rings um die Stadt und Besitzrechte auf dem Wasser übertrug er den Bürgern Lübecks – ein unschätzbarer Gewinn im Dauerstreit mit den Holsteiner Grafen.
Und 1188 legten ihm Lübecks Gesandte dann noch einmal eine schöne Urkunde vor, die man eigens für ihn aufgeschrieben hatte, mit alledem, was er zugesagt hatte – und vielleicht noch ein bisschen mehr? Schaden könnte das ja nicht, und das Original wäre schließlich nur in Lübeck einzusehen. Jedenfalls bestätigte Friedrich Barbarossa feierlich, dass Lübeck nicht etwa den Grafen von Holstein, sondern allein dem Kaiser unterstellt sei. Die Verwaltung aber blieb dem Rat vorbehalten, er konnte ordnen, was es zu ordnen gab, zum Besten der Stadt und ihrer Bürger. Lübeck war eine freie Stadt des Reiches geworden – aber nur, wenn das Reich stark genug und willens war, das auch durchzusetzen.
4. Lübeck – Stadt der Kaufleute
In jeder Stadt des Heiligen Römischen Reiches, gleich ob schon aus römischen Zeiten herübergerettet oder neu gegründet, gab es eine ständische Ordnung: Es gab Krämer und Großkaufleute, es gab Handwerker unterschiedlichster Art und Bedeutung, organisiert in Zünften, Gilden oder Ämtern, es gab Mägde, Knechte, Gesellen, Lehrlinge, Tagelöhner und „unehrliche“ Berufe wie den Abdecker oder den Henker, aber auch den Spielmann oder den Barbier. Und es gab eine Hierarchie im System der Mitbestimmung am Schicksal der Stadt: Da waren die herrschenden Familien, „ratsfähig“ nannte man sie in Lübeck, Patriziat in anderen Städten, da war die gar nicht so große Zahl der einfachen Bürger, also im Besitz des Bürgerrechts und damit in meist recht geringem Maße mitbeteiligt an manchen Entscheidungen, und da war die große Menge bloßer Einwohner, weil sie die Bedingungen für einen Bürgereid nicht erfüllten: Grundbesitz, bestimmte Einkünfte, freie und 'ehrliche' Geburt. Und männlich mussten sie auch sein! Demokratisch sieht anders aus. Aber dieser Begriff stammt schließlich aus einer anderen Zeit. Heute würde man das eine Oligarchie nennen.
Lübeck war da keine Ausnahme, im Gegenteil: Seit dem ersten Tag waren es die Fernhändler, die hier schon vor der Gründung lebten und handelten, Männer, die sich um des Handels willen zusammentun mussten und dann wohl auch als eine Art Schwurgemeinschaft dem Stadtgründer gegenüberstanden. Jedenfalls stellten sie die Verhandlungspartner des Stadtherrn, aber auch die ersten Männer, die Verantwortung übernahmen für gemeinnützige Aufgaben. Schließlich ging es bei allem um ihre Existenzgrundlage, den freien Handel. Aber auch adlige oder (obwohl das im Grunde dasselbe war) geistliche Stadtherren anderweitig förderten die Kaufleute in ihren Städten nach Kräften, denn ihre Tätigkeit war auf Gewinn ausgerichtet, während das Handwerk sich mit Selbstversorgung zufriedengab. Und Gewinn lässt sich abschöpfen – durch Zölle, Abgaben, Steuern. Daher der Boom der Stadtgründungen im 11. und 12. Jahrhundert!
Daher auch die Bereitschaft der adligen Herren, dieser neuen Schicht neue Rechte einzuräumen. Denn eigentlich waren im christlichen Weltbild Handeltreibende gar nicht vorgesehen. Die Gesellschaft bestand, so wusste man, aus drei tragenden Säulen: demAdel, dem Klerus und der – arbeitenden – Landbevölkerung, oder, wie man es formuliert hat: bellatores, der Wehrstand, oratores, der Lehrstand und laboratores, der Nährstand. Konnte man zum letzteren notfalls auch die Handwerker rechnen, der frei herumreisende Händler passte dort nicht hinein. Er war zwar Untertan und Bürger, aber zugleich auch Abenteurer und Weltbürger; er besaß Haus und Grund und erwirtschaftete doch sein Vermögen durch Kauf und Verkauf; er war reich nicht wegen der Hufen in seinem Besitz, der Abgaben seiner Hörigen, sondern weil sich in seiner Truhe gemünztes Silber ansammelte. Und er trat Adel und Klerus zunehmend selbstbewusster gegenüber.
Nehmen wir also ein wenig Anteil an einem lübischen Kaufmann! Nennen wir ihn Johann Bardewick, unseren erdachten Handelsmann. Denn er war von dort – aus der damals noch florierenden Metropole Bardowiek – ins aufstrebende Lubeke gekommen, mit Sack und Pack sozusagen. Er war also neu in der Stadt an der Trave, aber kein Unbekannter, hatte er doch schon seit Jahren erfolgreich im Salzhandel mitgemischt. Seitdem aber die Ilmenau jetzt auch bis Lüneburg schiffbar wurde, fiel Bardowiek als Umschlagplatz fort; und außerdem hatte Herzog Heinrich seine Gunst ganz der neuen Hafenstadt zugewandt. Da war es lohnender, seine Geschäfte gleich von dort aus abzuwickeln. So erwarb Johann ein noch unbebautes Grundstück in der Mengstraße, dicht am Hafen, errichtete dort ein Hallenhaus, wie es in seiner sächsischen Heimat üblich war – dreischiffig mit kräftigen Hölzern als Pfeiler, um auch den weiten Boden unter dem Reetdach gut nutzen zu können.
Das nötige Vermögen hatte er aus Bardowiek mitgebracht, und es half ihm auch, möglichst rasch den Eid auf den Rat abzulegen, um die Bürgerrechte zu erhalten. Sein Weib, die zwei Söhne und drei Töchter waren ihm gefolgt, und für Trineke, die jüngste, hatte er schon einen Vertrag mit der Oberin des gerade erst geweihten Johannesklosters geschlossen, falls er sie nicht unter die Haube bringen konnte. Hinrich, sein Ältester, war schon fast erwachsen und würde ihn bald auch auf seinen Fahrten begleiten können. Denn Johann hatte vor, seine Geschäfte auszuweiten: Schon aus Bardowick hatte er Anteile an drei lübischen Schiffen erworben, und auf einem wollte er sich zum ersten Mal in seinem Leben auf die stürmische See begeben.
Vorsorglich hatte er beim Rat ein Testament hinterlegt, bezeugt von zwei Ratsherren, und außerdem dem Altar des Heiligen Nikolaus als Schutzpatron der Schiffer zwei große Wachskerzen gestiftet. Übrigens war Nikolaus gleichsam umgezogen: Der Herzog hatte dem Wunsch des Oldenburger Bischofs stattgegeben, den Sitz des Bistums nach Lubeke verlegen zu dürfen, hatte ihm Grund und Boden im Süden des Stadthügels geschenkt und dort ein erstes, noch recht bescheidenes Oratorium errichten lassen, damit Bischof und Domherren die Messe feiern konnten.
Vor allem aber hatte er einige Jahre später feierlich den Bau eines steinernen Domes begonnen, einer Basilika von beträchtlichem Ausmaß, wie sie einem Bischof gebührte. Selbst der Erzbischof aus dem fernen Bremen war angereist, um der Weihe des Grundsteins die nötige Würde zu geben.
Und der Backstein imponierte anscheinend dem Herzog als Baumaterial, so dass er ihn nicht nur für seine Burg im Norden der Halbinsel verwendet, wo diese Ziegel bis auf den heutigen Tag das Fundament am Burgtor bilden. Er nutze sie einige Zeit später, als er schon den Zorn seines kaiserlichen Vetters zu spüren bekam, auch für die bürgerliche Civitas, also den besiedelten Teil auf der Mitte des Hügels, die er nun mit einer Backsteinmauer gegen einen befürchteten Angriff sicherte.
Um auf Johann zurückzukommen: Er plante also, die Insel Gotland anzusteuern, denn der Herzog hatte nicht nur den Gotländern zollfreien Handel in seinen Territorien zugesichert, sondern im Gegenzug auch die Rechte seiner lübischen Kaufleute dort auf der Insel gefestigt – ein weitsichtiges Abkommen war so 1160 zustande gekommen. Wir berichteten bereits davon, Die Schwurgemeinschaft der deutschen Gotlandfahrer hatte nun feste Häuser und einen ständigen Vertreter dort auf der Insel, gleichsam einen zollfreien Hafen und eine exterritoriale Siedlung. Auf Gotland landeten die Nordmänner schließlich alle Waren an, die sie aus Nowgorod und von den Häfen der Esten und Kuren herbeibrachten.
Aber der Schiffsführer, dem sich Johann anvertraut hatte, wollte mehr: selbst von Gotland aus die ferne Küste ansteuern, hinter der dieses sagenhafte Nowgorod lag – ein großes Abenteuer, aber eine ebenso große Chance, den Gewinn ohne den Zwischenhandel um ein vielfaches zu steigern. So konnten die mitgeführten flandrischen Tuche und die Schwerter und Helme westfälischer Werkstätten direkt gegen Zobel und Marder, aber auch gegen Teer und Wachs getauscht werden.
Lassen wir es also dahingestellt, ob unser guter Johann gesund und mit reichem Gewinn seine Reise beendet hat oder doch in Visby von einem rauflustigen Gotländer erschlagen wurde oder gar in den Tiefen der Ostsee inmitten eines Schiffswracks auf die Auferstehung des Leibes wartet, an die er sicher fest geglaubt hat. Vielleicht aber begegnen wir seinem Sohn oder Enkel ja noch einmal im Laufe der Geschichte.
5. Lübeck – Stadt der sieben Türme
Zugegeben, Köln hatte im Mittelalter weitaus mehr Kirchen als Lübeck, aber Köln war auch jahrhundertlang die größte Stadt des Reiches nördlich der Alpen – und übrigens auch der Ursprungsort der Hanse. Aber davon später. Doch mit seinem Dom, den vier Pfarrkirchen, vier Klöstern, einem Spital und einigen Kapellen konnte die ja erst viel später entstandene Stadt an der Trave sich schon sehen lassen. Sieben Türme, ihr heutiges Markenzeichen, hatte sie damals allerdings noch nicht. Und wir hatten es schon gesehen: Die Anfänge des Kirchbaus waren noch äußerst bescheiden: Hölzerne Kirchlein, wohin man blickte. Aber schon bald – anders als die ersten Feldsteinkirchen in Wagrien – entdeckte man (wieder) ein solides Baumaterial: den Ziegel, oder, wie man gemeinhin hier entlang der Ostsee sagt: den Backstein.
Steine hatten die Eiszeiten zwar hier und da zurückgelassen, aber nur hartes Felsgestein statt der weiter südlich üblichen und leichter zu bearbeitenden Sand- oder Kalksteine. Ton dagegen gab es in großen Lagern, längs der Trave gleich vor der Stadt, und bald wurden die Holzbauten durch Backsteinkirchen ersetzt. Noch waren es romanische Basiliken, eintürmig und massiv. Aber Herzog Heinrich plante für das Lübecker Bistum schon eine Kathedrale, zweitürmig, wie es sich für eine Bischofskirche gehörte, ähnlich dem Dom seiner Residenzstadt Braunschweig. 1173 hatte er gemeinsam mit Bischof Gerold den Grundstein gelegt – wir wissen es schon - und zugleich für den Bau eine jährliche Gabe von 100 Mark gestiftet – damals eine beträchtliche Summe, zumal der Löwe ja auch andere Bistümer im slawischen Missionsgebiet förderte: Ratzeburg und Schwerin.
Es war mit den 92 Metern in der Länge der erste Großbau, den man allein mit den kleinen Ziegelsteinen aufführen wollte, und entsprechend mächtig mussten Wände und Pfeiler werden. Der Bau zog sich hin, nicht nur, weil die vielen Backsteine mühsam genug produziert werden mussten, sondern auch wegen der unsicheren politischen Verhältnisse, nachdem der Löwe gestürzt und das Herzogtum zerschlagen war. Erst 1247 konnte der Dom geweiht werden - fast hundert Jahre später. Knapp zwei Jahrzehnte danach jedoch reichte er den Bischöfen nicht mehr, denn sie unterlagen einem ständigen Konkurrenzdruck im Vergleich mit der Kirche des Rates, St. Marien.
...................................................................................................................................
Vor jeder Sitzung versammelte sich der Rat in der Marienkirche, um der heiligen Messe zu lauschen, bevor er ins Rathaus hinüberging. Doch heute ist es anders: Statt schweigend in den Ratssaal zu schreiten, hält Wilhelm Witte seinen Ratskollegen Heinrich von Bockholt zurück: „Auf ein Wort, Heinrich! Habt Ihr bemerkt, wie düster unsere Kirche heute wieder gewirkt hat?“ - „Es ist neblig, da mag es wohl so scheinen,“ erhält er zur Antwort.
„Nein, das ist es nicht: Die kleinen Fenster, dieser ganze Bau - das ist doch nicht mehr unserer Zeit angemessen. Da baut man im fernen Frankreich längst anders.“ - „Wilhelm, haben wir nicht die alte Basilika gerade erst zu einer weiten Halle umgebaut, wie man es in Westfalen getan hat? Und unser Werkmeister mit seinen Leuten ist noch lange nicht fertig. Wie sollen wir seine Pläne da noch einmal ändern?“ Herr Wilhelm schaut den anderen mit geheimnisvoller Miene an: „Wir müssen jetzt eilen, die anderen sind schon durchs Tor. Aber ich bitte Euch heute nach dem Angelusläuten zu mir, da möchte ich Euch zeigen, was ich von der letzten Reise nach Flandern mitgebracht habe.“
Heinrich von Bockholt ist neugierig geworden, so schreitet er eilig die Alfstraße hinunter, um Wilhelm Witte zu besuchen, kaum, dass die Glocken im Turm von St. Marien verklungen sind. Der Ratsherr erwartet ihn schon, führt ihn in seine Dornse und öffnet eine Truhe, um eine große Rolle zu entnehmen. Er breitet sie auf dem Pult aus und wartet schweigend, dass sein Gast die Zeichnung betrachtet.
Dann blickt Heinrich auf: „Das ist gewaltig,“ sagt er ehrfürchtig, „aber glaubt Ihr wirklich, eine solche Kirche kann man bauen? Die riesigen Fenster in den Wänden, dieser ganze Zierat! Und dann diese Türme, als ob sie den Himmel berühren! Das kann kein Werkmeister zustande bringen.“
Wilhelm Witte lächelt: „Und wenn ich Euch sage, ich habe solche Bauten mit eigenen Augen gesehen? Wir haben bislang Gottes Burgen errichtet. Nun aber können wir das himmlische Jerusalem auf die Erde holen! Und - wir könnten zwei Türme haben wie der Dom unseres Bischofs, aber sie wären weit höher als seine dort. Wir würden ein Mittelschiff errichten, wie es noch niemand in all den Städten entlang der Küste geschaut hat.“
„Und woher wollen wir die Unmengen an Kalkstein oder Sandstein herbeiholen für ein solches Werk?“ - „Wir werden sie nicht brauchen! Auch unser Backstein wird es tun, da bin ich sicher.“ Er streckt seinem Gast die Hände entgegen: „Ich bitte Euch, Heinrich, unterstützt mich im Rat, dass er einen solchen Bau beschließt. Es wird den Ruhm unserer Stadt bei allen wendischen Städten erhöhen, und...,“ er verzieht den Mund zu einem breiten Lächeln, „wir werden Bischof Johannes zeigen, dass wir Bürger dieser Stadt mächtiger sind als alle seine adligen Domherren zusammen.“
War es so? Oder war es so ähnlich? Vielleicht.
.......................................................................................................................................
So ist es: Die Pfeffersäcke hatten nun einmal mehr Geld zur Hand als die Pfaffen im Domkapitel. So hatten die Herren des Rats gewagt, auch ihrer Kirche nun zwei Türme vorzusetzen – eine Provokation. Und die zweite: Man hatte die gerade zur Hallenkirche umgebaute Basilika am Markt schon wieder teilweise abgetragen, um sie im inzwischen modernen Stil, den wir heute Gotik nennen, neu zu planen – mit sage und schreibe 38 Metern ragte nun das Gewölbe im neuen Chor der Bürgerkathedrale empor.
Konnten die geistlichen Herren schon mit dieser schwindelerregenden Höhe nicht mithalten, so versuchte es Bischof Johann von Tralau mit der Länge: ein riesiger Chor, ebenfalls gotisch-filigran, sollte den Dom noch einmal um 40 Meter verlängern. Aber wieder ging es nur schleppend voran, 1341 kann Bischof Bocholt endlich den neuen Chor weihen, um wenige Tage später dort auch seine letzte Ruhe zu finden.
Wir sind der Zeit weit vorausgeeilt, kehren wir also zu den Anfängen der anderen Kirchen zurück: Dass St. Petri und St. Marien, die beiden Kirchen am Markt, als romanische Basiliken ins steinerne Dasein starteten, sahen wir bereits. Aber selbst Kirchbau ist Modesache: Aus den Basiliken wurden frühgotische Hallenkirchen, das entsprach auch dem Selbstbewusstsein ihrer bürgerlichen Auftraggeber: Nicht mehr die Ausrichtung auf den Chor, den Bereich des Klerus, sondern die Halle als Versammlungsort der (Laien-)Gemeinde bestimmte die Bauidee. Und die Petrikirche wurde dann gleich um zwei weitere Seitenschiffe erweitert, war fast so breit wie lang.
Die Herren des Rats aber erfuhren von den neuen, himmelstürmenden Kathedralbauten in Frankreich, und sie beschlossen es den Vorbildern gleichzutun – ein kühnes Unterfangen angesichts des Backsteins als Baumaterial. Sie setzten damit zugleich ein Zeichen für all die vielen Neubauten in den neuen Städten entlang der Ostseeküste – von Wismar angefangen über Danzig und Riga bis ins ferne Tallinn, das damals Reval hieß. Aber auch innerhalb Lübecks wuchs die Zahl der Backsteinkirchen: St. Jakobi im Schifferviertel am Koberg, St. Ägidien im Handwerkerviertel am Osthang des Stadthügels. Hinzu kommen die Klosterkirchen, von denen heute nur noch St. Katharinen erhalten ist, die Predigtstätte der Franziskanermönche. Kirchen hatten natürlich auch die Dominikaner im sogenannten Burgkloster, die Zisterzienserinnen bei St. Johannes, Lübecks ältestem Kloster, und schließlich, nur wenige Jahre vor der Reformation erst fertig gestellt, das St. Annen-Kloster als Heimstätte für Lübecks ehelos gebliebene Jungfrauen aus den reichen Familien, nachdem den Bürgertöchtern die beiden Nonnenklöster in Rehna und Zarrentin verschlossen blieben.
Kirchen jedoch waren mehr als nur Orte, an denen ein Kleriker die (lateinische) Sonntagsmesse las. In ihnen wuchs die Zahl der Altäre und der seitlichen Kapellen, weil es galt, bewusste und unbewusste Sünden zu sühnen, ehe der Tod den Menschen dahinraffte – und auch danach noch gab es eine Chance, dem Fegefeuer rascher zu entfliehen: die Seelenmessen zu Gunsten der verstorbenen Vorfahren. An Sünden mangelte es dem normalen Christenmenschen ja nicht, und ob nicht sogar das Gewinnstreben des Kaufmanns ohne alle produktive Tätigkeit schlechthin sündhaft war, das blieb letztlich ungeklärt.
So war es schon angebracht, sich die Fürbitte der Heiligen durch mancherlei Geschenke zu sichern – von der schlichten Wachskerze bis hin zum geschnitzten Retabel auf einem steinernen Altartisch. Und eine Präbende – Pröven sagte man in Norddeutschland dazu - mit der man einen eigenen Priester bezahlen konnte, der für den Stifter die tägliche Messe las und seine Fürbitte gen Himmel schickte, war ebenso von Vorteil wie eine fromme Stiftung zugunsten der Witwen und Waisen, denn Barmherzigkeit war eine wichtige Tugend, wo man schon nicht immer tugendsam leben konnte. Es waren die reichen Bürger, die ein dem Heiligen Geist geweihtes Hospital stifteten, zunächst in der Marlesgrube, aber dort erhob der Bischof Ansprüche. Und so baute man wenig später am Koberg eine riesige Halle und davor eine zweischiffige Kirche, und beides wurde von einem bürgerlichen Gremium verwaltet.
Kirchen waren jedoch ebenso der Ort, in dem oder doch um den herum die Menschen ihre letzte Ruhe fanden, und je näher dem allerheiligsten Sakrament, desto näher auch dem erhofften Paradies. Wer zu den angesehenen, den ratsfähigen Familien gehörte, hatte sein Erbbegräbnis möglichst gleich in St. Marien – dort, wo der Rat sich versammelte, ehe er in das neu errichtete Rathaus gleich nebenan zog.