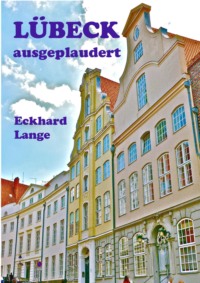Kitabı oku: «Lübeck - ausgeplaudert», sayfa 4
8. Noch einmal: Lübeck als Stadt des Reiches
Ja, nichts währt ewig, auch keine Großmächte. Warum mußte König Waldemar II auch auf einsamer Insel nach einem Jagdausflug in einer schönen Mainacht unbewacht in sein Zelt kriechen? Der Graf von Schwerin hatte allen Grund, diesen Mann zu kidnappen, schließlich war sein Schwerin von den Dänen besetzt worden. Aber einen Ort, ihn einzusperren, fand er dennoch. Zwei Jahre lang feilschte der Graf um den Preis, den König wieder freizulassen, und eine große Koalition von Feinden des Dänen stand ihm bei. Als die dann auch noch ein dänisches Heer besiegte, mußte Waldemar (sicherlich zähneknirschend) nicht nur 45.000 Mark Silber auf den Tisch legen, sondern auf alle Gebiete verzichten, die zum heiligen römischen Reich gehörten – Mecklenburg, die Grafschaften Schwerin und Holstein. Da hatten auch die Lübecker schon die Zeichen der Zeit erkannt und die dänische Burgmannschaft sicherheitshalber davongejagt.
Doch sogleich wuchs die Gefahr, dass ein anderer die leere Burg besetzen könnte. Also rissen sie erst einmal die gegen die Stadt gerichteten Mauern dieser Festung nieder.
Außerdem ließen sie sich in einer gewichtigen Urkunde von den fürstlichen Gegnern Waldemars bescheinigen, dass ihre Unterstützung auf eigene Rechnung geschehen sei und ganz und gar freiwillig. Aber letztlich konnte jetzt jeder Anspruch auf die Stadtherrschaft erheben, und Adolf IV, Graf im gerade wiedergewonnenen Holstein, würde sicher bald darauf zurückkommen.
Die Herren des Rats sannen auf Abhilfe, und die sah so aus: Man holte die alte Urkunde Kaiser Barbarossas aus der Truhe, und da sie schon ein wenig vergilbt war, schrieb der Notar des Rates namens Marold sie fein säuberlich ab – und gleich ein paar weitere wichtige Dinge mit hinein. Schließlich hatte ja Waldemar den Lübeckern ebenfalls einiges zugestanden. Aber etliche ganz neue Wünsche tauchten ebenfalls dort auf, die man dabei dem Kaiser als vorhandenes Privileg unterschieben konnte: So sollte der Rat Verstöße gegen seine eigenen Erlasse auch bestrafen können, und er hätte das Recht, die Pfarrer seiner Ratskirche St. Marien selber zu wählen. Schließlich sei die Stadt von der Heerfolge befreit. Und – vorsichtig, wie Geschäftsleute eben sind – die alte Vorlage landete im offenen Kamin. Und dort brannte zufällig das Feuer. Daneben aber listete man noch weitere Punkte auf, die der Kaiser gewähren sollte und die man schlecht zurückdatieren konnte.
Mit diesen geschönten Dokumenten machten sich zwei Herren aus dem Rat auf, um über die Alpen ins ferne Italien zu reisen, wo Friedrich II. sich aufhielt. Im Mai 1226 trafen sie in Borgo bei Parma ein, und der Kaiser empfing sie freundlich. Die Barbarossa-Urkunde war rasch unterschrieben, doch mit den anderen Forderungen ließ er sich Zeit. Zwei Wochen mussten die lübischen Abgesandten ausharren, ehe sie das Pergament mit dem Reichssiegel und den Unterschriften vieler gewichtiger Zeugen, darunter drei Erzbischöfe, acht Bischöfe und etliche weltliche Fürsten, in den Händen hielten.
Doch das Zittern hatte sich gelohnt: Lübeck erhielt die Burg von Travemünde und den Priwall zugesprochen sowie weitere Bereiche längs der Trave, die bisher dem Holsteiner gehörten. Verboten war es allen Nachbarn, entlang der Trave eine Burg zu errichten und damit den Lübecker Handel zu gefährden. Auch sonst gab es allerlei Vorteile für die Lübecker Kaufleute, wenn sie im Reich unterwegs waren. Vor allem aber: Lübeck sollte frei sein, nur dem deutschen König, also dem Kaiser, unterstellt, es sei „Reichsgut“ – und es sollte auch in aller Zukunft nicht aus dem Besitz des Reiches herausgenommen werden, wenn es wieder einmal einem Kaiser in den Sinn kommen sollte, einem Fürsten die Stadtherrschaft abzutreten.
Das alles konnte Kaiser Friedrich zwar überhaupt nicht durchsetzen, aber es war ein unbestreitbarer Rechtstitel für die Stadt, und als die Sendboten mit ihrem kostbaren Dokument zurückgekehrt waren, legte man es in der Trese ab, der Schatzkammer der Stadt unter dem Dach von St. Marien – und bis 1940 war es dort wohlverwahrt, bis es nach manchen Irrungen 1986 wieder nach Lübeck zurückkehrte. Nur das goldene Siegel des Kaisers – die Bulle – hatte es dabei eingebüßt. Gold findet eben immer einen Käufer.
Noch aber war die Freiheit Lübecks nur ein Versprechen, für dessen Einlösung die Stadt erst selbst sorgen mußte. Zwar hatte Waldemar feierlich auf Rache verzichtet, doch bald versuchte er, das Verlorene zurück zu gewinnen. Schließlich hatte ihn der Papst höchst persönlich von seinem erzwungenen Eid gelöst.
9. Lübeck – Zentrum des Fernhandels
Waren es anfangs zumeist Luxusartikel, die unsere aben- teuernden Fernhändler mit der Knorr, dem etwas breiter ausladenden Langschiff der Nordmänner, von Gotland herbeischafften und damit glänzende Geschäfte machten, so wuchs im 13. Jahrhundert der Bedarf an Massengütern: Weizen, Holz, Wachs und Honig, vor allem aber Fisch, getrocknet, gedörrt, gesalzen. Und langsam wurde es schwierig, das alles auf dem Seeweg zu befördern.
...................................................................................................................................
Dietrich Bokholt hat sein Schiff im Hafen von Skanör mit Heringsfässern beladen. Gerade hat er sich vom Ältermann der Hansischen verabschiedet und schlendert zurück zum Strand. Doch plötzlich stutzt er: Dicht neben dem seinen liegt ein fremdes Schiff, und fremd ist auch seine Bauart.
Zwar ist es kaum größer als seine Knorr, doch weitaus bauchiger und mit höheren Bordwänden; der Vordersteven ragt ohne jede Krümmung aus dem Wasser, der hintere ist noch steiler und ebenfalls gerade. Auch liegt das Schiff viel dichter am Ufer, es scheint einen flachen Boden statt des üblichen Kiels zu haben. Das erklärt auch, warum es so breit und behäbig erscheint. Gerade kommt sein Schiffsführer hinzu, auch er betrachtet das andere Schiff mit Erstaunen.
„Seht nur,“ sagt er zu Dietrich: „Nirgends sind die Planken geklinkert! Keine liegt über der anderen, keine ist genagelt und gedichtet worden. Ob man mit solch glatten Schiffswänden wohl schneller durch das Wasser gleitet?“ Dietrich zuckt die Achseln. Er bewundert eher, dass dieses Schiff nicht offen ist, sondern nach oben hin geschlossen. Und auf dem Heck sitzt sogar ein erhöhtes Podest wie ein flachgedeckter Schuppen. Neugierig tritt er näher an das Ufer heran. Vom Mast weht der Wimpel einer St. Knut-Gilde, also kommt das Schiff wohl von einer der dänischen Inseln.
Doch dann sieht er, wie der Schiffer an Deck kommt, und ruft ihn an: „Sagt, guter Freund, was habt Ihr da für ein Schiff?“ Der Däne lacht: „Da staunt Ihr, nicht wahr? Dabei gibt es diese Koggen schon seit langem. Die Friesen fahren darauf, denn mit dem flachen Boden liegt es gut auf, wenn im Hafen Niedrigwasser ist. Das ist auch im flachen Wattenmeer ein großer Vorteil. Und wie Ihr seht, lässt sich das Schiff darum auch viel weiter an eine Kaikante bringen.“
„Aber Ihr habt keine Ruderer?“ „Nein, wir fahren allein mit dem Segel. Das spart eine gute Anzahl Schiffsvolk, und Ihr wisst selber, dass damit die Frachtkosten sinken.“ - „Ja, das ist wahr,“ bestätigte Dietrich, und sein Interesse an diesem Schiffstyp steigt. „Und wer hat Euch diese Kogge, wie Ihr sie nennt, gebaut?“ „Meine Schiffsherren haben sie einem Händler aus Dorestad abgekauft. Aber auch in Jütland, so hörte ich, wurden bereits die ersten gebaut.“
„Und wie viel Last könnt Ihr an Bord nehmen?“ fragt Dietrich. „Nun, mit sechzig Last sind wir vollbeladen.“ - „Das hört sich gut an, unsere Knorr faßt gerade einmal die Hälfte. Und Ihr sagt, die Jütländer können solche Schiffe auf Kiel legen?“ Der Schiffer lacht: „Kiel ist gut. Der Koggenboden ist platt wie ein großes Brett, da dient der Kiel nur noch dazu, die Steven zu halten. Doch das kann ich Euch leider nicht zeigen, es sei denn, Ihr lasst Euch kielholen.“ Nun lacht auch Dietmar: „Vielen Dank, darauf verzichte ich gern. Jedenfalls wünsche ich Euch eine gute Reise!“
Dietrich Bokholt ist nachdenklich geworden. Dieses andere Schiff scheint wirklich besser zu sein als die Knorr, wie man sie in Lubeke nutzt. „Man müsste einmal eine Fahrt mit einer solchen Kogge machen,“ sagt er zu seinem Schiffsführer. „Ich muß darüber unbedingt mit den anderen Kaufleuten reden.“
War es so? Oder war es doch so ähnlich? Vielleicht.
.......................................................................................................................................
Und die Lübecker ließen sich rasch überzeugen, zu groß waren die Vorteile dieses neuen Schiffstyps. Auf Ruderer konnte man so verzichten, ein Mast mit einem großen Rahsegel reichte, und der breite Rumpf fasste eine große Ladung. 100 bis 200 Tonnen – nach unseren Maßen – konnten es schon sein. Kein Wunder, dass dieses Schiff, die berühmte Kogge, und danach die etwas verbesserte Kraweel, für gut zweihundert Jahre das Transportmittel schlechthin auf Nord- und Ostsee wurde. Es war schneller herzustellen, verbrauchte weniger Material und war noch bei mäßigem Wind rascher am Ziel als jeder Fuhrmann an Land. Ein hoher Aufbau am Heck, das Kastell, bot Platz für Schiffsführer und die mitreisenden Kaufleute, das Ruder wanderte von Steuerbord ans Heck und machte das Schiff wesentlich manövrierfähiger.
Segelte man anfangs noch möglichst unter Land, also in Sichtweite der Küste, um sich zu orientieren, so fuhr man jetzt auch über das offene Meer. Das verkürzte den Seeweg, und selbst bis ins ferne Reval war man gerade eine Woche unterwegs. Lange Zeit war für die Lübecker Händler Gotland das erklärte Ziel, hier nahmen sie von den Nordmännern die Waren des Ostens in Empfang und tauschten sie gegen das, was sie mitbrachten. Wir erinnern uns: Schon Heinrich der Löwe hatte nicht nur den gotländischen Kaufleuten freien Handel in seinen Landen zugesagt, sondern auch den Lübeckern gleiche Rechte auf der Insel beschafft. Viele blieben dort länger, manche auch über Winter. Und in Visby, dem Hauptort Gotlands, gab es bald ein eigenes deutsches Viertel mit einer eigenen Kirche für die Genossenschaft der lübischen Gotlandfahrer. Visby war also die Spinne im Netz des Ostseehandels.
Aber Lübeck wuchs ebenso zu einem Knotenpunkt von See- und Landwegen heran. Zwei Spinnen in einem Netz? Wie lange würde das gut gehen? Zunächst war Visby die eigentliche Schutzmacht der deutschen Händler, nahm sie in ihrer Niederlassung in Nowgorod auf, gründete dann gemeinsam mit ihnen den Peterhof dort, das spätere Kontor der Hanse. Visby war zur Großstadt geworden, schloß ein Bündnis mit Lübeck, gehörte dann auch zur Hanse. Viele lübische Kaufleute blieben ganz auf der Insel, wurden Bürger Visbys. Doch um die Verwaltung des Peterhofs gab es Streit zwischen den beiden Städten, und irgendwann war es Lübeck, das die Nase vorn hatte. Irgendwann hat eine Spinne die andere gefressen.
Es waren also lange Jahrzehnte die Genossenschaften der Kaufleute, die mit den einheimischen Größen verhandeln mussten. Und es gab viel zu bereden: Welche Rechte hatten sie als Ausländer in der Fremde, von welchen Abgaben und Zöllen wollten sie sich freikaufen, wie sah es mit der Selbstverwaltung in ihren Niederlassungen aus, welches Gericht war zuständig bei Streitigkeiten über Waren und Preise – oder bei Mord und Totschlag? Was ist mit Schiff und Ladung, wenn beides nach einem Schiffbruch am fremden Strand landete, was mit dem Hab und Gut eines Händlers, der dort fern der Heimat verstarb? Da wanderte manche Mark Silber in die Taschen von Grafen und Königen für ein durch viele Zeugen beglaubigtes Pergament, und doch blieb letztlich immer offen, ob sie sich an die erteilten Privilegien halten würden. Oder sie durchsetzen konnten bei ihren eigenen Leuten.
Nun gut, diese Genossenschaften, organisiert nach ihren Zielen, waren ernstzunehmende Partner, brachten sie doch die Waren ins Land, die dort dringend gebraucht wurden, brachten sie auch Einnahmen und Gewinn für die einheimischen Fürsten, indem sie deren Produkte aufkauften.
Oberstes Ziel aller lübischen und der anderen deutschen Kaufleute jedoch war es, Handelsmonopole zu schaffen, die Konkurrenz auszuschalten und die Preise zu bestimmen. Und notfalls griff man auch mit wenig Skrupel zum letzten Mittel, dem Boykott. In Norwegen hatte diese Politik zu einer landesweiten Hungersnot geführt, als die Weizenlieferungen eingestellt wurden, bis der König einlenken mußte.
Aber Ziel mußte auch sein, die Handelswege zu sichern, ob auf See oder auf den Straßen – vor Wegelagerern ebenso wie vor den vielen Zöllnern, die die Händler unterwegs gerne abkassierten im Auftrag aller möglichen Herren. Da waren die Hansischen dann gerne für einen freien Handel. Kommt irgendwie bekannt vor, nicht wahr?
Nach und nach häuften sich die Genossenschaften in der Stadt. Neben die Gotlandfahrer traten die Schonenfahrer, die Bergen- und Nowgorodfahrer, die Stockholmfahrer; und dann auch die Kaufleute, die über die Nordsee nach Brügge segelten, um von dort mit den Engländern zu handeln, den Hauptproduzenten von Schafwolle. Überall gab es Niederlassungen, eigene Wohnquartiere und damit auch Ältermänner, die vor Ort verhandelten, aber auch für Ordnung sorgten. Und viele dieser Zusammenschlüsse führten sogar ein eigenes Siegel, waren sozusagen 'staatlich anerkannte' Vertragspartner.
10. Lübeck und die Hanse der Städte
Nein, Lübeck hat die Hanse nicht gegründet. Es gab überhaupt keine Gründung, es gab weder Satzung noch Beitrittsurkunden. Und entstanden ist das, was wir 'Hanse' nennen, auch gar nicht an der Ostsee, sondern – am schönen Rhein. Genauer: in Köln. Könnte man jedenfalls so sehen.
Hanse – was bedeutet eigentlich dieser vielbenutzte Name, den noch heute Dutzende Städte als stolzen Titel tragen? Eigentlich etwas recht Schlichtes, so sagen jedenfalls die Fachleute. Mit 'Hanse' gemeint ist eine Schar von bewaffneten Männern. Und weil jene ersten wagemutigen Fernhändler sich für eine gemeinsame Reise gegenseitigen Beistand schworen, bildeten sie eben eine solche Gruppe. Und so blieb die Bezeichnung irgendwie an den Schwurgemeinschaften haften, auch als sie zu ständigen Genossenschaften wurden von Kaufleuten, die mit einer bestimmten Stadt Handel trieben.
Eine solche Genossenschaft gab es auch in Köln. Es waren die Kaufleute, die den seit römischen Zeiten am Rhein angebauten ordentlich vergorenen Rebensaft flussabwärts und über den Kanal nach England brachten und meist mit englischer Wolle zurückkamen. Dazu brauchten sie die Unterstützung des englischen Königs, denn der Handel mit Wolle und Tuchen lag fest in der Hand der Flamen, und es drohte die Gefahr, dass die flandrischen Kaufleute ein Handelsmonopol errichteten. Heinrich II, der Herrscher in London, sah es wohl ähnlich, und so stellte er die rheinischen Fernhändler unter seinen Schutz, gewährte ihnen den Bau einer Guildhall als Niederlassung am Ufer der Themse. Sein Sohn, Richard Löwenherz, ging etliche Jahre später wesentlich weiter: 1194 gewährte er den Kölnern die umfangreichsten Privilegien, die es damals gab – als Dank, dass sie ihm das Kapital geliehen hatten, mit dem er sich aus der Gefangenschaft des deutschen Königs loskaufen konnte.
In der Kölner Handelsbasis auf der britischen Insel aber tauchten bald auch niederdeutsche Kaufleute auf, und sie kommen aus verschiedenen Städten. Dennoch haben sich die Nordlichter zusammengeschlossen als Händlergemeinschaft, denn sie haben die gleichen Interessen, steuern die gleichen Ziele an. 1157 erhalten auch sie vom englischen König ein erstes Privileg für ihren Handel. Was aber noch wichtiger ist: Die Kölner und diese „Osterlinge“ schließen sich zusammen, wählen sich Ältermänner als Verhandlungsführer aller, schlicht und einfach, weil sie gemeinsam stärker sind. Miteinander leben und handeln sie nun im Stalhof, einer Erweiterung der alten Gildehalle mit Wohnhäusern und Warenspeichern.
Und hier in London taucht dann 1282 unser Begriff wieder auf, denn sie werden als 'de dudesche Hense' bezeichnet, oder in der allgemeinen Vertragssprache Latein: 'Hansa Alemanniae.' Sie selber sprechen eher von sich als dem 'gemenen Koopman,' also der gemeinsam handelnden Kaufmannschaft. Keine Geburt, keine Herkunft, keine fürstliche Gunst hat diesen Stand geschaffen, sondern allein ihr eigener Wille.
Kehren wir nach Lübeck zurück. Es sind zwar die gleichen Männer, die hier den Fernhandel beherrschen und im Rat die Stadt regieren, aber Beruf und Mandat, so könnten wir es mit heutigen Begriffen sagen, sind doch getrennt. Zunächst noch. Denn ob Kaufmann oder Ratsherr – sie verfolgen die gleichen Interessen. Und manchmal ist es eben nützlich, wenn in den Verhandlungen mit den politischen Größen nicht der Kaufmann auftritt, sondern der Ratsherr – also der Vertreter der Stadt. Und damit die Stadt selbst. Die Historiker sagen es so: Aus der Kaufmannshanse wird die Städtehanse. Natürlich nicht von heute auf morgen, und nicht von klugen Köpfen ausgeheckt. Es ergab sich halt so, und es war ja auch nützlich.
Schuld daran war die allgemeine Lage. Lassen wir einfach wieder einen Bardewik die Sache erklären. Es gab damals ja tatsächlich wieder einen im Lübischen Rat – Johann von Bardewik, und er war mehrfach zum Bürgermeister gewählt worden zwischen 1263 und 1290. Wir haben uns vor seinem Haus eingefunden, in der Breiten Straße, schräg gegenüber vom Rathaus. Gerade wollen wir uns den Buden der Goldschmiede zuwenden, die gegenüber, am Rand des weiten Marktplatzes, arbeiten und ihre Ringe und Halsketten anbieten, da öffnet sich auch schon die Tür und Herr Johann tritt heraus in seiner Schaube aus feinem braunen flandrischen Tuch mit dem Zobelkragen. Auf die Trippen, die hölzernen Überschuhe mit den Stelzen gegen den allgegenwärtigen Schmutz, hat er diesmal verzichtet, denn der Markt mit seinem festen Belag aus Holzbohlen wird regelmäßig gereinigt und zum Eingang des Gewandhauses sind schließlich nur wenige Schritte. Es ist zwar keine Ratssitzung angesagt, aber er will sich mit Hinrich von Wittenborg treffen, der in diesem Jahr wieder das Amt eines Bürgermeisters versieht. Es geht um einen wichtigen Vertrag, den Lübecker Sendboten mit den Vertretern der Nachbarstädte Wismar, Rostock und Kiel ausgehandelt haben, auch Stralsund ist trotz früherer Feindschaft mit Lübeck bereit, sich anzuschließen.
Wittenborg hatte Herrn Johann hinzugebeten, denn er hat Erfahrungen mit Verträgen, hatte er doch 1250 als gerade neu gewählter Ratsherr bereits erfolgreich mit König Hakon von Norwegen verhandelt. Johann von Bardewik war jahrelang nach Bergen gesegelt, hatte dort gelegentlich auch die Wintermonate verbracht, um rechtzeitig viele Tonnen Stockfisch aufzukaufen. Dafür hatte er neben Pelz und Wachs vor allem Weizen aus den preußischen Häfen nach Norwegen verschifft, denn das Land war schon länger auf Einfuhren angewiesen. Er kannte also die Situation gut, als es zu Auseinandersetzungen über die Rechte der Lübecker Kaufleute dort kam. Und er hatte ein Druckmittel: Die einheimische Getreideernte war 1249 wieder einmal unzureichend gewesen, König Hakon mußte die Lübecker dringend um weitere Lieferungen bitten. Der junge Ratsherr nutzte die Gunst der Stunde und trotzte dem König weitere Privilegien ab, ehe Lübecker Schiffe mit dem dringend begehrten Weizen nach Bergen segelten.
Seitdem galt Herr Johann in seiner Heimatstadt als geschickter Taktiker. Und er kann nun sein Talent auch ganz in den Dienst der Stadt stellen. Wie viele andere Fernhändler geht er nun nicht mehr selbst auf Reisen, sondern lenkt seine Geschäfte von seiner 'Schrivkamere' aus: Auf der Diele seines stattlichen Giebelhauses, bis auf die Rückwand nun ganz in Backstein aufgeführt, hatte er sich eine Dornse seitlich der eichenen Eingangstür abtrennen lassen und dort nicht nur ein Schreibpult und etliche Truhen für die vielen Dokumente hineingestellt, sondern auch einen eigenen Kachelofen für die kalten Monate.
Von hier aus dirigiert er nun seine Warenströme, teilt sich Schiffe und Ladungen mit anderen Kaufleuten, beauftragt Schiffsführer oder junge Handelsgehilfen mit den Verhandlungen in den angesteuerten Häfen, korrespondiert mit Geschäftsfreunden in manchen anderen Städten, um stets Angebote und Nachfragen genau zu kennen. So bleibt ihm die Zeit, seine Aufgaben im Rat wahrzunehmen. Und er war soeben zum Wetteherrn berufen worden, ein verantwortungsvolles und zeitraubendes Amt, muß er doch die vielen Händler auf dem Markt und die Handwerker in der Stadt überwachen, ob sie richtig maßen und abwogen, keine gefälschten Münzen nutzten, keinen Pfusch anboten und an den ihnen zugewiesenen Plätzen ihre Waren anboten. Da ist es gut, dass ihm die Büttel zur Seite standen.
Während wir hier ins Plaudern kommen, ist unser Ratsherr schon in den ersten Stock des Gewandhauses hinaufgestiegen, wo Bürgermeister Hinrich von Wittenborg, Ratsherr Arnold Schotelmund und der Stadtschreiber bereits zusammensitzen. Der Rat von Wismar hatte den Entwurf einer Urkunde geschickt, die es zu beraten gilt. Worum geht es da? Seit langem schon klagen die Händler darüber, dass Straßen und Wege immer unsicherer werden. Zwar herrscht Landfrieden, und die Landesherren sollen ihn durchsetzen, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die vielen Adligen in ihren befestigten Häusern sind in den Augen der Städte zu bloßen Wegelagerern geworden, zu Räubern und Erpressern. Gut, das mag einseitig sein, denn meist ging es ganz legal um eine Fehde, und die war keineswegs verboten.
Aber Anlaß für eine solche Kriegserklärung konnte (fast) alles sein, und sie konnte jeden treffen: Einen einzelnen Bürger oder gleich die ganze Stadt. Und war sie erst einmal erklärt, konnte der Ritter jeden Warenzug, jeden reisenden Kaufmann gleichsam als Pfand nehmen, bis seine Forderung erfüllt war. Es gelang den Fürsten nur selten, die Rückgabe von widerrechtlich einbehaltenem Gut zu erzwingen oder wenigstens für Entschädigung zu sorgen. Hier aber war nun die Stadt, also die Räte und Bürgermeister, gefragt, waren sie doch zum Schutz ihrer Bürger verpflichtet, und das nicht nur innerhalb der Mauern.
So hatten schon die beiden Städte Hamburg und Lübeck seit längerem einen Vertrag geschlossen, um die Wege, die sie verbanden, sicherer zu machen. Und nun liegt das Pergament aus Wismar auf dem Tisch. Johann studiert es genau, und er weiß wohl, was es bedeutet: Die Städte sollen sich urkundlich verpflichten, so liest er, jeden, der einen Kaufmann beraubt, für geächtet zu erklären. Im Klartext: Jeder darf dann solche Leute ohne weiteres Gerichtsverfahren, aber dennoch ohne Angst vor Strafe ins Jenseits befördern. Und wer diese Räuber schützt, ihnen Zuflucht gewährt, verfällt ebenfalls der Acht.
....................................................................................................................................
Herr Johann blickt auf und schaut die drei Männer an: „Damit nehmen wir uns ein Recht heraus, das nur dem König zusteht,“ sagt er nachdenklich. Der Bürgermeister erwidert den Blick: „Nennt mir einen Herrn, lieber Johann, ob Kaiser, Herzöge oder Grafen, die unsere Kaufleute zu schützen wissen. Es bleibt uns keine Wahl, als dieses Recht in die eigenen Hände zu nehmen.“
Und Johann von Bardewik weiß aus manch eigener Erfahrung, dass Wittenborg die Wahrheit spricht. „Ja, es ist leider wahr! Wie oft schon haben diese Buchwalds und Scharpenbergs einen Warenzug überfallen, ihn ausgeraubt und die gefangenen Kaufgesellen nur gegen hohes Lösegeld freigelassen. Und das mit höchst fadenscheinigen Vorwänden für eine Fehde.“ - „Wenn es denn überhaupt eine Fehde gab,“ mischt sich nun Herr Arnold in der Runde ein: „Vergangenes Jahr hat dieser Lorenz Scharpenberg meine Wagen in der Hahnheide überfallen, ohne je einen Fehdebrief geschickt zu haben. Das ist eindeutig Straßenraub. Und weil mein Ältester unter den Begleitern war, hat er eine gewaltige Summe für seine Freilassung verlangt. Was sollte ich tun? Ich habe zahlen müssen!“
„Ja, was soll man anderes tun?“ nimmt Herr Johann den Faden auf. „Auf die Fürsten können wir kaum zählen, ob es nun der Lüneburger Herzog oder Graf Adolf ist. Dabei sind diese Strauchritter ihre Lehnsleute. Aber hat der Herzog je einen gezwungen, die Gefangenen freizulassen? Oder uns den Schaden zu ersetzen? Nichts als schöne Worte bekommen wir von ihm zu hören.“ - „Eben darum müssen die Städte nun selber handeln,“ sagt Wittenborg und deutet auf das Pergament, um das es hier geht. „Aber werden sie auch einwilligen, diesen Vertrag besiegeln?“
Der Bürgermeister lächelt „Da bin ich sicher. So sehr unsere Kaufleute auch auf den vielen Märkten rings um die Ostsee konkurrieren mögen, hier haben alle ein gemeinsames Interesse, und das läßt sich gemeinsam am besten vertreten.“
War es so? Oder war es doch so ähnlich? Vielleicht
......................................................................................................................................
Verlassen wir das Lübecker Rathaus und die drei Herren dort für einen Augenblick des Nachdenkens. Wie könnte unser Urteil – aus der Sicht des 21. Jahrhunderts – wohl ausfallen? Jedenfalls alles andere als einhellig. Lautet es: Die Stadt(regierung) damals stellte sich schützend vor ihre Bürger? Oder sollte man eher sagen: Jetzt hat eine elitäre Schicht die Stadt endgültig zum Instrument eigener Interessen gemacht?
Könnten wir feststellen: Hier entsteht ein globales Netzwerk, um den freien Austausch von Waren (und manchmal ja auch von Ideen) zu fördern und zu sichern? Oder sollten wir entsetzt konstatieren: Hier vollzieht sich ein gnadenloser Kampf um ein Handelsmonopol, ein Preisdiktat zu Lasten der Produzenten? (Also genau das, was in unseren Tagen die großen Einzelhandelskonzerne auch praktizieren.)
Damals entstanden die ersten regionalen Städtebündnisse – die 'wendischen' mit Lübeck und die rheinisch-west-fälischen mit Köln an der Spitze, die sich dann in der großen hansischen Gemeinschaft zusammenfanden. Dabei tobte der Konkurrenzkampf der Städte untereinander um Märkte und Absatz kaum gebremst weiter. Aber es gab eben auch Dinge, die allen gemeinsam waren und nur gemeinsam durchgesetzt werden konnten: Schutz vor Wegelagerei und den lästigen Zollschranken einerseits, Ausschaltung fremder Konkurrenz andererseits. Freiheit des Handels und rigorose Kartellpolitik – nur zwei Seiten einer Medaille, auf der stets eines stand: de dudesche hense. Wenn wir die Münze werfen – was würde dann oben liegen?
Es dauert noch mehr als ein halbes Jahrhundert, bis sich 1356 auf Einladung des lübischen Rats hier in seiner Stadt Vertreter (Sendboten nannte man sie damals) all der vielen Städte zu einer ersten 'Tagfahrt' trafen, also zu einer gemeinsamen Konferenz. Die ja längst bestehende Hanse der Städte hatte ein Gesicht bekommen. Traf man sich anfangs hier und da in den Städten, so wurde bald Lübeck zum eigentlichen Tagungsort, und Lübecks Rat verschickte die Tagesordnung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.