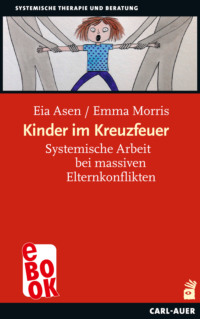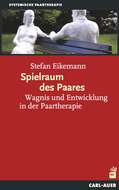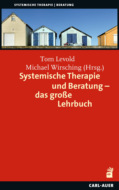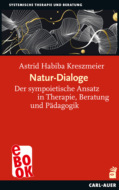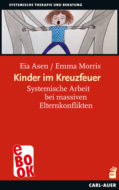Kitabı oku: «Kinder im Kreuzfeuer», sayfa 3
1.4Familienbindungen und Triangulierungsprozesse
Dem Family-Ties-Modell gemäß ist der Prozess des Hineingezogenwerdens der Kinder in anhaltende elterliche Konflikte – die »Triangulierung« – der Grund für die spezielle Art von Beziehungen, die man in Familien vorfindet, in denen nach der Trennung der Eltern starke Konflikte bestehen bleiben. Im Gegensatz zum psychoanalytischen Konzept der »frühen Triangulierung« (Abelin 1975) handelt es sich bei systemisch begründeten Triangulierungsprozessen darum, dass Kinder in die Streitigkeiten von Erwachsenen hineingezogen werden und aufgrund dessen zusammen mit einem Elternteil eine problematische Allianz gegen den anderen Elternteil entwickeln. Das ist keineswegs ein neues Konzept, denn schon Bowen (1966) beispielsweise spricht von der »pathologischen Triangulierung«: einer generationenübergreifenden Koalition, in der ein Elternteil das Kind als Vertrauensperson benutzt und den anderen Elternteil ausschließt und herabwürdigt. Das »perverse Dreieck« (Haley 1985) ist eine weitere Beschreibung des Prozesses, wie ein Elternteil sein Kind für ein verdecktes Bündnis vereinnahmt, um den anderen Elternteil zu isolieren; dadurch gerät das Kind in eine »No-win«-Situation, in der die Einwilligung in die Wünsche des einen Elternteils den Verlust der Liebe des anderen nach sich zieht. Selvini Palazzoli et al. (1992) beschreiben spezielle »Familienspiele«, denen Kinder und Jugendliche zum Opfer fallen und die schwerwiegende psychische Störungen verursachen können. Boszormenyi-Nagy und Spark (1973) verweisen auf die »unsichtbaren Loyalitäten« und die »Rollenkorruption«, die Kinder in Szenarien dieser Art erleiden und welche oft zu den von Minuchin (1977) so genannten »dysfunktionalen Machthierarchien« und »verstrickten« Eltern-Kind-Beziehungen führt. In Szenarien dieser Art befinden sich Kinder verstärkt in Gefahr, »adultifiziert«, »parentifiziert« oder »infantilisiert« zu werden (Garber 2011).

Abb. 1.1: Triangulierungsprozesse
Triangulierung beinhaltet drei unterschiedliche und einander überschneidende Distanzierungs- und Entfremdungsprozesse, die man zum Verständnis grafisch repräsentieren (siehe Abbildung 1.1) und auch therapeutisch nutzen kann, um die verschiedenen eigenen Sichtweisen jedes Elternteils und des Kindes darzustellen. Die Distanzierung eines Elternteils vom Kind ist der erste dieser Prozesse, den man mit dem Ausmaß in Verbindung bringen kann, in dem der eine Elternteil die laufende Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil unterstützt. Eltern, die trotz ihrer Wut oder Aufgebrachtheit dem früheren Partner gegenüber die Beziehung ihres Kindes zum anderen Elternteil bedingungslos unterstützen, sind am einen Ende eines Spektrums zu positionieren, auf dem sich auch die indirekte und unbeabsichtigte Unterminierung dieser Beziehung verorten lässt und an dessen entgegengesetztem Ende die absichtliche, permanente und konsistente Unterminierung der Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil und dessen Herabwürdigung zu lokalisieren ist. Ein zweiter Faktor, der zur Triangulierung beiträgt, ist das Ausmaß, in dem das Kind dem elterlichen Konflikt ausgesetzt ist und in ihn einbezogen wird. Am einen Ende des Spektrums kann das Kind völlig von den Konflikten seiner Eltern abgeschirmt sein, während es am anderen Ende des Spektrums permanent den feindseligsten Interaktionen seiner Eltern ausgesetzt ist und oft direkt in ihre Dispute verwickelt wird.
Ein dritter Triangulierungsfaktor, der zu Distanzierungs- und Entfremdungsprozessen beiträgt, betrifft die tatsächliche physische und emotionale Nähe zwischen Kind und Eltern. Am einen Ende des Spektrums liegt eine sehr nahe und abhängige Beziehung zwischen Kind und Eltern, am anderen Ende befindet sich die völlige Unabhängigkeit des Kindes von den Eltern. Welche Position in diesem Spektrum für die Beziehung eines Kindes zu einem Elternteil optimal ist, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise vom realen Alter, vom Entwicklungsstadium, von den geltenden gesellschaftlichen Normen sowie von den situativen, sozialen und kulturellen Umständen, unter denen die Familie lebt. Wird ein Kind von seinen Eltern in eine Triangulierung hineingezogen, ist seine Nähe zu dem Elternteil, bei dem es lebt, oft größer und die zum anderen Elternteil geringer, als es für eine gesunde psychosoziale Entwicklung optimal wäre.
Ist ein Kind tatsächlich von einem Elternteil erheblich misshandelt oder vernachlässigt worden, macht das eine gewisse physische oder emotionale Distanzierung von diesem Elternteil nicht nur verständlich, sondern liegt gewöhnlich auch im wohlverstandenen Interesse des Kindes – insbesondere wenn weiterhin die reale Gefahr der erneuten emotionalen oder physischen Schädigung des Kindes besteht. Diese Dynamik unterscheidet sich von der als »Triangulierung« bezeichneten Verstrickung in die elterlichen Konflikte, weil wir von »Triangulierungsprozessen« nur sprechen, wenn sich ein Kind von einem Elternteil emotional und/oder physisch distanziert, da die Beziehung durch den anderen Elternteil unterminiert wird und/oder da das Kind dem Konflikt zwischen den Eltern ausgesetzt ist – es also nicht um einen Schaden geht, den das Kind in der Obhut des distanzierteren Elternteils erlebt hat.
Die entstehenden Dynamiken und Prozesse lassen sich vielleicht am besten erörtern und entflechten, wenn man die Sichtweisen und Haltungen aller an dem Dreieck Beteiligten zu verstehen versucht: die des Elternteils, mit dem das Kind die meiste Zeit verbringt (den wir von nun an den »näheren Elternteil« nennen werden); die des Elternteils, bei dem das Kind weniger oder keine Zeit verbringt (den wir von nun an als den »distanzierteren Elternteil« bezeichnen werden); und die des betroffenen Kindes.
1.5Die Konzepte des näheren und distanzierteren Elternteils
Der nähere Elternteil kann zu den Triangulierungsprozessen beispielsweise beitragen, indem er sich kritisch bzw. übermäßig kritisch dazu äußert, wie der distanziertere Elternteil das Kind behandelt oder behandelt hat. Dies kann zur Folge haben, dass der dem Kind nähere Elternteil aufrichtig und ohne jede böse Absicht glaubt, die Beziehung zwischen dem Kind und dem distanzierteren Elternteil müsse eingeschränkt oder völlig unterbunden werden, um das Kind vor inadäquater oder gar schädlicher elterlicher Betreuung zu bewahren. Solche Sorgen können verstärkt werden, wenn es Eltern schwerfällt, ihre eigenen Gedanken und Gefühlszustände (beispielsweise Wut oder Angst) von denjenigen ihres Kindes zu unterscheiden. In Ermangelung dieser Fähigkeit kann der betreffende Elternteil es als sehr schwierig empfinden, die Beziehung des Kindes zum Expartner zu unterstützen, was die Distanz zwischen dem Kind und dem anderen Elternteil noch vergrößert. Eine weitere Dynamik, die zum Triangulierungsprozess beitragen kann, besteht darin, dass sich der nähere Elternteil immer stärker auf die emotionale Unterstützung und Gesellschaft des Kindes verlässt – wodurch das Kind in die »Sache« des näheren Elternteils hineingezogen wird und dessen negativen Gefühlen dem früheren Partner gegenüber ausgesetzt ist. So wird das Kind indirekt mit dem elterlichen Konflikt konfrontiert: Es sieht die Wirkung dieses Konflikts auf den ihm näheren Elternteil und distanziert sich aus Loyalität und um seine Beziehung zu schützen weiter von dem anderen Elternteil.
Manche Eltern äußern sich zwar nicht negativ über den Expartner, doch aufgrund ihrer eigenen negativen und belastenden Gefühle oder aufgrund ihrer Wut ihm gegenüber fällt es ihnen leichter, gar nicht über ihn zu sprechen. Es kann ihnen auch widerstreben, sich mit Fotos oder Gegenständen, die an den Abwesenden erinnern, zu befassen. Dies ist der Beziehung des Kindes zum distanzierteren Elternteil eher abträglich, weil es ihm die Reaktivierung positiver Erinnerungen erschwert und zudem die physische und emotionale Distanz zwischen ihm und dem anderen Elternteil vergrößert. In extremeren Fällen kommt es vor, dass sich der dem Kind nähere Elternteil gekränkt fühlt und es deshalb für gerechtfertigt hält, direkt und wiederholt die Beziehung des Kindes zum Expartner zu unterminieren. Der nähere Elternteil kann das Kind auch direkt in den weiterhin akuten elterlichen Konflikt hineinziehen, beispielsweise indem er an wirkliche oder angebliche Vorfälle häuslicher Gewalt erinnert, für die er den distanzierteren Elternteil verantwortlich macht. Manchmal statten Eltern ihre Kinder für den Umgangskontakt mit dem distanzierten Elternteil sogar mit verborgenen Aufnahmegeräten aus, um »Beweise« für dessen Elternunfähigkeit zu liefern. Kinder können auch instruiert oder »gecoacht« werden, selbst Anschuldigungen gegen den anderen Elternteil vorzubringen. Auch Mitglieder des engeren Kreises der Ursprungsfamilie eines Elternteils und loyale Freunde können zu Triangulierungsprozessen beitragen, indem sie durch parteiische Äußerungen negative Informationen verstärken.
Der distanziertere Elternteil kann durch seine Reaktion auf das Gefühl, vom näherstehenden Elternteil und von dessen Netzwerk kritisiert zu werden, den Triangulierungsprozess verstärken. Dies kann zur Folge haben, dass er sich niedergeschlagen fühlt und sich aus der Beziehung zum Kind zurückzieht, das dann mit Wut oder mit Schuldgefühlen und Ablehnung reagiert. Der distanziertere Elternteil kann aber auch selbst mit Kritik und Feindseligkeit reagieren, ohne das Kind von diesen starken negativen Gefühlen gegenüber dem näherstehenden Elternteil und anderen Mitgliedern von dessen Ursprungsfamilie abzuschirmen, und das Kind dadurch indirekt seinem eigenen Konflikt mit dem Expartner aussetzen. Die Folge kann sein, dass sich das Kind noch stärker vom distanzierteren Elternteil abwendet, und sei es nur, um seine eigene positive Sicht auf den ihm näheren Elternteil aufrechterhalten zu können.
Eine weitere Dynamik, die zu Triangulierungsprozessen beitragen kann, sind die oft aggressiven oder deprimierten Reaktionen des distanzierteren Elternteils auf den offensichtlichen Rückzug des Kindes aus der Beziehung zu ihm. Dies wiederum kann beim Kind schmerzhafte Gefühle hervorrufen, wie Angst vor oder Enttäuschung über augenscheinliche Missbilligung und Abfuhr, auch Schuldgefühle, die Kinder oft herunterzuspielen oder zu vermeiden versuchen, indem sie sich noch stärker vom betroffenen Elternteil distanzieren. Manchmal streitet der distanziertere Elternteil ab, dass er seine elterlichen Aufgaben schlecht oder nachlässig erfülle, oder er leugnet tatsächlich begangene körperliche Misshandlungen oder andere inadäquate oder schädliche Verhaltensweisen dem Kind gegenüber. Ist dokumentiert und belegt, dass solche Vorfälle vorgekommen sind, entwertet deren Leugnung die vorangegangene Darstellung des Kindes, was die bereits bestehende Distanzierung wahrscheinlich erneut verstärkt. Werden die Fakten, die das Verhalten des distanzierteren Elternteils betreffen, bestritten, bringt weiteres Abstreiten das Kind in die schwierige Lage, zwischen zwei möglichen »Wahrheiten« wählen und somit entscheiden zu müssen, welcher Elternteil »richtig-« und welcher »falschliegt«.
Das betroffene Kind kann einen Elternteil aus vielen Gründen bevorzugen und nach der Trennung der Eltern abgeneigt oder widerwillig sein, den Kontakt zu dem distanzierteren Elternteil aufrechtzuerhalten. Kinder nehmen die Ängste des ihnen näher stehenden Elternteils angesichts eines bevorstehenden Umgangskontakts mit dem distanzierteren Elternteil wahr und entwickeln so selbst von Angst getriebene Reaktionen. Manchmal entsteht bei ihnen sogar eine irrationale Furcht oder Aversion dem ihnen ferneren Elternteil gegenüber, die an eine phobische Reaktion erinnert. Dies kann einander verstärkende Zyklen von Angst, Panik und Vermeidungsverhalten hervorrufen, wenn der dem Kind nähere Elternteil auf dessen Angst und Aufgebrachtheit reagiert, indem er sich noch schützender und gereizter verhält. Der nähere Elternteil ist somit nicht in der Lage, das Kind zu beruhigen oder ihm zu helfen, seine Angst zu überwinden und adäquate Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Es registriert die Voreingenommenheiten und Reaktionen des ihm näheren Elternteils, womit sein Gefühl verstärkt wird, bei dem distanzierteren Elternteil »nicht sicher« zu sein. Das vermeidende Verhalten des Kindes wird dann leicht zu einer fest verwurzelten und erlernten Reaktion (Fidler et al. 2013; Judge a. Deutsch 2017).
Weitere Gründe, warum Kinder ihre Beziehung zu einem Elternteil einschränken oder völlig unterbinden wollen, können frühere unbefriedigende oder üble Erlebnisse unter der Obhut des betreffenden Elternteils sein; es kann sich auch um Erinnerungen an Erlebnisse handeln, die die psychische Gesundheit eines Elternteils oder dessen Substanzmissbrauch betreffen und die im Geist des Kindes eine übertriebene Bedeutung erlangen, wenn der ihm nähere Elternteil seine Beziehung zum distanzierteren Elternteil nicht unterstützt oder sogar aktiv behindert. Kinder, die einem elterlichen Konflikt ausgesetzt waren und sich daran erinnern, dass der distanziertere Elternteil den ihnen näheren schlecht behandelt hat, weisen den distanzierteren Elternteil manchmal aus Loyalität dem ihnen näheren Elternteil gegenüber zurück oder versuchen, auf diese Weise die Beziehung zu letzterem zu schützen. Gelegentlich werden Kinder den verbalen Beschreibungen angeblich inakzeptablen Verhaltens des distanzierteren Elternteils ausgesetzt, obwohl die Darstellungen nicht den Tatsachen entsprechen, übertrieben oder verzerrt sind, aber sie glauben, dass die Schilderungen zutreffen, weil ihnen keine Beweise für das Gegenteil bekannt sind und weil die Darstellungen weiterhin zur Rechtfertigung der Distanzierung benutzt werden.
Und schließlich können Kinder sich auch aus eigenem Antrieb von einem Elternteil distanzieren, um schmerzhafte Gefühle von Angst, Schuld oder Verlust zu verringern, die sie infolge von Zurückweisung erleben oder weil sie mit widersprüchlichen Darstellungen beider Eltern über Geschehnisse aus der gemeinsamen Zeit der Familie fertigwerden müssen. Auch Druck von Geschwistern kann erschwerend wirken, wenn ein Kind mit einem Elternteil besser auskommt als etwa sein Bruder oder seine Schwester. Es kommt zum Beispiel vor, dass ein Kind von einem Elternteil favorisiert wurde – vielleicht auch nur nicht vernachlässigt oder nicht misshandelt wurde –, wohingegen sein Bruder oder seine Schwester schlecht behandelt worden ist. Wenn Kinder von einem Elternteil körperlich misshandelt oder emotional oder sexuell missbraucht worden sind, ist es oftmals mehr als verständlich, dass sie sich von dem Elternteil, bei dem sie sich nicht sicher fühlen, distanzieren. Natürlich verlassen sie sich dann stärker auf den anderen Elternteil und suchen auch eher den Kontakt zu ihm.
Die Interaktionen zwischen hochstrittigen Eltern entsprechen in der Regel einem der drei folgenden Muster:
•dem des gegenseitigen Beschuldigens
•dem des Beschuldigens und Blockierens, wobei ein Elternteil den anderen beschuldigt, der sich daraufhin zurückzieht und jede weitere Kommunikation unmöglich macht
•dem des Blockierens, wobei sich beide Eltern zurückziehen und jede Kommunikation verweigern.
Dadurch fällt dem Kind die wenig beneidenswerte Rolle zu, den Raum zwischen den Eltern ausfüllen zu müssen und als Vermittler, Bote und Faktotum zu fungieren (van Lawick 2016). Im Raum zwischen streitenden Eltern leiden Kinder am stärksten, und dieses Leiden wird unmittelbar vor dem Wechsel, während des Wechsels und nach dem Wechsel von einem Elternteil zum anderen akut.
2Verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/484867/umfrage/anzahl-minderjaehrige-scheidungskinder-in-deutschland/ [6.5.2021]
2Konzeptueller Rahmen und Forschungsstand
Das Hauptziel von Family Ties ist es, Kinder aus ihrer Verstrickung in elterliche Beziehungskonflikte zu befreien und, sofern dies als ratsam erscheint, den distanzierteren Elternteil dem Kind näherzubringen, damit das Kind eine »hinreichend gute« (Winnicott 1965) Beziehung zu beiden Eltern unterhalten kann. Dies kann die Wiederherstellung des indirekten und direkten Umgangskontakts zu einem Elternteil beinhalten, den ein Kind seit Monaten oder sogar Jahren nicht gesehen hat. Darüber hinaus zielen die therapeutischen Interventionen darauf, dauerhafte Beziehungen zu beiden Eltern herzustellen und das Kind aus den elterlichen Konflikten herauszuhalten, was hauptsächlich erreicht wird, indem man beide Eltern dazu bringt, sich intensiver an der Betreuung des Kindes zu beteiligen. Unabhängig von jedweden darüber hinausgehenden Fortschritten ist es in komplexen Fällen oft so, dass allein eine erneute und positive Begegnung mit dem distanzierteren Elternteil dem Kind hilft, verzerrte negative Erinnerungen und Repräsentationen zu überprüfen und vielleicht sogar zu korrigieren; das kann zu einer besseren Integration der Aspekte, die das Kind mit dem betreffenden Elternteil assoziiert, beitragen und sich so positiv auf das entstehende »Selbst« auswirken. Außerdem hilft dies Kindern, mit Schuldgefühlen fertigzuwerden, die sie wegen ihrer Ablehnung eines Elternteils haben, und sie gegebenenfalls aufzulösen; es hilft ihnen auch, Gefühle zu verarbeiten, die sie haben, weil sie vom distanzierteren Elternteil im Stich gelassen worden zu sein glauben oder tatsächlich gelassen worden sind.
Im Laufe der Jahre wurden einige therapeutische Ansätze entwickelt, die dazu dienen, die Situation von Kindern zu verbessern, die unter Entfremdungs- und Triangulierungsprozessen leiden (Gardner 2001; Everett 2006; Lowenstein 2006; Major 2006; Lebow a. Rekart 2007; DeJong a. Davies 2012; Gottlieb 2012; Baker a. Sauber 2013; Fidler et al. 2013; Woodall a. Woodall 2017; Hertzmann et al. 2016; Hertzmann et al. 2017). Sie umfassen viele nützliche Konzepte und Interventionstechniken, die Lebow (2003) unter der Bezeichnung »multi-level systemic therapy« zusammengefasst hat. Der zusätzliche auf das Mentalisieren gerichtete Fokus – also das zentrale Interesse an den eigenen mentalen Zuständen und denen von anderen – unterscheidet den Family-Ties-Ansatz von anderen Modellen der Arbeit mit hochstrittigen Eltern und ihren triangulierten Kindern.
Family Ties wurde in den ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts in London von einem multidisziplinären Team entwickelt, zunächst im Rahmen des National Health Service und dann im Anna Freud National Centre for Children and Families. Der Ansatz verbindet systemische und mentalisierungsbasierte Konzepte und nutzt außerdem kognitive, behaviorale und psychoedukative Verständnisrahmen und Interventionen.
2.1Systemische Aspekte
Der Family-Ties-Ansatz versteht die Familie als System innerhalb eines umfassenderen Systems: der unmittelbaren und der erweiterten Familie in ihren sozialen und kulturellen Settings (Ackerman 1967; Bowen 1978). Man kann die Familie selbst als System mit unterschiedlichen Teilen – den Familienmitgliedern – verstehen, deren Verhalten sich an einer Anzahl expliziter und impliziter Regeln orientiert, die im Laufe der Zeit und manchmal über Generationen hinweg entstanden sind und die Beziehungen und Kommunikationsweisen der Mitglieder des Systems prägen (Watzlawick et al. 1969). Diese Regeln können für die Probleme in zerrütteten Familien ausschlaggebend sein, insofern sie zu ihrer Entstehung beitragen können, was die Verbitterung beider Parteien und nachteilige Auswirkungen auf Emotionen und Verhalten der Kinder zur Folge haben kann. Bei der Begutachtung und bei der therapeutischen Arbeit können die in betroffenen Familien gültigen Regeln und Muster entdeckt und enthüllt, hinterfragt und schließlich so modifiziert werden, dass zwischen den Familienmitgliedern neuartige Interaktionen möglich werden. Im Sinne des systemischen Ansatzes stehen außerdem die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und innerhalb des umfassenderen Systems auf dem Prüfstand, was, abgesehen vom sozialen Netzwerk der Eltern, auch das Netzwerk professioneller Helfer einschließen kann, das sich um die elterliche Beziehung gebildet hat, sowie das Rechtssystem, das im Laufe der Zeit einbezogen wurde und das bei den Konflikten eine wichtige Rolle spielt.
Die Arbeit strukturell und strategisch orientierter Familientherapeuten (Haley 1985; Minuchin 1977) und ihr Interesse an dem, was sie als »dysfunktionale« Hierarchien zwischen den Generationen oder als inadäquate Grenzen zwischen Eltern und ihren Kindern bezeichneten, ist bei der Beurteilung von Familien, in denen massive Streitigkeiten dominieren, von besonderer Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Einfluss auf den Family-Ties-Ansatz ist die Wirkung des Verhaltens und der Überzeugungen von Familienmitgliedern auf die übrigen Familienangehörigen, was mithilfe von zirkulärem und reflektierendem Fragen untersucht wird (Selvini Palazzoli et al. 1981; Cecchin 1987). Auch narrative Ansätze haben unser Arbeitsmodell inspiriert (White u. Epston 2009), insofern sie sich damit beschäftigen, wie kindliche Erlebnisse von anderen Menschen und insbesondere von den Eltern zu einer »Geschichte« verarbeitet werden. Solche Geschichten oder »Geschichtchen« stimmen mit der Realitätswahrnehmung der betreffenden Kinder möglicherweise ganz und gar nicht überein – beispielsweise kann ihre reale Wahrnehmung eines distanzierteren Elternteils dem dominierenden Narrativ widersprechen (White a. Epston 1990) und deshalb als problematisch erlebt werden.