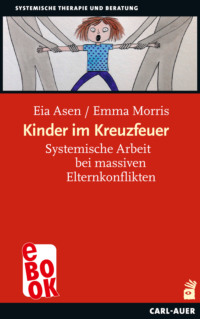Kitabı oku: «Kinder im Kreuzfeuer», sayfa 4
2.2Die Bindungstheorie
Ein weiterer für den Family-Ties-Ansatz wichtiger theoretischer Rahmen ist die von John Bowlby (1953) entwickelte Bindungstheorie. Bowlby postuliert die Existenz eines universellen menschlichen Bedürfnisses nach der Entwicklung enger affektiver Bindungen. Bindung kann als biologisches und evolutionsrelevantes System verstanden werden, das uns vor Raubtieren und anderen Gefahren zu schützen sucht. Es handelt sich um ein offenes biopsychosoziales homöostatisches System, welches das emotionale Erleben und die physiologische Erregung beeinflusst. Wollte man dem Bindungssystem ein Ziel zuschreiben oder würde man glauben, es sei für einen bestimmten Zweck geschaffen worden, so wäre es das Gefühl der Sicherheit. Mit der Fähigkeit, unsere emotionalen Reaktionen zu steuern, werden wir nicht geboren, sondern sie entwickelt sich aufgrund des regulierenden Systems, das beinhaltet, dass die primäre Bezugsperson die Signale des Säuglings, welche die inneren Zustände des Kindes zum Ausdruck bringen, versteht und darauf reagiert. Auf diese Weise lernt das Kind, dass die Bezugsperson beeinflussen kann, wie es sich fühlt. Befindet sich ein Säugling in einem Zustand starker, anscheinend oder scheinbar unkontrollierbarer Erregung – etwa weil er sich fürchtet –, verhält er sich so, dass physische Nähe zur primären Bezugsperson hergestellt wird, damit sie ihn schützt und beruhigt. Wie und wann Bindungsverhalten initiiert wird, hängt stark von der Beurteilung einer Anzahl von Umgebungssignalen ab und davon, ob diese Signale Gefühle der Sicherheit oder Unsicherheit bzw. der Sicherheit oder Furcht auslösen.
Der Bindungstheorie gemäß werden Säuglinge mit einem Repertoire an Verhaltensweisen geboren, die sie benutzen, um die Aufmerksamkeit ihrer primären Bezugspersonen auf sich zu lenken und Nähe herzustellen, wenn sie sie zu brauchen glauben. Sie erreichen das beispielsweise durch Weinen oder Anklammern oder durch Lächeln und liebevolle Empfindungen weckende stimmliche Äußerungen. Auf solche Bemühungen der Bindungssuche gehen die primären Bezugspersonen in der Regel ein – indem sie beispielsweise das Baby halten, berühren oder beruhigen –, und diese Reaktionen stärken das Bindungsverhalten des Kindes den primären Bezugspersonen gegenüber. Begriffe wie »Affekteinstimmung« oder »empathische Responsivität« beschreiben einen Prozess des Austauschs, der zwischen Kindern und ihren primären Bezugspersonen stattfindet. Sie meinen die Fähigkeit, den Affekt eines Kindes wahrzunehmen und gemäß dem Verhalten und dem diesem wiederum zugrunde liegenden Affekt zu reagieren – was bewirkt, dass das Kind die entsprechenden Verhaltensweisen der Bezugspersonen als Reaktion auf den eigenen Affektzustand wahrnimmt (Stern 1998). Das Eingehen der Bezugspersonen auf die Bedürfnisse erzeugt beim Säugling ein Gefühl der Sicherheit, das ihm in seiner weiteren Entwicklung zugutekommt.
Nach Bowlby (1969) war die primäre Bindungsfigur für einen Säugling in der Regel die Mutter, und infolge dieser Einschätzung blieb die Mutter-Säugling-Einheit einige Jahrzehnte lang der Fokus der Forschung und Theorie, wodurch andere wichtige Familienmitglieder, insbesondere Väter, aber auch Geschwister und Großeltern, meist ausgeschlossen blieben. Seither wurde das Bindungsparadigma erweitert, sodass es nun auch die Väter und andere Betreuer im Netzwerk des Kindes einschließt. Allerdings besteht weiterhin die Tendenz, sich hauptsächlich auf die Mutter-Kind-Dyade zu konzentrieren. Gorell Barnes (2017) weist darauf hin, dass die Bindungstheorie, statt die Deprivation eines Kindes hauptsächlich auf die Abwesenheit der Mutter zu beziehen, im Sinne der »Systeme von zuverlässigen Beziehungen«, die einem Säugling oder Kind zur Verfügung stehen, umgestaltet werden müsste, und den Schaden für die normale Entwicklung, wenn diese Beziehungen zusammenbrechen, berücksichtigen müsste. Tatsächlich gehen Familien in verschiedenen Kulturen mit den Bedürfnissen eines Kindes sehr unterschiedlich um. So übernehmen in manchen Kulturen mehrere wichtige Personen aus dem Umfeld eines Kindes die Betreuung gemeinsam, statt sie ausschließlich einer einzigen Person zu überlassen, wie es in dem afrikanischen Sprichwort »Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen« zum Ausdruck kommt. Wie Menschen sich umeinander kümmern und wie sie miteinander verbunden sind, unterliegt dem Einfluss kulturell geprägter Praktiken – und ist in sie eingebettet –, und die Kindererziehung und damit zusammenhängende Interaktionen werden im kulturellen Kontext der betreffenden Familie geformt. Dominierende Narrative beispielsweise bezüglich der Geschlechterrollen müssen in jedem Fall entschlüsselt werden, wenn wir verstehen wollen, wer für ein Kind was tut, um seine Bindungsbedürfnisse zu befriedigen. Im Übrigen haben sich Muster elterlicher Betreuung im Laufe der Zeit verändert, und neue sind aufgetaucht, beispielsweise in Form der Zunahme gleichgeschlechtlicher Paarbeziehungen. Insofern kann jeder Mensch, der im Leben eines Kindes eine signifikante, verlässliche, konstante und etablierte Rolle spielt, eine primäre Bezugsperson sein, sofern er Bindungsbedürfnisse eines Kindes erfüllt.
2.3Innere Modelle
Im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit spiegelt sich die Organisation des Bindungssystems eines Menschen in seinem Verhalten. Die Art von Betreuung, die ein Kind erhält, wirkt sich auf die Herausbildung kognitiver Strukturen, die die Beziehungen betreffen, aus. Das Kind verinnerlicht im Laufe der Zeit sein Erleben der Ansprechbarkeit und Sensibilität seiner primären Bezugsperson in Form von »inneren Modellen«: einer Anzahl unbewusster Überzeugungen und Erwartungen, die die Beziehungen betreffen und die in Stresssituationen aktiviert werden und Aufmerksamkeit, Kognition und Verhalten beeinflussen (Bretherton 1987). Wiederholte Erlebnisse mit primären Bezugspersonen werden im Laufe der Zeit im Repräsentationssystem der inneren Modelle registriert – und fungieren dann als Prototypen für das Verhalten in späteren Beziehungen. Beispielsweise ermöglichen positive Erlebnisse von Trost einem Menschen im aufgebrachten oder verängstigten Zustand, andere Menschen um Hilfe zu bitten, wenn er sie braucht.
Mary Ainsworth (Ainsworth et al. 1978) entwickelte Verfahren zur Beobachtung innerer Modelle in Aktion. Sie demonstrierte, dass kleine Kinder, wenn sie in einer ihnen nicht vertrauten Situation (der sogenannten fremden Situation) von ihren Bezugspersonen getrennt wurden – und sei es auch nur kurz –, deutlich andere Verhaltensmuster zeigten als normalerweise. Dieses Verhalten wurde als entweder »sicher« (in Reaktion auf eine in der Regel zuverlässige und gut eingestimmte Bezugsperson) oder »unsicher« klassifiziert; Letzteres kann dann weiterhin entweder als ängstlich/vermeidend (in Reaktion auf eine generell emotional oder physisch nicht erreichbare Bezugsperson) oder als ängstlich/widerständig (in Reaktion auf unzuverlässige Betreuung) klassifiziert werden. Diese Muster werden in der Fachliteratur ausgiebig beschrieben (siehe z. B. Solomon a. George 2008), und das Modell wurde später weiterentwickelt und um die Kategorie einer »desorganisierten/desorientierten« Bindung ergänzt (Main et al. 1985). Letztgenannter Zustand soll in verängstigten/beängstigenden Betreuungssituationen entstehen oder infolge von Traumata, und es wird angenommen, dass als »desorganisiert« klassifizierte Kinder später im Leben kontrollsüchtig werden und somit »organisiert« auftreten. George et al. (1999) vertreten die Auffassung, dass die Präsenz kontrollierender Verhaltensweisen bei Kindern mit desorganisierter Bindung eine unbewusste Strategie sein könnte, die darauf zielt, das separierte »Material« (Ereignisse und Erlebnisse) vom Bewusstsein fernzuhalten und zu verhindern, dass das Kind emotional überflutet wird und die Kontrolle über sein Verhalten verliert.
2.4Elterliche Verbitterung und die Veränderung von Bindungsrepräsentationen
Kinder haben häufig vor der Entstehung von Gefühlen der Verbitterung zwischen ihren Eltern eine gute und sichere Bindung zu ihrem Vater und ihrer Mutter entwickelt. Ihr Bindungsverhalten kann sich jedoch in Reaktion auf einen starken und lange anhaltenden elterlichen Konflikt verändern, weil sie versuchen, sich die elterliche Zuwendung zu erhalten. Das liegt an ihrem biologisch basierten Antrieb, die Beziehung zu ihren primären Bezugspersonen nicht zu gefährden – ein überlebenssichernder Mechanismus, der auch bei Primaten beobachtet wurde (Bowlby 1953; Harlow 1960). Sind Kinder jedoch elterlichen Konflikten ausgesetzt, können sie zu der Auffassung gelangen, dass es nicht wünschenswert oder vielleicht sogar gefährlich ist, beiden Eltern Liebe zu zeigen, also auch dem Elternteil gegenüber, bei dem sie nicht leben, weil ihnen das wie ein Verrat an dem ihnen näheren Elternteil vorkommt. Kinder in solchen Situationen lernen möglicherweise auch, dass der ihnen nähere Elternteil loyales Verhalten mit Zuneigung, Aufmerksamkeit und sogar Geschenken belohnt, wohingegen er scheinbar illoyales Verhalten durch Gereiztheit, strafende Blicke und gar Drohungen, sie zu verlassen, sanktioniert – ein Risiko, das ein Kind normalerweise nicht eingehen kann, wenn es ohnehin schon einen liebenden und geliebten Elternteil verloren hat (Fidler a. Bala 2010). In solchen Szenarien entwickeln Kinder leicht eine »Spaltung« in ihren Bindungsrepräsentationen der beiden Eltern: Sie beschreiben ihre Beziehung zu dem ihnen näheren Elternteil dann stark idealisiert und tun negative Erlebnisse als unwichtig ab. Oft sagen sie, der ihnen nähere Elternteil sei »immer liebevoll und fürsorglich« oder »niemals bösartig«, wobei es ihnen manchmal schwerfällt, solche positiven Äußerungen anhand konkreter Beispiele zu belegen. Die Beziehung zum distanzierteren Elternteil hingegen beschreiben sie oft abwertend, beispielsweise in Form von Aussagen wie »Er hat sich eigentlich nie richtig um mich gekümmert« oder »Er ist ein entsetzlicher Mann und war mir gegenüber immer gemein«. Oft fixieren sich Kinder auf ganz bestimmte, banal wirkende negative Ereignisse, die nach ihrer Überzeugung in Gegenwart des distanzierteren Elternteils vorgekommen sind und die zu erklären scheinen, weshalb sie diesen Elternteil ablehnen.
Insofern wird das Bindungsverhalten eines Kindes in Szenarien dieser Art häufig als dem ihm näheren Elternteil gegenüber »unsicherabweisend/vermeidend« und als dem distanzierteren Elternteil gegenüber »unsicher-geistesabwesend/ambivalent« kategorisiert, wobei in besonders schweren Fällen »Merkmale von Desorganisation« erkannt werden. Solche dichotomen Repräsentationen scheinen interdependent zu sein, da das Kind die Betreuung des ihm näheren Elternteils durch Idealisierung zu schützen versucht, ebenso dadurch, dass es eventuell vorhandene negative Gefühle wie Wut und Frustration, die dem ihm näheren Elternteil gelten, abspaltet und auf den distanzierteren Elternteil projiziert. Klein (1946) nennt dieses Phänomen »Abspaltung« und bezeichnet so einen unbewussten Prozess, der dem Schutz der primären Bindungsbeziehung(en) dient, indem er das Kind von Empfindungen wie Ambivalenz, Konflikt und Schuld abschirmt. Welche Bedeutung dieser Abwehrmechanismus im Einzelfall hat, hängt von Art und Stärke der Triangulierungsprozesse ab. Das unbewusste Bedürfnis eines Kindes, solch einen Abwehrmechanismus zu nutzen, könnte abnehmen, wenn seine Bindungsbedürfnisse nicht nur durch einen Elternteil, sondern durch ein System verlässlicher Beziehungen erfüllt werden; dies ist besonders wichtig, wenn die erweiterte Familie und der Freundeskreis nicht eng mit dem näheren Elternteil verbunden sind. Der Abwehrmechanismus der Abspaltung erklärt zumindest teilweise den oft erstaunlichen Mangel an Ambivalenz oder Empathie angesichts des Verlustes der Beziehung zum anderen Elternteil und zu Mitgliedern der erweiterten Familie; problematische Gefühle und Gedanken, die diesen Verlust betreffen, werden abgespalten und nach außen projiziert, jedoch nicht – und das ist wichtig – aufgelöst.
Wenn nur wenig oder kein Kontakt zum distanzierteren Elternteil besteht, können dessen Repräsentationen beim Kind im Laufe der Zeit immer stärker verzerrt werden. Es hat dann oft das Gefühl, dass eine wichtige Bindungsfigur nicht erreichbar ist und es sich nicht auf sie verlassen kann. Außerdem kann keine »Realitätsprüfung« bezüglich dessen stattfinden, ob die bei ihm entstandenen negativen Überzeugungen (noch) gerechtfertigt sind. Extreme Beispiele für diese Situation schließen ein, dass das Kind beim bloßen Erwähnen des Namens des distanzierteren Elternteils, beim Anblick eines Fotos von ihm oder bei Erwähnung eines indirekten oder direkten Kontaktes mit ihm akut phobisch reagiert. Allem Anschein nach phobische Reaktionen dieser Art rufen häufig verstärktes Fürsorgeverhalten des dem Kind näheren Elternteils hervor, der so reagiert, als müsse er das Kind vor dem distanzierteren Elternteil schützen. Das Kind bekümmert zu sehen kann auch als »Beweis« dafür dienen, dass es unter dem Einfluss des distanzierteren Elternteils leidet, und kann den ihm näheren Elternteil dazu bringen, seine Bemühungen, das Kind dem Einfluss des distanzierteren Elternteils zu entziehen, zu verstärken. Den extremen Endpunkt des Abspaltungsprozesses bildet der Versuch des Kindes, die Existenz des distanzierteren Elternteils völlig zu leugnen und buchstäblich alle Erinnerungen an ihn zu »tilgen«.
2.5Widerstreitende Narrative und Bindungsverhalten
Ein Merkmal getrennter Familien, in denen weiterhin starke Konflikte schwelen, ist gewöhnlich die Existenz einer Anzahl unterschiedlicher Narrative über die Familiengeschichte und bestimmte frühere Ereignisse, die nebeneinanderbestehen. Dies gilt vor allem für die Entstehungsgeschichte der elterlichen Beziehung und für ihre Auflösung. Diese Entwicklung kann für ein Kind grundsätzlich rätselhaft sein, aber wenn das Narrativ ausschließlich von dem einem Kind näheren Elternteil stammt und andere Sichtweisen und divergierende Fakten ausgeklammert werden, verstärkt das die Verwirrung des Kindes noch zusätzlich. Sind einem Kind nur negative Erzählungen über ihren distanzierteren Elternteil bekannt – etwa dass dieser sie nie geliebt und sie verlassen hat –, glauben sie diese Darstellung schließlich – auch wenn vieles auf das Gegenteil hinweist oder hingewiesen hat. Hat es trotzdem irgendwelche positiven Gefühle für und Erinnerungen an den distanzierteren Elternteil, kann es sie nur geheim halten, um den ihm näheren Elternteil nicht zu belasten. Defensives Abspalten und Geheimhalten können beim Kind die Identitätsbildung stark beeinträchtigen, und es kann auch zur Entstehung starker psychischer Probleme kommen. Die fortgesetzte Nutzung dieser unbewussten Defensivstrategie hindert ein Kind daran, Erlebtes generell und insbesondere in Beziehung zu beiden Eltern zu integrieren. Solche Schwierigkeiten werden manchmal erst in der Adoleszenz erkennbar, wenn der junge Mensch mit der Notwendigkeit der Selbstintegration konfrontiert wird, weil er dann nicht mehr ohne Weiteres verschiedene Erlebensbereiche voneinander abtrennen kann. Wenn Kinder und insbesondere Jugendliche versuchen, einen Elternteil aus ihrem Leben auszuklammern, zerstören und verleugnen sie damit auch die Eigenarten und Persönlichkeitsmerkmale, die sie von diesem Elternteil geerbt haben. Halten Kinder an der Sicht fest, dass es über einen Elternteil nichts Gutes zu sagen gibt, so kann das zur Folge haben, dass sie versuchen, sich von den ihnen scheinbar »wesensfremden« Anteilen des abgelehnten oder dämonisierten Elternteils, die sie in sich selbst erkennen, zu trennen. In extremen Fällen nimmt das die Form einer Selbstschädigung an, wobei sie die unerwünschten und manchmal sogar verachteten Aspekte, die zu einem Teil ihres »Selbst« geworden sind, beispielsweise (mit Rasierklingen oder Messern) »herausschneiden« oder (mit Alkohol oder Drogen) ertränken oder zudecken (Farber 2008; Roussow 2012).
Wenn Kindern klar wird, dass sie von einer primären Bezugsperson, in der Regel dem ihnen näheren Elternteil, hinsichtlich des abwesenden Elternteils getäuscht oder belogen worden sind, so wirkt sich das meist stark auf ihre Bindungsrepräsentation aus, weil die Zuverlässigkeit der primären Bezugsperson dadurch infrage gestellt wird. Die Repräsentation von Bindungsfiguren bei Kindern bildet die Grundlage für Interaktionen mit anderen Menschen, und wenn deren Integrität nicht mehr zweifelsfrei gegeben ist, kann die Verbindlichkeit dieser Grundlage Schaden nehmen.
2.6Mentalisierungsbasierte Konzepte
Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) entstand als spezielles Behandlungsmodell insbesondere für Borderline-Persönlichkeitsstörungen (siehe z. B. Bateman u. Fonagy 2008). Seitdem hat sich dieses Modell auch bei der Arbeit in anderen Bereichen bewährt (siehe Fonagy et al. 2015) – in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wie auch mit Paaren (Rottländer 2020) und Familien (Asen u. Fonagy 2014; Asen u. Weinblatt 2018; Asen a. Fonagy 2021). Auch in deutschsprachigen Ländern setzt sich MBT als therapeutisches Verfahren durch (siehe z. B. Schultz-Venrath 2013; Taubner 2015). Family Ties ist von mentalisierungsbasierten Konzepten und Interventionen inspiriert. Man kann das Mentalisieren als eine Form imaginativer mentaler Aktivität beschreiben. Dies schließt die Wahrnehmung und Deutung menschlichen Verhaltens im Sinne der damit verbundenen absichtlichen, »mentalen« (also psychischen und geistigen) Zustände ein, beispielsweise von Gefühlen, Bedürfnissen, Sehnsüchten, Überzeugungen, Zielen und Gründen (Fonagy et al. 1991). Diese Aktivität ist größtenteils vorbewusst. Es gibt große Unterschiede zwischen Einzelnen und Familien hinsichtlich der Fähigkeit oder der Bereitschaft, sich eine mentalisierende Haltung zu eigen zu machen sowie hinsichtlich dessen, wie akkurat sie sich diesbezüglich bemühen, wenn sie Annahmen über die inneren Zustände anderer Menschen oder ihre eigenen Zustände entwickeln.
Die Bindung schafft die Grundlage für das Wissen darüber, was im menschlichen Geist und der eigenen Psyche vor sich geht: Sie ist der Kontext, in dem das Mentalisieren stattfindet, und gewöhnlich entwickelt sie sich im Kontakt mit primären Bezugsperson. Säuglinge und kleine Kinder versuchen, ihre eigenen inneren Erlebnisse und die Aktivitäten derjenigen, die ihnen am nächsten sind, zu verstehen; sie versuchen zu entschlüsseln, was in ihnen selbst und in ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und anderen für sie wichtigen Personen vor sich gehen mag. Mentalisieren ist ein bidirektionaler sozialer Prozess (Fonagy a. Target 1997). Er entwickelt sich im Kontext der Interaktionen mit anderen Menschen, und seine Qualität hinsichtlich der Fähigkeit, andere zu verstehen, wird durch das Mentalisierungsvermögen der Menschen im näheren Umfeld beeinflusst. Die Familie ist der natürliche Kontext von Bindungsbeziehungen, in denen man etwas über die inneren geistig-seelischen Befindlichkeiten anderer Menschen lernen kann. Tatsächlich könnte man meinen, dass es eine positive Assoziation zwischen Mentalisierungsfähigkeit und Bindungssicherheit gibt (Fonagy et al. 2015b; Slade et al. 2005). Säuglinge und Kleinkinder entwickeln eine Vorstellung von ihren eigenen inneren Zuständen, indem sie die psychischen und geistigen Zustände ihrer primären Bezugspersonen – meist der Mutter und des Vaters – erleben. Dieser Prozess findet in Form von Mikrointeraktionen statt, wobei Eltern und/oder andere Betreuungspersonen die mentalen Zustände des Kleinkindes imitieren, sie dem Kind gegenüber aber als »nicht meine, sondern deine« etikettieren; dies geschieht vor allem mithilfe eines kongruenten und »markierten« Stimmklangs oder Gesichtsausdrucks (Fonagy et al. 2015). Dieses Erleben des Mentalisiertwerdens wird verinnerlicht und ermöglicht es dem Kind, allmählich selbst die Fähigkeit zur Empathie und zum besseren Eingehen auf interaktive soziale Prozesse zu entwickeln (Sharp a. Fonagy 2008). Die Beziehung zwischen Bindung und Mentalisieren ist im Übrigen bidirektional, wenn nicht sogar zirkulär: Probleme beim Mentalisieren wirken sich wahrscheinlich auch nachteilig auf Bindungsbeziehungen aus, und eine problematische Bindungsbeziehung – zu erleben, dass eine wichtige Bezugsperson nicht sensibel auf uns eingeht – unterminiert die natürliche Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit (Kelly et al. 2005).
Die Nutzung eines Mentalisierungsansatzes für die Interventionsarbeit bei schweren Trennungskonflikten beinhaltet die Stärkung der oben genannten Komponenten und das aktive Blockieren nichtmentalisierender Interaktionen und Kommunikationen. Letztere sind daran zu erkennen, dass sich Eltern beispielsweise nicht darüber im Klaren sind, welche Wirkung ihre Handlungen auf ihr Kind oder auf den Expartner haben, daran, dass sie sich grundsätzlich sicher sind, dass ihre Sicht der Dinge korrekt ist, oder daran, dass sie keine Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen können.
Anders gesagt, sollte die generelle Unterentwicklung oder der kontextbezogene Zusammenbruch der elterlichen Mentalisierungsfähigkeit Kliniker3 dazu bringen, die Nutzung von Interventionen in Erwägung zu ziehen, die effektives Mentalisieren wieder möglich machen (Asen u. Fonagy 2015). Family Ties geht von der Annahme aus, dass fundamentale Zusammenbrüche in Mentalisierungsprozessen bei den betroffenen Kindern Triangulierungsprozesse verstärken und es den Eltern – temporär oder permanent – unmöglich machen, auf die komplexen und fluktuierenden mentalen Zustände ihrer Kinder sowie ihrer selbst zu fokussieren. Mentalisierungsbasierte Therapien mit Einzelklienten (Bateman u. Fonagy 2008) und Familien (Asen u. Fonagy 2014) zielen darauf, bei Eltern und ihren Kindern – sowie bei den Angehörigen der erweiterten Familie und bei involvierten professionellen Helfern – eine mentalisierende Haltung wiederherzustellen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.