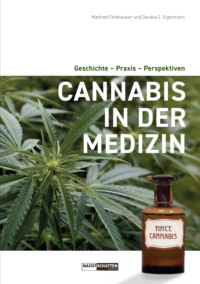Kitabı oku: «Cannabis in der Medizin», sayfa 3
Ein besonderer Klub
Nicht nur in medizinischen Gremien fanden die Ausführungen von Moreau de Tours Beachtung, sondern auch in Literaten- und Künstlerkreisen. So kam es, dass der Schriftsteller Théophile Gautier Haschischproben von Moreau de Tours erhielt und im Jahre 1843 unter dem Titel «Le Club des Hachichins» in der Pariser Zeitung La Presse einen Haschischrausch ausführlich beschrieb. Von nun an kam der von Gautier mitbegründete «Klub der Haschischesser» regelmäßig im Hôtel Pimodan (heute: Hôtel de Lazuzun) in Paris zusammen, und die Erfahrungen mit Hanf wurden zum Teil veröffentlicht (GRINSPOON 1994: 70-85).
Prominente Mitglieder des Klubs waren nebst Gautier die Schriftsteller Charles Baudelaire und Gérard de Nerval, die Maler Joseph Ferdinand Boissard de Boisdenier und Eugène Delacroix sowie der Karikaturist Honore Daumier. Auch der Schriftsteller Alexandre Dumas war Mitglied des Klubs und ließ seine Erfahrungen mit Cannabis in seinen bekannten Roman Der Graf von Monte Christo einfließen. Andere bekannte Zeitgenossen wie die Schriftsteller Honore de Balzac und Gustave Flaubert waren gelegentlich bei den Treffen anwesend, lehnten aber Selbstversuche mit Haschisch ab. Selbst der große Literat Victor Hugo soll Gast dieses exklusiven Klubs gewesen sein. Der Klub wurde 1849 wieder aufgelöst.
Cannabis indica etabliert sich
Die erfolgversprechenden Resultate der Pioniere O’Shaughnessy, Aubert-Roche und Moreau de Tours veranlassten viele Ärzte dazu, das neue Heilmittel in der Therapie einzusetzen. Vorerst waren es vor allem Ärzte der Kolonialmächte England und Frankreich, die sich für den therapeutischen Einsatz von Indisch-Hanf-Präparaten zu interessieren begannen. Die dazu nötigen Rohstoffe oder Präparate wurden in beachtlichen Mengen aus den Kolonien (vor allem aus Indien, zum Teil auch aus Ägypten und Algerien) nach Europa importiert (ROBERTSON 1847: 70-72).
Anfänglich übernahmen die Ärzte die von O’Shaughnessy bekannten Anwendungsgebiete, später wurde das Therapiefeld für Cannabispräparate wesentlich erweitert. Eine der Hauptindikationen blieb aber weiterhin der Starrkrampf. Damit befasste sich auch der bulgarische Arzt Basilius Béron, der sich in seiner 1852 erschienenen Dissertation Über den Starrkrampf und den indischen Hanf als wirksames Heilmittel gegen denselben intensiv diesem Thema widmete. Die Schlussfolgerung seiner Arbeit lautete:
«Ich war so glücklich, dass, nachdem wir fast alle bis jetzt bekannten antitetanischen Mitteln fruchtlos angewandt, nach der Anwendung des indischen Hanfes der mir zugetheilte Kranke vom Starrkrampf ganz geheilt wurde […] weswegen der indische Hanf dringend gegen den Starrkrampf zu empfehlen ist» (BERON 1852: 5, 48).
Zwei Jahre nach Béron veröffentlichte Franz von Kobylanski in Würzburg seine Doktorarbeit über Cannabis als Mittel gegen Wehenbeschwerden. Anders als der Engländer Alexander Christison, der sich ebenfalls mit dieser Thematik befasste, kam Kobylanski zum Schluss, dass der Indische Hanf kein sicheres Mittel zur Wehenverstärkung sei und das damals häufig eingesetzte Secale cornutum (Mutterkorn) nicht ersetzen könne (v. KOBYLANSKI 1852: 30). Im Jahr 1856 publizierte der deutsche Arzt Georg Martius seine umfassende Doktorarbeit (Pharmakognostisch-chemische Studien über den Hanf), welche große Beachtung fand. Er schreibt einleitend:
«Nachfolgende kleine Abhandlung ging zunächst aus dem Wunsche hervor, meinem Vater [einem bedeutenden Professor für Pharmakognosie und Pharmazie an der Universität Erlangen] eine Arbeit vorzulegen, deren Gegenstand den Bereich seiner Fachwissenschaft einschließt. Ich dachte hiebei an den Hanf, dessen Naturgeschichte noch manches Dunkle und Irrthümliche darbot, und der in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der ärztlichen Welt in immer steigenderem Grade auf sich zog. In der Ausführung meines Vorhabens wurde ich bestärkt durch reichliches Material, welches sich mir ganz unverhofft darbot: eine wertvolle Sendung frischen Haschisch’s von Herrn Hofapotheker Steele in Bukarest» (MARTIUS 1855).

Abb. 5: Titelblatt der Dissertation von Basilius Béron, 1852.

Abb. 6: Titelblatt der Dissertation von Georg Martius, 1856.
In der allgemeinen Euphorie gab es auch kritische Stimmen, so vom Wiener Medizinprofessor Carl Damian Ritter von Schroff, der die Cannabispräparate nicht für unbedenklich hielt. In seinem Lehrbuch der Pharmakologie (1856) stellt er fest:
«…dass der indische Hanf und alle aus ihm bereiteten Präparate in Bezug auf den Grad und die Art der Wirkung nach Verschiedenheit der Individualität sowohl im gesunden als im krankhaften Zustande die größte Mannigfaltigkeit darbieten, dass sie daher zu den unsicheren Mitteln gehören und den Arzt jedenfalls mit großer Vorsicht sich derselben bedienen soll» (V. SCHROFF 1858: 112).
Seine Vorbehalte gegenüber Cannabis kamen daher, dass ein konkreter Vergiftungsfall mit dem Indisch-Hanf-Präparat «Birmingi» aufgetreten war. Von Schroff wies darauf hin, dass Cannabispräparate auf einen bestimmten Wirkstoffgehalt eingestellt und damit standardisiert werden müssten, um so derartige Überdosierungen vermeiden zu können.
Praktisch gleichzeitig veröffentlichte der deutsche Naturforscher und Schriftsteller Ernst Freiherr von Bibra sein Standardwerk Die narkotischen Genussmittel und der Mensch, in dem er dem Haschisch eine 30-seitige Abhandlung widmete: Nebst den Erfahrungen anderer beschreibt er ausführlich seinen Selbstversuch mit Haschisch, das er von Georg Martius aus Erlangen (vgl. oben) erhalten hatte. Sein abschließendes Urteil:
«Die neueren Versuche und Erfahrungen, welche man über die medicinische Wirkung der Hanfpflanze und ihrer Präparate gemacht hat, sind sehr zu ihrem Vortheile ausgefallen» (v. BIBRA 1855: 290).
In den folgenden Jahren erschienen viele Arbeiten über die medizinische Verwendung von Cannabis indica. Von Europa aus fand das vielversprechende Heilmittel seinen Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie in Europa waren es auch in den USA zuerst Künstlerkreise, die dem Haschisch zu großer Popularität verhalfen.
Bekannt wurde der Schriftsteller Bayard Taylor, der bereits in den 1850er Jahren Artikel über eigene Haschischexperimente veröffentlichte. Davon beeindruckt, wagte es der junge Literat Fitz Hugh Ludlow, selbst Haschisch zu versuchen, und veröffentlichte 1857, vorerst anonym, sein autobiographisches Werk The Hasheesh Eater (BELL 1857: 33–55).
Angespornt von den Literaten wagte nun auch der in New Hampshire ansässige Arzt John Bell einen wissenschaftlichen Selbstversuch mit einer hohen Dosis «Tilden’s»-Cannabisextrakt. Obschon sich Bell einen veritablen Cannabisrausch einfing, war er beeindruckt von der Kraft dieses Mittels und überzeugt, dass dieses, richtig dosiert, therapeutisch wertvoll sei (BELL 1857). «Tilden’s Extract» war damals in den USA das populärste Cannabismedikament: so erstaunt es nicht, dass Ludlow in seinem Selbstversuch dieses Mittel verwendete, obschon es anscheinend noch potentere Präparate gab, zum Beispiel «Herring’s Alcohol Extract» (MC MEENS 1860: 123).
Im Jahr 1860 verfasste das Medizinische Komitee des Staates Ohio einen detaillierten Bericht über die Verwendung von Cannabispräparaten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser zeigte, dass Indischer Hanf auch in Amerika rege genutzt wurde. Die Indikationen übernahm man aus Europa: daneben wurde Haschisch auch bei Patienten mit Asthma und Bronchitis eingesetzt (MC MEENS 1860: 117–140).
Der Aufschwung hält an
Dass Amerika und die meisten europäischen Länder den Indischen Hanf in die offiziellen Arzneibücher (Pharmakopöen) aufgenommen hatten, verdeutlicht den Stellenwert, den man diesem Heilmittel mittlerweile einräumte.
Bereits in den ersten amtlichen Arzneibüchern des 16. und 17. Jahrhunderts waren Hanfmonographien zu finden. Da man wie erwähnt bis Mitte des 19. Jahrhunderts praktisch nur die Samen und das daraus gewonnene Öl verwendete, wurden nur diese in die Pharmakopöe aufgenommen. Durch das Aufkommen anderer pharmazeutischer Hanfzubereitungen wie Tinkturen und Extrakte gelangten diese, zusammen mit dem indischen Hanfkraut selbst, nach und nach ins Arzneibuch, während die Monographien «Fructus Cannabis» und «Oleum Cannabis» immer mehr verdrängt wurden. In den Jahren 1870 bis 1930 war Indischer Hanf in fast allen europäischen Arzneibüchern vertreten, meist in Form von zwei bis drei Monographien. Mit dem Verschwinden der Cannabispräparate um die Mitte des 20. Jahrhunderts (siehe weiter unten) wurden auch die entsprechenden Pharmakopöe-Präparate allmählich gestrichen.
Es waren weiterhin vor allem Franzosen, welche sich um die Erforschung von Cannabis verdient machten. In regelmäßigen Abständen verfassten Ärzte und Apotheker ihre Doktorarbeiten zum Thema Hanf. Aber auch in Deutschland wurde die Erforschung des Indischen Hanfs vorangetrieben. Eine umfangreiche, vielzitierte Arbeit aus dieser Zeit ist die des Arztes Bernhard Fronmüller aus Fürth. Dieser hatte sich schon seit längerer Zeit mit den Eigenschaften der Hanfpflanze beschäftigt. Die Cannabisversuche für seine Publikation Klinische Studien über die schlafmachende Wirkung der narkotischen Arzneimittel führte er mit exakt 1000 Probanden (552 Männern und 448 Frauen) durch. Die Versuchspatienten litten, bedingt durch unterschiedliche Krankheiten, an schweren Schlafstörungen. All diesen Patienten verabreichte er verschiedene Haschischpräparate (zum Beispiel das Extractum Cannabis ind. spirit. der Firma Merck) in verschiedenen Applikationsformen (Pulver, Pillen, Mixturen, Kuchen, Räucherungen, selten sogar Klistiere). Bei 53 Prozent der Fälle trat der Schlaf vollkommen ein, bei 21,5 Prozent teilweise und bei 25,5 Prozent war nur ein geringer oder gar kein Erfolg zu verzeichnen. Die Schlussfolgerung seiner Arbeit lautete:

Abb. 7: Titelseite der Studie von Bernhard Fronmüller
«Der indische Hanf ist unter den bekannten betäubenden Mitteln dasjenige, welches eine den natürlichen Schlaf am vollkommensten ersetzende Narkose erzeugt, ohne besondere Hemmung der Ausscheidungen [bezogen auf die verstopfende Wirkung des Opiums], ohne Hinterlassung schlimmer Nachwirkung, ohne folgende Paralysen [Lähmung, Erstarrung]» (FRONMÜLLER 1869: 69)
In der Folge befassten sich namhafte Arzneimittelfachleute und Pharmakognosten (Pflanzenheilkundler) mit dem Indischen Hanf. In einigen dieser Untersuchungen wurde die Unzuverlässigkeit der Haschischpräparate bemängelt. Diese Problematik der Standardisierung sollte die Cannabispräparate bis zu deren Verschwinden begleiten. Im Großen und Ganzen waren sich die Experten jedoch einig: Der Indische Hanf ist eine Bereicherung des Arzneimittelschatzes. Einer der wenigen, die auf die mögliche Gefahr bei einem Langzeitkonsum hinwiesen, war der Pharmakologe Rudolf Kobert. Er schrieb: «Der habituelle Genuss aller wirksamen Hanfpräparate depraviert [verdirbt] den Menschen und führt ihn ins Irrenhaus» (KOBERT 1897: 465).
1880 bis 1900: Der Höhepunkt
In fast allen europäischen Ländern und in Amerika hatte sich der Gebrauch von Haschischpräparaten mittlerweile etabliert. Nach wie vor waren es Wissenschaftler aus England, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten, welche die Cannabisforschung konsequent vorantrieben: die auf dem Markt erhältlichen konfektionierten Präparate (die sogenannten Spezialitäten) stammten überwiegend aus diesen Ländern.
Es ist insbesondere das Verdienst der Firma E. Merck in Darmstadt, dass Cannabispräparate in Europa gegen Ende des 19. Jahrhunderts vermehrt verwendet wurden. Aber auch die Firma Burroughs, Wellcome & Co. in England stellte Cannabispräparate her. In den USA übernahmen die Firmen Squibb in New York, Parke-Davis & Co. in Detroit und später Eli Lilly & Co. in Indianapolis diese Aufgabe. Dank diesen (und einigen anderen) Unternehmen standen qualitativ hochwertige Rohstoffe und mehrere Fertigpräparate zur Verfügung.
Frankreich setzte seine fünfzigjährige Tradition fort: Weiterhin erhielten Ärzte und Apotheker ihre Doktorwürde aufgrund ihrer Arbeiten über Haschisch. Eine davon war die 1896 erschienene Dissertation Le chanvre indien des Arztes Hastings Burroughs, der seine Erkenntnisse wie folgt zusammenfasst: «In therapeutischen Dosen ist der indische Hanf ungefährlich und hätte es verdient, vermehrt benützt zu werden» (BURROUGHS 1896: 52).
In Deutschland schrieben zuerst die Doktoranden H.Zeitler (Über Cannabis indica, 1885) und M. Stark (Über die Anwendungsweise der neueren Cannabispräparate, 1887) ihre Promotionsarbeiten: im Jahr 1894 veröffentlichte der Apotheker Leib Lapin unter der Leitung der bekannten Pharmakologen Johann Georg Dragendorff und Rudolf Kobert (der dem Cannabis durchaus kritisch gegenüberstand) seine Dissertation Ein Beitrag zur Kenntnis der Cannabis indica. Im ersten Teil seiner Arbeit liefert er eine Übersicht über die dahin gebräuchlichen «Volks-, Fabrik- und officinellen Hanf-Präparate». Im zweiten Teil geht er auf die Pharmakologie des von ihm erstmals beschriebenen Cannabisderivats «Cannabindon» ein. Die Bemerkung im Vorwort seiner Untersuchung zeigt, mit welcher Unsicherheit man dem Indischen Hanf bezüglich Arzneimittelsicherheit nach wie vor begegnete:
«Wäre es so leicht die Haschischfrage zu lösen, so würde sie sicher schon einer der vielen früheren Untersucher gelöst haben: ich glaube, zur definitiven Lösung derselben einen Beitrag geliefert zu haben und dieser Glaube giebt mir den Muth, das Nachfolgende als Dissertation der Öffentlichkeit zu übergeben» (LAPIN 1894: 7).

Abb. 8: Handelsübliche Aufbewahrungsgefäße für Cannabispräparate um 1900.
Einen außerordentlich wichtigen wissenschaftlichen Beitrag zur Cannabisforschung im 19. Jahrhundert lieferte der Indian Hemp Report von 1894. In dieser Erhebung, die England in seiner Kolonie Indien durchführte (insgesamt wurden 1193 Personen mündlich oder schriftlich eingehend zum Thema Cannabis befragt), ging es hauptsächlich darum, die Gewinnung von Drogen aus Cannabis, den Handel damit und dessen Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung zu untersuchen. Zudem sollte abgeklärt werden, ob ein Verbot dieser Präparate sich rechtfertigen ließe. Zu diesem Zweck wurde eine Expertenkommission gegründet, deren Bericht eindrücklich den Stellenwert des Genuss- und Heilmittels Cannabis in Indien gegen Ende des 19. Jahrhunderts dokumentiert. Die Kommission kommt darin zum Schluss:
«Aufgrund der Auswirkungen der Hanfdrogen scheint es der Kommission nicht erforderlich, den Anbau von Hanf, die Herstellung von Hanfdrogen und deren Vertrieb zu verbieten» (LEONHARDT 1970: 186).
Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich der Indische Hanf einen wichtigen Platz in der Materia medica der westlichen Medizin erobert. Die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung der Cannabispräparate war bis dahin praktisch inexistent. Der Würzburger Professor A.J. Kunkel hielt in seinem Handbuch der Toxikologie 1899 fest:
«Der chronische Missbrauch von Cannabis-Präparaten – Cannabismus – soll in Asien und Afrika sehr verbreitet sein. Er ist in Europa nicht beobachtet. Von indischen Ärzten werden dagegen häufig Fälle dieser Erkrankung berichtet» (KUNKEL 1899: 839)

Abb. 9: Cannabishaltiges Hustenpulver für Kaiserin Sis(s)i.
Zusammengefasst: Die Mehrheit begrüßte den Einsatz von Cannabis als Medikament. Einige wenige hielten es für wertlos oder sogar gefährlich. In Bezug auf die unsichere – manchmal zu starke, manchmal zu schwache – Wirkung der Hanfpräparate war man sich hingegen einig. Dieses Problem wurde erst viel später durch das Standardisieren der wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe (insbesondere von THC) gelöst.
Eine prominente Patientin, die ein cannabishaltiges Präparat erhielt, war die Kaiserin von Österreich, Elisabeth (berühmt als Sisi oder Sissi). Es ist bekannt, dass sie, vermutlich aufgrund der Belastung durch ihre Rolle, oft krank war und an verschiedensten Beschwerden litt, so auch unter starkem Husten. Die königliche Hofapotheke stellte eigens für sie – und später auch für ihre Tochter Marie Valerie – ein cannabishaltiges Hustenpulver her, das durch den bekannten Arzt Prof. Carl Braun verordnet wurde. Außergewöhnlich ist, dass Cannabis gegen Husten verschrieben wurde. Dies könnte damit zusammenhängen, dass eher die appetitstimulierende Wirkung des Hanfs gefragt war, denn die Kaiserin war für diese Zeit ausgesprochen schlank, und es wurde gemunkelt, dass sie unter Essstörungen leide: jedenfalls unterzog sich die Kaiserin in den letzten Lebensjahren immer wieder verschiedensten Diäten. Eine Hypothese lautet, dass ihr der Arzt, wie damals durchaus üblich, Cannabis, gegen Gonorrhoe (Tripper) verschrieb: allerdings war nie bekannt, dass auch ihr Ehemann unter dieser Geschlechtskrankheit litt. Das führte zu Spekulationen, da «Sissi« gerade in dieser Zeit Bekanntschaften zu anderen Männern pflegte (FELLNER, UNTERREINER 2208: 113-115).
Cannabis als Arzneimittel im 20. Jahrhundert
1900–1950
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen vermehrt chemisch orientierte Arbeiten über Cannabis. Man war bestrebt, das Geheimnis des «aktiven Prinzips» dieser Pflanze zu lüften. Weiter war die erwähnte Standardisierungsproblematik der Haschischpräparate Gegenstand vieler Publikationen. Ein ebenfalls nicht neues, aber immer wieder aufgenommenes Thema war die Untersuchung der Wirksamkeit von einheimischem Hanf. Überhaupt begann man nach dem ersten Weltkrieg Faserhanf wieder vermehrt zu untersuchen, weil Indischer Hanf in Europa praktisch nicht mehr erhältlich war.
Es hatte zwar immer Hinweise gegeben, die auf Vergiftungsfälle mit Haschisch aufmerksam machten. Die Gefahr von Abusus sah man jedoch nach wie vor als inexistent oder zumindest als gering an. In den ersten internationalen Vereinbarungen über die Betäubungsmittel, die kurz nach der Jahrhundertwende getroffen worden waren, war Cannabis noch kein Thema (vgl. Kapitel 7). Erst im Laufe der Zeit gab es vereinzelt Stimmen, die sich zur Frage eines eventuellen Missbrauchs äußerten. Noch 1937 hielt die American Medical Association fest:
«Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Missbrauch von Cannabis als medizinische Substanz häufig stattfindet oder dass sein medizinischer Gebrauch zu der Entwicklung einer Cannabisabhängigkeit führen könnte. Cannabis wird gegenwärtig nur noch in geringem Ausmaß für medizinische Zwecke verwendet, es wäre aber von Wert, seinen Status als therapeutisch beizubehalten. Es besteht die Möglichkeit, dass durch eine Wiederaufnahme der Untersuchungen über die Wirkung von Cannabis möglicherweise andere Vorteile der Substanz entdeckt werden, als bei ihrem gegenwärtigen medizinischen Gebrauch zu sehen sind« (MIKURIYA 1982: 93).
Einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über Abhängigkeit und Gefährlichkeit lieferte der US-amerikanische LaGuardia Report (Originaltitel: Mayor LaGuardias’s Comitee on Marihuana, New York: The Marihuana Problem in the City of New York. Sociological, medical, psychological and pharmacological studies) aus dem Jahr 1944. Aufgrund der in Amerika weit verbreiten Meinung, dass der Marihuana-Konsum in einigen Städten der Vereinigten Staaten ein bedrohliches Ausmaß angenommen habe, berief der damalige Bürgermeister von New York, Fiorello LaGuardia, eine Expertenkommission ein, um eine wissenschaftliche Untersuchung durchzuführen. Mediziner und Soziologen konnten jedoch nicht bestätigen, dass die allgemeinen Vorurteile gegenüber Marihuana berechtigt waren. Nach ungefähr vierjähriger Arbeit stellte die Expertengruppe zusammenfassend fest:
«Personen, die mehrere Jahre lang Haschisch geraucht haben, zeigten keine geistigen oder körperlichen Schäden, die der Droge zugeschrieben werden können» (LEONHARDT 1970: 26).
Obschon seit Beginn des 20. Jahrhunderts laufend neue industriell hergestellte Cannabismedikamente auf den Markt kamen, ging der Gebrauch der Hanfpräparate in einigen Ländern (zum Beispiel in England) bereits wieder zurück (zu den Gründen siehe weiter unten).
Die wissenschaftliche Erforschung des (Indischen) Hanfs hingegen wurde intensiv weitergeführt. Weiterhin waren es vor allem die Franzosen, die sich auf dem Gebiet der Hanfforschung hervortaten. Ein immer wiederkehrendes Thema war die Standardisierung der Hanfmedikamente: man war bemüht, diese sicherer zu machen. Auch in anderen Ländern Europas, beispielsweise Deutschland, blieb die pharmakologische Forschung mit Hanf nicht stehen. Renommierte deutsche Firmen wie Boeringer Ingelheim und insbesondere Merck in Darmstadt interessierten sich sehr für Cannabis. Merck wurde im Laufe der Zeit zum wichtigen Lieferanten für cannabishaltige Halbfabrikate wie Cannabinum tannicum (vgl. Abb. 10), aus welchem die Apotheken gebrauchsfertige Medikamente (zum Beispiel Pillen) herstellten. In der Schweiz nahmen die Basler Platzhirsche Hoffmann-La Roche und die Ciba (später Ciba-Geigy, heute Novartis) eine Pionierrolle ein. Interessant ist, dass sich die dritte große Basler Firma, Sandoz (heute Novartis), damals anscheinend nicht mit Hanf beschäftigte. Aufgrund ihrer damaligen Spezialisierung in Richtung Pflanzenalkaloide ließe sich dies zwar vermuten, aber es finden sich keine Hinweise darauf. Der Entdecker des LSD, Albert Hofmann, der seit 1929 bei Sandoz beschäftigt war, hatte zwar im Laufe der Zeit mit einigen psychotropen Substanzen nebst LSD experimentiert, nie aber mit Cannabis, wie er in einer persönlichen Mitteilung festhielt (briefliche Mitteilung von A. HOFMANN 1994).

Abb. 10: Inserat der Firma Merck, Darmstadt, um 1885.

Abb. 11: Sammlung Tschirch: Exponate von Cannabis indica und Cannabis sativa.
In der Schweiz war es neben Basel vor allem die Hauptstadt Bern, welche sich zur eigentlichen Hochburg der Haschischforschung entwickelte. Unter der Leitung des bekannten Pharmakologen Emil Bürgi erschienen in der Zeit von 1910 bis 1946 circa 30 Dissertationen zum Thema Cannabis. Bei einer Mehrzahl dieser Arbeiten wurde die Kombination eines Arzneistoffes mit Cannabis untersucht. Praktisch immer kamen die Autoren zu einem positiven Ergebnis in dem Sinne, dass eine Wirkungsverstärkung eintrat. Aufgrund dieser Ergebnisse kamen schließlich die hanfhaltigen Medikamente Indonal «Bürgi«, Indothein «Bürgi» und das Schlafmittel Satival auf den Markt.
Aus dieser Zeit stammt die vom bekannten Pharmakognosten und Pharmazieprofessor Alexander Tschirch aufgebaute Drogensammlung in Bern. Die mehrere tausend Exponate umfassende Sammlung enthält auch einige Exemplare von Cannabis beziehungsweise Haschisch (vgl. Abb. 11).