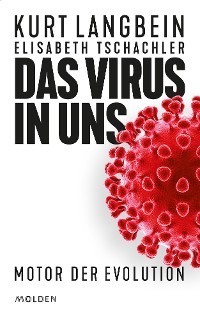Kitabı oku: «Das Virus in uns», sayfa 4
4
Viren als Motor der Evolution
Viren sind uralte Überlebenskünstler und haben die Evolution der meisten Lebewesen, auch von uns Menschen, vorangetrieben. Ohne sie gäbe es wohl heute keine Sexualität, würden dem Menschen manche Gene fehlen und sein Abwehrsystem wäre weniger leistungsfähig.
»Viren gehören zu unserem Ökosystem, zu unserem Leben, zu unserer Umwelt, zu unserer Verdauung. Rund 50 Prozent des menschlichen Erbguts stammt von Viren«, sagt die deutsche Virologin Karin Mölling. »Viren sind die Treiber der Evolution, nicht primär Krankmacher«, erklärt die Grande Dame der Virenforschung vom Berliner Max-Planck-Institut, die seit ihrer Forschung an HIV weltweiten Ruf genießt.59 Für sie deutet alles darauf hin, dass Viren am Anfang des Lebens standen und eigentlich lebendig sind, auch wenn ihnen die Fähigkeit zur Fortpflanzung und zum Stoffwechsel fehlt und sie von den meisten Forschern für leblose Partikel gehalten werden. Für eine Zuordnung zum Lebendigen sprechen einige immer stärker werdende Argumente. Immerhin können Viren sich genetisch verändern – durch Mutationen. Und wenn sie ihren Bauplan in eine Biozelle eingebaut haben, dann sind sie auch Bestandteil eines lebenden Systems.60
War am Anfang das Virus?
Viren bestehen hauptsächlich aus Erbgut – DNA, viel öfter noch RNA. Die Nukleinsäure, für deren englisches Wort das Kürzel NA steht, ist die materielle Basis der Gene. Im Gegensatz zu den doppelsträngigen DNA-Molekülen kommen die RNA-Moleküle für gewöhnlich einzelsträngig vor. Das ermöglicht mehr dreidimensionale Strukturen und chemische Reaktionen, die es bei der DNA nicht gibt. Bei Schäden oder Mutationen kann sich allerdings die DNA durch den zweiten Strang viel eher selbst reparieren, deshalb mutieren Viren mit RNA-Strukturen auch viel schneller.
Im Labor lässt sich RNA relativ einfach herstellen. Das gelang 2009 erstmals Wissenschaftlern der Universität Manchester aus Substanzen, wie sie wahrscheinlich auch in der Urerde vorhanden waren. Sie nahmen dazu ein einfaches Molekül, das als Gerüst zum Aufbau von Nukleinsäure-Bausteinen diente.61 Ein solcher chemischer Vorgang könnte auch in der Urerde möglich gewesen sein, meinen Forscher, die der Virus-first-Hypothese anhängen, also davon ausgehen, dass Viren am Anfang des Lebens standen. Die Idee dahinter: Bei der Entstehung des Lebens sind zuerst nicht Biozellen, sondern Virus-Vorläufer aus RNA entstanden, die als chemische Schnipsel in die Umwelt freigegeben wurden und sozusagen als Informationsträger umherschwirrten. Beweise dafür gibt es nicht, weil fossile Viren aus der Zeit vor vier Milliarden Jahren fehlen. Die Suche danach auf anderen Planeten könnte helfen, eine Bestätigung für die These zu finden, etwa auf dem Mars, weil es dort noch sehr altes Gestein gibt, wesentlich älter als auf der Erde. Würden dort Überreste von Virenpartikeln isoliert, aber keine Zellen, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass in der Evolution zuerst RNA-Systeme entstehen und erst dann biologische Zellen. Doch das ist alles noch Gegenstand von Experimenten und Annahmen.
Viel weiter sind die Forschungen, die sich auf die Entstehung und Entwicklung des Menschen beziehen. Die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts und die Genomanalysen anderer Lebewesen haben gezeigt: Alles, ob Nahrungsmittel, Raubtiere oder potenziell krankmachende Mikroben, hatte einen Einfluss auf die Evolution des Menschen.62 Dieser sogenannte horizontale Gentransfer – die Übertragung von Genen zwischen zwei Organismen, die nicht miteinander verwandt sind – hat zu vielgestaltigen Genomen geführt. Und Viren haben dabei eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. »Viren haben sich gemeinsam mit ihren Wirten weiterentwickelt, und ihre Verwandtschaftslinien können als Lianen betrachtet werden, die sich um den Stamm, die Äste und die Zweige des Lebensbaums schlingen«, sagt Patrick Forterre, vor der Pensionierung Direktor der Abteilung für Mikrobiologie des Pariser Pasteur-Instituts.63
»Jede einzelne Spezies hat zahlreiche auf sie spezialisierte Viren«, erklärt Forterre. Der Mikrobiologe, auch er überzeugter Verfechter der Virus-first-Theorie, bezweifelt die Lehrbuch-Hypothese von Viren als »Taschendieben«, die sich aus den Zellen Erbgut klauen und damit selbstständig machen. Die umgekehrte Variante sei biologisch wesentlich plausibler. Im Lauf der Evolution hätte es einen gewaltigen Nachteil bedeutet, parasitäre Mikroben, die nur ihren eigenen Vorteil bedienen, in lebendige Systeme einzubinden. Stattdessen wurde die Bildung von Symbiosen, also kooperativen Systemen, klar bevorzugt. Organismen, die es nicht schafften, sich mit ihren Mikroben abzustimmen, starben aus. Mittlerweile gibt es schon etliche Funde, die Forterres These untermauern sowie gleichzeitig zeigen, welche Überlebenskünstler Viren sind und wie sehr sie zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im globalen Ökosystem beitragen. So wurden im Erbgut eines zwölf Millionen Jahre alten Kaninchens Viren gefunden, die jenen des Aids-Verursachers HIV ähnlich sind; Ähnliches fand sich in 13 Millionen Jahre alten Lemuren auf Madagaskar.64 Und Forscher im Berliner Naturkundemuseum konnten vor Kurzem nachweisen, dass ein eidechsenähnliches Tier, das vor 289 Millionen Jahren in der Permzeit lebte, an einer Erkrankung des Knochenstoffwechsels litt, hervorgerufen durch masernähnliche Viren.65
Ein 50 Millionen Jahre alter Phönix
»Phönix«, so nannte Thierry Heidmann das Virus, das er 2006 in seinem Labor zu neuer Aktivität erweckte.66 Dem französischen Biophysiker war etwas gelungen, was Forscherkollegen als »Jurrasic-Park-Experiment« bezeichneten. Er hatte Kopien eines – wie sich herausstellte – 50 Millionen Jahre alten Retrovirus, dessen genetischen Bauplan er im menschlichen Genom entdeckt hatte, wieder in die Lage versetzt, von einer Wirtszelle neue Virenpartikel produzieren zu lassen. Diese Partikel konnten dann ihrerseits wieder Zellen infizieren und ihre kopierten Gene in die Zelle einfügen. Bis dahin waren die Virus-Kopien inaktiv gewesen, denn in den Jahrmillionen hatte sich ihr Erbgut ein paarmal verändert, ohne sich jedoch einen neuen Wirt zu suchen.
Gleich dem mythologischen Vogel, der aus seiner eigenen Asche wiederersteht, entstand so ein vollständiges und aktives Virus, zusammengesetzt aus seinen in menschlicher DNA festgeschriebenen Teilen. Wie kam der Ursprungs-»Phönix« in die menschliche DNA? Er muss in Urzeiten Keimzellen menschlicher Vorfahren infiziert haben und dann von Generation zu Generation weitergegeben worden sein. Die Überbleibsel solcher Viren-Kopien werden humane endogene Retroviren genannt – ihr Kürzel ist HERV. »Phönix« ist nicht das einzige – immerhin rund 8 Prozent des menschlichen Erbguts bestehen aus solchen HERVs. Identifiziert wurden bereits mehr als 30 HERV-Familien.
Aber welchen evolutionären Sinn ergibt das? Lange Zeit blieb der Grund, warum sich die Genbruchstücke im menschlichen Erbgut eingenistet haben, im Dunkeln. Für die Wissenschaft waren sie einfach »Junk-DNA«, nutzloser Abfall. Doch nach und nach hat sich herausgestellt, dass sie nicht von ungefähr eng mit dem Menschen verbunden sind. Einerseits treiben sie die Evolution voran, weil die Gene, die sich nicht vom Virus infizieren lassen, ausgeschieden werden. Aber neue Forschungen zeigen, dass sie auch zu Neuerungen im Genom beitragen, etwa indem sie neue genetische Codes für die Herstellung bestimmter Moleküle einbringen.67 Ein Beispiel dafür ist das Enzym Amylase, das notwendig ist, um Stärke abzubauen. Die meisten Säugetiere bilden dieses Enzym nur in der Bauchspeicheldrüse. Nicht so der Mensch. Bei ihm bildet es sich auch in der Speicheldrüse – eine Voraussetzung für die Ackerbaukultur: Nur wer Getreide leicht verdauen kann, für den ist Ackerbau sinnvoll. Zu verdanken ist diese Eigenschaft einem Retrovirus68, das sich in der Nähe von drei Amylase-Genen ins Genom einnistete und dafür sorgte, dass auch die Speicheldrüsen den Stoff herstellen.69
Ohne Viren keine Kinder
Eigentlich gehören Viren zu den sich am schnellsten verändernden Mikroben. Doch die Genbestandteile der endogenen Retroviren sind, wie »Phönix« bewiesen hat, erstaunlich dauerhaft, was ihren Verbleib bei einem Wirt betrifft. Das deutet darauf hin, dass das jeweilige neue Gen vom befallenen Organismus sehr oft gut gebraucht werden kann.70 Erste Erkenntnisse dazu, wie nützlich die Virusgene im Menschen sein können, gab es bereits 1978. Da stießen Forscher vom Cancer Institute in San Francisco auf Retroviren-ähnliche Partikel in menschlichem Plazentagewebe. Erst mehr als 20 Jahre später wurde klar, was ihre Funktion ist: Sie unterstützen die Produktion bestimmter Eiweißstoffe, die ursprünglich dem Virenpartikel halfen, seine Hüllmembran mit der der Wirtszelle zu verbinden. Später trugen die Eiweißstoffe dazu bei, Zellen in der Plazenta so zu verbinden, dass eine schützende Barriere entsteht. Die verhindert, dass das Immunsystem der Mutter den Embryo als Fremdkörper abstößt, während er sich in die Gebärmutter einnistet.71 Dieser wichtige Schritt – eine Voraussetzung für die Lebensfähigkeit von Säugetieren – hat sich vor zwölf bis 80 Millionen Jahren ereignet72, bei Beuteltieren dagegen konnte dieses endogene Virus nicht nachgewiesen werden. Der Mensch und alle anderen Säugetiere mit Plazenta dürften eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Fortpflanzung einem Virus verdanken.
Viren haben im Lauf der Evolution auch dazu beigetragen, das menschliche Immunsystem zu modulieren. US-amerikanische Wissenschaftler fanden heraus, dass virale Erbgutschnipsel hauptsächlich in der Nähe von jenen Genen zu finden sind, die die Immunantwort steuern. Werden die ursprünglich von Viren stammenden Basenpaare im Labor entfernt, fällt die Immunantwort auf eine Virusinfektion weitaus schwächer aus.73
Die Nähe mancher endogenen Retroviren zum Immunsystem lässt sie jedoch nicht immer nur freundlich wirken. Einige werden mit der Entstehung von Autoimmunkrankheiten wie der Arthritis oder anderen rheumatischen Erkrankungen, mit Multipler Sklerose und Schuppenflechte in Zusammenhang gebracht. Eine mögliche Beteiligung von Viren wurde auch bei Brust- und Hautkrebs festgestellt.74 Doch wenn alle Retroviren schädlich für den Menschen wären, wären sie im Zuge der Evolution wohl nicht weitergegeben worden.
Auch andere Bestandteile im menschlichen Genom sind viralen Ursprungs. Die Virologin Anna Marie Skalka und ihr Team vom Krebsforschungsinstitut in Pennsylvania fanden im menschlichen Genom die Gensequenzen der Vorfahren von Bornaviren, gefürchteten Krankheitserregern. Der Fund war unerwartet, zumal die Genabschnitte dieser und anderer Keime wie dem Marburgvirus auch in der DNA von 19 Wirbeltierarten gefunden wurden. Skalka vermutet, dass das Virus-Erbgut vor rund 40 Millionen Jahren in die Keimbahn der Tiere gelangt ist und dass damit infizierte Tiere einen Überlebensvorteil gehabt haben müssen. Möglicherweise haben die Genbruchstücke zu einer Immunantwort gegen eine Infektion durch das jeweilige Virus beigetragen und auf diese Weise wie eine Impfung gewirkt.75
Die Berliner Virologin Karin Mölling meint gar, dass die gesamte menschliche Erbsubstanz auf Viren zurückgeht.76 »Unser Erbgut wird ergänzt durch das 150-Fache an zusätzlichem Erbgut von Mikroorganismen, die uns besiedeln«, erklärt sie, und das ergibt Sinn: »Sie bieten neues Erbgut, also neue Information und auch Schutz.« Denn befinden sich Viren in einer Zelle, lassen sie andere Viren nicht hinein.
Wir erinnern uns durch Viren
Anscheinend hat auch das menschliche Gehirn vor langer Zeit ein Virus für seine Zwecke eingespannt. Seitdem geistert es durch unser Zentralnervensystem und ermöglicht uns, uns Dinge länger zu merken.
Wie das Gedächtnis funktioniert, wissen wir noch immer nicht genau. Aber das Protein Arc dürfte für die dauerhafte Speicherung von Informationen unentbehrlich sein. Zumindest können sich Mäuse, denen es gentechnisch entfernt wurde, nichts länger als 24 Stunden merken.77 Oder, wie es der Hirnforscher Jason Shepherd von der University of Utah in Salt Lake City ausdrückt: Im Leben gibt es ein Zeitfenster, in dem sich das Gehirn wie ein Schwamm verhält, also Wissen und Fähigkeiten aufsaugt. Ohne Arc bleibt dieses Fenster geschlossen.
Bei Arc handelt es sich um das Überbleibsel eines Virus, das vor Hunderten von Millionen Jahren ins Erbgut der Vorläufer von Mensch und Tier geriet und seitdem von Generation zu Generation weitervererbt wurde. So weit, so gewöhnlich. In aller Regel haben solche Partikel aber ihre ursprünglichen viralen Eigenschaften längst verloren.
Nicht so bei Arc. Im Elektronenmikroskop lassen sich verblüffende Entwicklungen zeigen: Liegen in Zellen ausreichend Arc-Proteine vor, organisieren sich diese zu Hohlkörpern, die einer Virushülle, dem sogenannten Kapsid, sehr ähnlich sehen. »Als wir die Kapside sahen, wussten wir, dass wir auf etwas Interessantes gestoßen waren«, erzählt Shepherd, der seit Jahrzehnten an diesem Protein forscht.78
Das Team begann mit weiteren Untersuchungen. Und so stellte sich heraus, dass die Kapsel aus Arc-Proteinen immer noch die Fähigkeit hat, ihre eigene RNA-Bauanleitung festzuhalten und sich dabei immer wieder andere vorbeischwimmende RNA-Sequenzen zu schnappen und einzuverleiben. Mitsamt dieser Fracht, beobachteten Shepherd und Kollegen, wandert die Arc-Kapsel an die Zellmembran, umhüllt sich dort mit der Außenschicht der Zelle und driftet ins umgebende Medium. Trifft sie auf ein Nachbarneuron, dockt sie an, wird aufgenommen, zerfällt und gibt die RNA frei.
Damit funktioniert Arc fast noch genauso wie ein Virus, das auf diese Weise seinen Wirt überfällt, also infiziert – mit dem Unterschied, dass in diesem Fall der Wirt ausschließlich einen Nutzen davon hat. Als wahrscheinlich gilt, dass das Exvirus mit seiner Transporttätigkeit einen zusätzlichen Kommunikationskanal zwischen den Gehirnzellen und uns damit die Erinnerung eröffnet.
5
Europa sperrt sich ein
Innerhalb nur einer Woche sorgten die Regierungen der meisten europäischen Staaten unter dem Applaus der meisten Medien für die Aufhebung fast aller Grundrechte. Ausgangssperren wie im Krieg, um Leben zu retten – ein einmaliger Vorgang.
Dumpfe Bässe, dunkle Bilder von Schweinen und Männern in Gummistiefeln. Aus dem Off die Stimme einer Nachrichtensprecherin mit unheilverkündendem Tremolo: »Es begann in gesund aussehenden Schweinen, vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren. Ein neues Coronavirus breitete sich unerkannt in den Herden aus.« Das elfminütige Video stand am Beginn eines Treffens, zu dem am 18. Oktober 2019 eine hochkarätige Runde in New York zusammentraf.79 Avril Haines war dabei, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin von US-Präsident Barack Obama; Martin Knuchel, der Leiter der Krisenabteilung der Lufthansa; Latoya Abbott, die Risikochefin der US-Hotelgruppe Marriott International, der größten Hotelkette der Welt; Brad Connett, Vorstandschef der Henry Schein Group, eines internationalen Medizinprodukte-Herstellers; dazu eine Vertreterin der Gates-Stiftung; und ein hochrangiger Gast aus China: George F. Gao, Direktor des China Centre for Disease Control and Prevention.
Die 15 waren zu einem speziellen Meeting zusammengekommen: Sie wollten eine Pandemie durchspielen. Der fiktive Erreger aus dem Video, der die Teilnehmer des »Event 201« die nächsten Stunden beschäftigen sollte, war dem seit 2002 bekannten SARS-Coronavirus nachempfunden. Es war von einer Fledermaus auf ein Schwein und schließlich auf einen Menschen übergesprungen und sollte infektiöser sein als SARS, mit einerseits milden, für viele Menschen aber doch lebensbedrohlichen und tödlichen Symptomen. Irgendwo in Brasilien wurde der Anfang der Seuche angenommen. Zuerst fast unbemerkt, breitete sie sich dann in größeren Ortschaften aus, in den südamerikanischen Megacitys und schließlich rund um den Erdball. Es gab keine Impfung, antivirale Medikamente wirkten nicht in jedem Fall, das Virus hatte also leichtes Spiel. Mit einer wöchentlichen Verdopplung der Infektionszahlen schnellte die Kurve des Schreckens exponentiell in die Höhe. Das Szenario endete nach 18 Monaten, nachdem der Keim 65 Millionen Menschen getötet hatte und die Wirtschaft am Boden lag.
Dreieinhalb Stunden lang diskutierten die 15 Vertreter internationaler und nationaler Institutionen und Unternehmen auf Einladung der Johns Hopkins University, der Bill & Melinda Gates Foundation und des Weltwirtschaftsforums, was im Fall eines solchen Falls zu tun sei. Es ging um medizinische Maßnahmen, Reisebeschränkungen, die gerechte Verteilung von Medikamenten und Schutzmasken, um das Eindämmen von Falschinformationen und das Auffangen der desaströsen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die bis zu zehn Jahre anhalten würden.80 Am Ende war klar: Regierungen, Behörden und Unternehmen müssen enger als bisher üblich zusammenarbeiten, anders würde es nicht gehen. Und: Mit der Vorbereitung könne nicht früh genug begonnen werden, immerhin zählt die WHO 200 Epidemien pro Jahr, fast jede kann sich zu einer Pandemie auswachsen.81
Das Medienecho war gering, bloß ein paar Zeitungen berichteten über die Veranstaltung, die meisten mit dem Tenor, dass die Welt wohl nicht auf eine Pandemie vorbereitet sei. Und auch sonst fand der Katastrophen-Plot nicht viel Widerhall.
Ebenso wenig wie die Szenarien, die die Weltgesundheitsorganisation WHO mit der fiktiven Infektionskrankheit »Disease X« durchgespielt hat. Ebenfalls im Oktober 2019 wurden von der WHO die Handlungsweisen bei einer Virus-Pandemie evaluiert und alle nichttherapeutischen »Gesundheitsmaßnahmen zur Reduktion des Risikos einer Influenza-Epidemie oder -Pandemie« auf ihre wissenschaftliche Stichhaltigkeit hin untersucht.82 Die Experten analysierten vier Gruppen von Maßnahmen:
a.Personenbezogene Schutzmaßnahmen wie Handhygiene, spezielles Nies- und Hustenverhalten und den Einsatz von
b.Schutzmasken. Umgebungsbezogene Maßnahmen wie Oberflächenreinigung, den Einsatz von UV-Licht oder Belüftungstechniken.
c.Contact Tracing, Isolation von Kranken und Quarantäne von Risikogruppen sowie Social-Distancing-Maßnahmen wie Schul- und Arbeitsplatzschließungen und die Meidung großer Menschenmassen.
d.Reisebezogene Maßnahmen wie Reisewarnungen, Screenings von Flugreisenden, Inlandsreiseverbote und Grenzschließungen.
Das Resümee ist eindeutig: Lediglich für die Wirksamkeit von Handhygiene und Schutzmasken gäbe es ausreichende Evidenz, stellten die Experten der WHO fest. Auch die Isolation von Erkrankten und ihren Kontaktpersonen seien effektiv. Für die Wirksamkeit von Ausgangssperren, Schließungen von Arbeitsplätzen, Grenzschließungen und Reisebeschränkungen dagegen gebe es keine gesicherte Evidenz, so die WHO-Fachleute. Die europäische Seuchenbehörde ECDC hat schon 2009 eine ähnliche Studie veröffentlich, mit den gleichen Resultaten.83
Warum hat dann mit März 2020 ein Großteil der Regierungen Europas genau diejenigen Maßnahmen ergriffen, deren Effektivität von den internationalen Gesundheitsexperten als unbewiesen angesehen werden? Warum wurden die bürgerlichen Freiheiten radikal eingeschränkt, Ausgangssperren verhängt, das Recht auf Bildung, auf Ausübung eines Gewerbes für ungültig erklärt, Religionsausübung verboten und sogar Kontakte mit nahen Verwandten unter Strafe gestellt, dazu noch drastische Reisebeschränkungen verhängt?
Der Anfang: Zwischen Ignoranz und Panik
Zunächst, sind sich die meisten Infektiologen, Epidemiologen und Virologen einig, hätten es die Gesundheitsbehörden durchaus in der Hand gehabt, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Die Informationen aus China lagen inklusive Gencode des neuen Virus ab Mitte Januar 2020 vor, die europäische Seuchenbehörde ECDC warnte alle Regierungen, ausreichende Vorkehrungen zu treffen. Alle antworteten: Wir sind gut vorbereitet. »Es gab einen Pandemieplan, aber der war nur auf Influenza abgestimmt«, sagt Christoph Wenisch, Infektiologe an der Wiener Klinik Favoriten. »Es gab da wohl mahnende Stimmen, die aber im akademischen oder wissenschaftlichen Kontext verhallt sind. Und deshalb hat uns diese Pandemie, wenn man so möchte, kalt erwischt.«84
Noch gab es Infizierte fast nur in China. Einreisekontrollen wären eine wirksame Präventionsmaßnahme gewesen, um rechtzeitig den Import der Infektion zu verhindern. Im zweiten Schritt wäre die rasche Testung aller Menschen mit den bekannten Symptomen und im Fall eines positiven Befundes die Quarantäne aller Kontaktpersonen angezeigt gewesen, zieht Alexander Kekulé, Epidemiologe und Virologe an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, Bilanz.85 Einige Handvoll Infektionen ließen sich so gut in Grenzen halten, und auch die Tests waren bereits ab Ende Januar in Europa verfügbar.
Anfangs ist das auch geschehen. Am 28. Januar werden Mitarbeiter eines Auto-Zulieferers in Bayern positiv getestet, nachdem eine aus China angereiste Expertin ihnen in Workshops in Vierergruppen neues Know-how vermittelt hat. Die Kontaktpersonen der ersten Covid-Fälle in Deutschland waren rasch identifiziert, die Symptome relativ harmlos. Eine dieser Betroffenen besucht zwei Tage später eine Berghütte im Tiroler Kühtai und hat dort niemanden angesteckt, obwohl sie zwei Nächte mit 24 anderen Menschen auf engstem Raum verbrachte.86
Die Experten beginnen sich über Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten auszutauschen, aber mit Augenmaß: »Die Gesamtabschirmung von Wuhan ist in Europa weder umsetzbar, noch dürfte sie wirklich sinnvoll sein«, sagt Niki Popper, dessen Wiener Institut in der Folge die Modellberechnungen für den Lockdown in Österreich erstellen sollte, noch am 26. Januar.87
Auch Ende Februar scheint die Epidemie unter Kontrolle zu sein. Aber als erstmals zahlreiche Fälle in Norditalien registriert werden, werden auch die Warnungen lauter. Das Immunsystem der Menschen kennt das Virus nicht, es gibt keine Abwehr dagegen, auch speziell wirksame Medikamente oder Impfungen sind nicht vorhanden. »Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit«, lässt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité am 28. Februar über die dpa verlauten. Entscheidend sei das Tempo der Ausbreitung. »Das kann durchaus zwei Jahre dauern oder sogar noch länger«, sagt er weiter. Problematisch werde das Infektionsgeschehen vor allem, wenn es in komprimierter, kurzer Zeit auftrete. »Darum sind die Behörden dabei, alles zu tun, um beginnende Ausbrüche zu erkennen und zu verlangsamen.« Die benötigte Zahl der Therapiebetten auf den Intensivstationen könne man schwer vorhersagen, aber, »wenn wir jetzt nichts tun, dann werden die vielleicht nicht ausreichen«.88 Angela Merkel übernimmt Drostens Prognose, dass zwei Drittel der Deutschen infiziert würden, samt den Folgen für die Kliniken. Ein Ruck geht durch die Politik.
In den letzten Februartagen gibt es erste größere Cluster in Italien, es werden in fast allen Ländern größere Veranstaltungen im Freien und die meisten Veranstaltungen in Innenräumen untersagt und die Menschen aufgerufen, Hygieneregeln und Abstand einzuhalten.
Am Aschermittwoch, es ist der 26. Februar, berichtet die WHO von weltweit 81.109 bestätigten Fällen von Covid-19, davon erst 2918 außerhalb von China, wo die Zahlen bereits zurückgehen und mehr als 30.000 Betroffene schon wieder gesund sind. In Europa ist Italien mit 322 Fällen am stärksten betroffen, 18 gibt es in Deutschland, 13 in Großbritannien, zwölf in Frankreich und zwei in Österreich.89
TV und Printmedien haben längst ein neues Hauptthema, im Stil von Kriegsberichten wird von nun an täglich und über Monate von neuen Superlativen an Opferzahlen, neuen Ansteckungswellen und Krisen in Spitälern oder anderen Strukturen berichtet. Und die sozialen Medien kochen über vor aufgeregten Horrorprognosen und Ausgrenzung von »Panikmachern« respektive »Verharmlosern«. Virologen wie Christian Drosten werden zu Popstars der »Vernunftpanik«, wie Sascha Lobo die Stimmung beschreibt, und treiben mit millionenfach gesehenen Podcasts die Politikerinnen und Politiker vor sich her.
»Wir wurden damals beauftragt zu berechnen, wie viele Klinikbetten in Wien im Worst Case gebraucht werden«, erinnert sich Niki Popper, »da mussten wir natürlich die Annahme von Professor Drosten als Grundlage nehmen.«90 Die gängige Annahme: Verdoppelung der Zahl der Infizierten innerhalb von drei Tagen, 20 Prozent der Infizierten müssen ins Krankenhaus, 5 Prozent in die Intensivstation, und 3 Prozent sterben.91 Dann braucht es in Wien 6500 Klinikbetten nur für Covid-19-Patienten, fast die Hälfte der 14.000 vorhandenen Spitalsbetten. Die Betten wurden frei gemacht, Operationen verschoben, zusätzlich 800 Betten in einer Halle des Messegeländes aufgestellt. Um Katastrophen wie in Italien zu verhindern, wo sich das Virus über Wochen unbemerkt in den Intensivstationen verbreitet hat, werden in Wien sicherheitshalber ca. 1000 Patienten, die mit Lungenentzündung oder ähnlichen Atemwegsinfektionen im Krankenhaus liegen, getestet – prompt wird einer von ihnen, ein älterer Rechtsanwalt, als erster Covid-Patient ohne Auslandsbezug identifiziert. »Damals waren aber in Ischgl sicher schon viele infiziert«, weiß AGES-Experte Franz Allerberger.92 »Leider wurde ein derartiges proaktives Vorgehen nur von den Wiener Behörden gewählt.«
Die Behörden in Ischgl reagierten, wenn überhaupt, mit Ignoranz. Und dann werden viele Tausend, die Kontakt zu Infizierten hatten, aus den Tiroler Skigebieten statt in Quarantäne einfach quer durch Europa nach Hause geschickt. »Im Februar haben wir das Fenster verpasst, das Virus einzudämmen, mit intensivem Testen und der Quarantäne für alle Kontaktpersonen, wie es die Südkoreaner und Taiwanesen getan haben«, resümiert Medizinstatistiker John Ioannidis von der Stanford University.93 Im Gegensatz zu China, Taiwan oder Südkorea, wo seit der SARS-1-Epidemie 2002 das Personal der Gesundheitsbehörden spezielle Schulungen im raschen Finden von Kontaktpersonen von Infizierten absolviert hat, sind die Behörden nicht vorbereitet und reagieren anfangs träge.
Bei mehr als etwa 200, 300 neuen Infektionen pro Tag in einer Region ist eine rasche Eingrenzung ohne gut geschultes Personal kaum möglich. Dann geht es nur noch um Schadensbegrenzung in der Infrastruktur und im Gesundheitswesen. Immerhin werden in Deutschand und Österreich Menschen, die den Verdacht haben, infiziert zu sein, dringend gebeten, daheimzubleiben und telefonisch Rat zu suchen, statt in die Spitalsambulanz zu gehen. Das verhindert Infektionswellen innerhalb des Medizinbetriebs.
Anfang März schnellt in den Tiroler Skigebieten, in Skandinavien und in Deutschland die Zahl der positiven Testergebnisse sprunghaft in die Höhe – zunächst hauptsächlich unter Urlaubs-Heimkehrern aus dem »Ibiza der Alpen«, dann in Deutschland auch in der Folge einiger Karnevalsumzüge. Gleichzeitig gibt es die ersten drastischen Berichte aus Norditalien, wo die Infektionswelle erst erkannt wird, als sie bereits Patienten in den Intensivstationen und das Klinikpersonal erreicht hat.
»Ganz Deutschland stillzulegen, das ist ein sehr gewagter Versuch«, sagt Virologe Kekulé Mitte März. Aber dieses Experiment startet gleichzeitig in den meisten Staaten Europas. Nachdem Israels Premier Netanjahu am 9. März das Land komplett abriegelt und radikale Ausgangssperren ankündigt, verkündet Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am 13. März den absoluten Lockdown für den 16. März. An diesem Tag verhängen auch Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen, Dänemark, Finnland, die Niederlande und die Schweiz das Ende der bürgerlichen Freiheiten in einem nie dagewesenen Ausmaß. Deutschland und Großbritannien folgen eine Woche später.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.