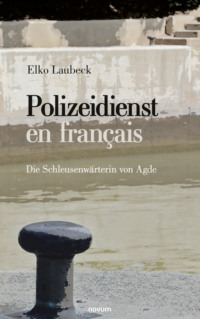Kitabı oku: «Polizeidienst en français», sayfa 4
11.
Mittlerweile war es Zeit für eine kurze Mittagspause. Moulin und Pocher kamen bei einem Snack in einer Bar direkt gegenüber der noch abgesperrten Fundstelle am Ufer des Hérault ins klärende Gespräch. „Also, willkommen im Hérault“, sagte Moulin. „Eigentlich haben wir in Frankreich strenge Hierarchien und Aufgabenteilungen bei der Polizei, aber wir sind hier weit weg von Paris, und für die tägliche Arbeit ist es einfach effektiver, wenn wir auch persönlich einen guten Draht zueinander haben.“
Die Serviererin brachte je ein aufgebackenes Croque Monsieur an den Tisch und je einen Grand Crème.
„Auch Renée, unsere Team-Leiterin, ist ganz in Ordnung. Sie kennt die Stärken und Schwächen der Kollegen. Aber wenn man bei ihr nicht in kurzer Zeit auf einen zündenden Gedanken kommt, um einen Fall weiterzubringen, kann sie auch mal nervös werden. Und dann knirscht es im Getriebe.“
„Prima“, sagte Pocher. „Und wie sieht es im Privaten aus? Ich meine: Hat jeder nach Feierabend seine eigene Familie und so, oder trifft man sich auch noch mal außerhalb des Dienstes?“
„Das ist, glaube ich, ziemlich ausgewogen. Klar hat jeder seinen privaten Bereich, aber wir kennen uns gut genug. Manchmal weiß man ja gar nicht, wann Feierabend ist und wann Dienst. Aber wenn jemand privat zum Beispiel Sorgen hat oder irgendwelche Probleme, dann spürt sie das sofort. Am besten, man spricht mit ihr darüber. Sie kann eine große Hilfe sein. Übrigens: Sie ist in Psychologie geschult und hat einen entsprechenden Blick für so was.“
Sie plauderten noch eine Weile über Belanglosigkeiten, aßen ihren Imbiss und schlürften den Kaffee, sprachen über das Wetter. In Südfrankreich herrschte eine trockene Hitze, aber im frischen Nordwestwind war das gut auszuhalten. „Der Wind weht schon seit vier Tagen“, sagte Moulin, „dann bleibt das Wetter die ganze Woche so, Sonne pur, aber das hat einen großen Nachteil: Der Wind weht nämlich das warme Wasser an der Meeresoberfläche aufs offene Meer hinaus. Und von unten kommt das kalte Wasser hoch. Das Mittelmeer ist dann zwar schön sauber, aber auch eiskalt.“
Dadurch würden Tausende von Touristen an den Stränden um ihr Badevergnügen gebracht. Die würden dann die Gelegenheit nutzen, um andere Sachen zu machen, zum Beispiel durch die Gassen der alten Städte hier zu streifen. „Guck dich um“, sagte Moulin, „obwohl Strandwetter ist: Agde ist voll von Touristen, Familien mit quengelnden Kindern. Wenn der Wind von Süden käme, hätte das Wasser 23 oder 24 Grad, und alle Touristen wären am Strand von Cap d’Agde, und die Väter würden ihren kleinen Kindern im flachen Wasser das Schwimmen beibringen.“
Just in dem Moment zog eine junge Familie an dem Café vorbei, die Eltern schleiften offenbar zwei quengelnde Kinder hinter sich her, die nur zu beruhigen waren, indem ihnen ein Eis in die Hand versprochen wurde. Pocher glaubte, dass es Briten waren, nachdem er einige Wortfetzen vernommen hatte, sie schienen jedenfalls Moulins Beobachtungen zu bestätigen. Auch eine Sichtweise auf die geschichtsträchtige Stadt und den Strand am Mittelmeer, dachte sich Pocher.
„Hat der Wind einen Einfluss auf die Strömungsverhältnisse hier im Hérault?“, wechselte Pocher das Thema.
„Nein, nur marginal“, meinte Moulin. „Das Mittelmeer ist noch ein paar Kilometer weit weg, das kalte Wasser kommt nicht bis hierher. Dass der Tote vom Mittelmeer aus hierhergetrieben worden wäre, ist bei den Windverhältnissen absolut ausgeschlossen.“
„Ich habe ja die Rundschleuse in Verdacht“, kam Pocher auf das berufliche Gespräch zurück. „Die Schleusenwärterin will nichts gesehen oder bemerkt haben, aber irgendetwas stimmt da nicht. Wir werden sehen“, gab er sich dem neuen Kollegen gegenüber ganz zuversichtlich.
Sie brachen auf Richtung Place René Subra. Mit Stunden Verspätung erreichte also Gerd Pocher seinen vorläufigen Arbeitsplatz, die Polizeistation in Agde. Renée Lebrun hatte einen Raum als Besprechungszimmer vorbereitet. „Ah, da seid ihr ja, Pierre, und der neue Kollege aus Deutschland. Willkommen in Languedoc-Roussillon! Die Leichenkiste steckt noch im Stau, genau wie Riquet. Deshalb ist er mit der Analyse auch noch nicht weiter. Alles, was wir haben, sind bisher die Wasserleiche und der Fundort.“
An einer Pinnwand hingen die ausgedruckten Fotos von der Wasserleiche und vom Fundort. Daneben waren entsprechende Farbnadeln in den Stadtplan eingespießt.
„Mord, Totschlag, Selbstmord oder ein dummer Unfall, wir wissen es nicht“, sagte Lebrun. „Die Fotos sind an alle Polizeistationen rausgegangen.“ Lebrun hatte blonde, leicht gewellte Haare, war schätzungsweise Mitte vierzig, sie erinnerte Pocher ebenfalls etwas an seine Frau beziehungsweise Noch-Frau. Sie trug eine weiße Bluse, die eher aussah wie ein Herrenhemd, über einem dunkelblauen Rock. Die Beine steckten in unscheinbaren braunen Schuhen. Sie war schlank, machte einen sportlichen, durchtrainierten Eindruck.
„Ach ja“, schwenkte sie plötzlich um, „wir haben uns ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Eigentlich sollten Sie sich heute Morgen hier einfinden, und wir waren bei der Wasserleiche. Wir sind hier im Team unter uns, nennen Sie mich Renée. Ich meine, nenne mich Renée. Geht das in Ordnung?“
„Klar“, antwortete Pocher, „Gerd!“ Es sei zwar anders gelaufen, als er es erwartet hatte, aber dafür sei er ja hier. „Die Arbeit geht vor. Ich bin nicht ins Hérault gekommen, um Urlaub zu machen und den französischen Kollegen untätig bei der Arbeit zuzuschauen.“ Er wolle mit anpacken.
„Gut“, sagte Renée. „Moulin, du fährst jetzt an den Strand. Du hast es deiner Familie versprochen. Feierabend für heute! Ich fahre noch nach Montpellier, um an die Ergebnisse der Autopsie zu kommen. Das dauert mir hier zu lange. Und wo bist du untergebracht?“, wandte sie sich an Pocher. „Über die weiteren dienstlichen Einzelheiten sprechen wir in den nächsten Tagen, Dienstvorschriften, Waffenrecht und so weiter.“
„Ich habe vorerst ein Zimmer im Hotel gegenüber vom Bahnhof“, sagte Pocher. „Ich schaue mir noch einmal die Schleuse an, die liegt quasi auf dem Weg zum Hotel. Ich habe da einen Verdacht, dass die Wasserleiche womöglich daher kam.“
„Gut möglich“, sagte Renée noch, als sie ihre Handtasche schulterte und den Raum verließ. „Morgen sind wir ein Stück weiter.“
Pierre nahm einen kleinen Rucksack, warf ihn über eine Schulter und bedeutete Gerd, das Gebäude mit ihm zu verlassen. „Feierabend. Was Renée gesagt hat, stimmt. Ich muss heute noch mit den Kindern an den Strand. Das ist nicht weit von hier.“
„Aber zieht euch warm an, wenn ihr ins Wasser geht“, scherzte Gerd.
„Soll ich dich noch ins Hotel bringen?“, bot sich Pierre an.
„Nein, danke, ich gehe lieber zu Fuß. Ich habe ja noch nicht viel von Agde gesehen.“
Diese Art von Fürsorgepflicht hatte ihn tief beeindruckt. Dass Renée Lebrun Pierre daran erinnert hatte, dass es private Verpflichtungen gab, die wichtiger waren als dienstliche Dinge, hatte er nicht erwartet. In Köln hatte es so etwas während seiner langen Dienstzeit nicht gegeben. Familiäre Verpflichtungen oder private Krisen waren von den Kollegen und Vorgesetzten nicht wahrgenommen worden. Der Dienst hatte niemals Rücksichten gekannt. Natürlich hatte er frei bekommen, als er geheiratet hatte, auch an den Tagen, an denen seine Kinder geboren wurden, aber er hatte sich nie darauf verlassen können, dass er pünktlich Feierabend bekommen würde, wenn er sich etwa mit seinen Kindern zu einem Nachmittag im Schwimmbad verabredet hätte oder wenn er eine Mittagspause einlegen wollte, um sie von der Schule abzuholen.
Pierre hatte Renée am Vortag darum gebeten, heute etwas früher Feierabend zu machen, um noch mit seinen Kindern an den Strand gehen zu können. Über die turbulenten Ereignisse des Tages hatte er es beinahe vergessen, wenn nicht Renée ihn daran erinnert hätte.
12.
Hinter der Hérault-Brücke folgte Gerd einem unbefestigten Fußweg entlang des Stichkanals zur Rundschleuse. Der Kanal im Schatten der Bäume war ruhig, eine Strömung war nicht auszumachen. Eine Entenfamilie zog ihre Bahn. Ansonsten fiel Pocher nichts Verdächtiges auf.
Er ging am Schleusenhaus vorbei bis auf die Brücke über den Canal du Midi und beobachtete Michelle Reynouard, die in ihrer eigentümlichen Gelassenheit zwei Schiffe vom Canal du Midi her hereinfahren ließ, ganz langsam verteilten sich die beiden Hausboote an den runden Schleusenwänden und machten fest. Die Schleusenwärterin hatte die Arme unter der Brust verschränkt und beobachtete das nautische Geschehen. Dann lief sie zum kanalseitigen Schleusentor und beugte sich weit darüber, um unter der Brücke hindurch nachzuschauen, ob sich vielleicht noch ein weiteres Boot der Schleuse näherte. Dabei spreizte sie ihr Spielbein weit nach hinten in die Luft.
Wie gebannt betrachtete Pocher ihren Rücken aus der Vogelperspektive, denn er stand auf der Brücke nur wenige Meter entfernt über ihr. Wieder war es ihm, als ob ihm diese Figur irgendwie vertraut vorkam, ihre Konturen, ihre Art, sich zu bewegen, als hätte er sie schon einmal gesehen. Dann schritt sie mit leicht hüpfendem Schritt zurück zu einem Schaltkasten und drückte einen Knopf. Die beiden Torflügel setzten sich langsam in Bewegung und schlossen sich. Michelle Reynouard umrundete die Schleusenkammer und beobachtete die beiden Boote, ob sie sicher festgemacht hatten. Unmerklich stieg der Wasserspiegel um etwa dreißig Zentimeter. Flink war sie die Treppe angestiegen, die zu dem höher gelegenen Tor Richtung Hérault führte.
Die beiden Torflügel öffneten sich nun langsam. Mit verschränkten Armen und leicht gespreizten Beinen stand sie da und ließ die Boote langsam unter sich vorbeiziehen in Richtung Hérault. Die Freizeitkapitäne winkten ihr im Vorbeifahren zu.
Pocher betrat nun wieder das Schleusengelände, wünschte der Schleusenwärterin einen guten Tag und wollte von ihr wissen, wie die Schleuse funktioniert.
„Oh, Monsieur. Das ist das Einfachste auf der Welt. Also, in diese Richtung verläuft der Canal du Midi Richtung Toulouse, na ja, erst einmal Richtung Béziers. Der liegt ungefähr einen Meter über dem Meeresspiegel.“ Sie deutete mit dem Arm in Richtung der viel befahrenen Straßenbrücke. „Also, die Boote kommen aus dem Kanal in die Schleuse. Dann wird das Tor geschlossen, mit Elektroantrieb. Dann werden die Schütze des oberen Tores geöffnet, die sind unter der Wasseroberfläche. Das Wasser des Hérault füllt die Schleusenkammer auf, bis sie auf gleichem Niveau ist. Normalerweise ist der obere Hérault 1,50 Meter über dem Meeresspiegel, aber in trockenen Sommern ist es manchmal auch etwas weniger.“
Sie lächelte. Pocher nickte, natürlich wusste er im Prinzip, wie eine Schleuse funktioniert.
„Das besondere dieser Schleuse ist das dritte Tor.“ Sie drehte sich zu dem Tor Richtung Stichkanal zum unteren Hérault. „Im Bedarfsfall können Boote auch heruntergeschleust werden, praktisch auf Meeresniveau. Durch den Stichkanal gelangen sie in den unteren Hérault und damit zum Mittelmeer. Und alles natürlich auch in umgekehrter Richtung.“
Die Rundschleuse von Agde sei die einzige ihrer Art in ganz Frankreich, sagte sie. „In den 1970er-Jahren wurde sie vergrößert, um auch längeren Schiffen die Möglichkeit der 90-Grad-Drehung in der Schleusenkammer zu ermöglichen. Aber im täglichen Geschäft spielt dies nur eine untergeordnete Rolle. Die allermeisten Boote bleiben auf dem Canal du Midi.“
„Wann war denn das letzte Mal das Schleusentor in Betrieb?“
Am Sonntag sei das gewesen, sagte sie. „Am Mittwoch und am Sonntag gibt es zwei Ausflugsboote, die vom unteren in den oberen Hérault fahren und wieder zurück. Sonst kommt es nur alle paar Wochen vor, dass ein Privatboot rauf oder runter möchte. Das muss dann auch vorher angemeldet werden, und die vielen Charterboote, die die Mehrzahl der Schleusenpassagen ausmachen, dürfen nicht runter in den Hérault Richtung Mündung.“
Plötzlich tauchte ein Boot auf, das sich langsam vom oberen Hérault herkommend in die Schleusenkammer schob. Es machte an der gegenüberliegenden Seite fest.
„Entschuldigen Sie“, sagte die Schleusenwärterin und ging leichtfüßig die Treppe hinauf und spähte auf den oberen Hérault, ob sich noch weitere Boote der Schleuse näherten. Offensichtlich kamen aber keine Boote nach. Sie ließ das obere Schleusentor schließen und hüpfte die Treppe hinab. Während die Leute an Bord des Bootes offenbar Mühe hatten, das Hausboot an der Schleusenwand seemannsgerecht festzumachen, schritt Michelle Reynouard scheinbar vergnüglich zum Schleusentor Richtung Canal du Midi. Pocher folgte ihr.
„Ich lasse jetzt per Knopfdruck das Wasser ab in den Kanal“, sagte sie. „Das dauert natürlich einige Minuten.“ Ihr brauner, leicht gewellter Pferdeschwanz flatterte etwas im Wind, eine Locke tanzte auf ihrer Stirn. „Alles hier geht sehr, sehr langsam.“ Sie nahm kurz ihre Sonnenbrille ab. Ihre dunklen Augen waren weit geöffnet, als sie Pocher wieder ins Gesicht blickte und mit den Schultern zuckte, als ob sie sagen wollte: das sei eben so, schneller gehe es nicht.
Sie versteckte ihre Augen wieder hinter den dunklen Gläsern der Brille. Für einen Moment hatte sie schweigend ihren Mund leicht zugespitzt geöffnet. Es war, als ob ihr ein leiser Seufzer entfuhr, und Pocher bemerkte, dass ihre Unterlippe erregt bebte.
Als das Wasser in der Schleusenkammer auf Kanalniveau war, verfiel sie wieder in ihre Arbeitsroutine, drückte einen Knopf an dem Schaltkasten, die Tore öffneten sich langsam, sie gab der Bootsbesatzung Handzeichen, dass sie weiterfahren könnten. Die Bootsleute machten die Leinen los und mussten einige Male vorwärts und rückwärts bugsieren, bis sie das Boot um einen vorstehenden Winkel herum in einen sicheren Kurs Richtung Schleusentor kriegten. Aber dann fuhr das Boot einigermaßen geradlinig durch das Schleusentor und verschwand unter der Straßenbrücke, ganz langsam.
Die Schleusenwärterin lächelte Pocher an. „Sie sind aber nicht von hier. Ihrem Akzent nach würde ich tippen, Sie sind Deutscher.“
„Pocher“, antwortete er, „Gerd Pocher.“ Richtig, er sei Deutscher und erst den zweiten Tag in Frankreich. Michelle Reynouard musterte ihn noch einmal. Sie nahm die Mütze vom Kopf, löste den Pferdeschwanz auf und schob die Sonnenbrille auf die Stirn.
Er trug eine Jeans, schlichtes Schuhwerk und ein weißes Polo-Shirt. Pocher war 50, einigermaßen schlank, hatte mittellange Haare, die bereits deutlich von Dunkelblond nach Weißgrau changierten. Sein Gesicht war inzwischen sichtlich gerötet, einen Tag lang der sengenden Sonne am Mittelmeer ausgesetzt.
13.
„Ich mache jetzt Feierabend“, sagte die Herrscherin über die Schleuse von Agde. „Um 19 Uhr wird die Schleuse geschlossen.“
„Bien“, sagte Pocher, „ich habe auch Feierabend. Darf ich Sie auf einen Apéritif einladen?“ Nun schaute sie ihm doch etwas verdutzt in die blauen Augen, schien kurz zu überlegen und sagte dann: „Pourquoi pas?“ Sie verschwand kurz im Schleusenwärterhaus und kam wieder heraus. Sie hatte sich Sportschuhe angezogen und eine Handtasche geholt, ansonsten blieb es bei dem T-Shirt mit dem dezenten Logo des Wasserstraßenamtes VNF und dem knappen Höschen. So zogen sie die Straße hinunter und bogen in die Rue de la Digue ein. Pocher erzählte von seiner Mission im Rahmen des Austauschprogramms und davon, dass er am ersten Arbeitstag mitten in die Ermittlungen in dem Fall mit der Wasserleiche geraten sei.
„Aber jetzt erzählen Sie mal, wie eine so ausgesprochen hübsche Frau wie Sie als Schleusenwärterin arbeitet“, sagte Pocher, als sie mittlerweile auf der Terrasse des Hotels L’Avenue Platz genommen hatten. Die Kellnerin brachte zwei Gläser Weißwein. Sie stießen miteinander an.
„Oh, das ist eine lange Geschichte“, antwortete Michelle Reynouard. Sie wirkte etwas verlegen. „Offen gestanden, ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es ist ein guter Job. Ich mache das jetzt seit drei Monaten.“ Die Schleuse in Agde sei irgendwie schon faszinierend, es gehe so gelassen zu, so langsam, und dennoch sei beim An- und Ablegen höchste Konzentration gefordert. Sie blickte Pocher in die blauen Augen und senkte dann ihr Haupt. Nein, am Ende sei es nicht ihr berufliches Traumziel gewesen, es sollte nur eine Übergangslösung sein, bis sie etwas anderes finde, vielleicht doch noch ein Studium, aber nun habe sie die Schleuse in ihr Herz geschlossen.
Ihre Eltern hätten wohl gerne gehabt, dass sie eine Akademikerin geworden wäre, mindestens Lehrerin, besser noch Ärztin. Aber das sei als heranwachsendes Mädchen nicht ihr Ding gewesen. Sie sei lieber auf dem Fußballplatz gewesen. „Ich habe Kampfsportarten gemacht, Kungfu und so, da war ich sogar richtig gut darin, na ja, da war ich 15 oder 16.“
Sie verstummte für eine Weile. Beide beobachteten das Treiben auf dem belebten Bahnhofsvorplatz.
Pocher hob sein Glas, er überlegte, wie er dieser jungen Frau näherkommen könnte, er war wie berauscht von ihr und spielte in seinen Gedanken mit der Idee, sich augenblicklich in sie zu verlieben. Er versuchte den Faden wiederaufzunehmen. „Ich heiße übrigens Gerd mit Vornamen“, unternahm er einen nächsten Schritt. Eigentlich hatte er nicht wirklich damit gerechnet, aber sein Gegenüber erhob ebenfalls das Weinglas, neigte den Kopf kokettierend zur Seite. Der Hauch eines Lächelns ging über ihre Lippen. „Schön, sehr schön“, sagte sie.
Sie nippten am Wein und beugten sich über den Bistrotisch. „Als ich mit der Schule fertig war, habe ich auch nicht geglaubt, Polizist zu werden“, sagte Gerd. „Aber ich wurde einer. Nach der Grundausbildung habe ich angefangen, Jura zu studieren, aber dann, nach sechs Semestern, gemerkt, dass das Auswendiglernen von Gesetzen und Auslegungen nicht mein Ding war. Ich wollte etwas Praktischeres machen. Ich bin dann einfach in den Polizeidienst zurückgekehrt. Ich war übrigens zwei Semester in Südfrankreich, an der Uni in Nice.“
Er wollte nun wissen, wo sie herkam, wie sie zu der Stelle kam, ihre Vorgeschichte.
„Ist das jetzt ein Verhör?“, entgegnete Michelle.
„Nein, nein“, beeilte sich Gerd zu sagen. „Das interessiert mich wirklich. Du bist reizend, noch nie bin ich einer so bezaubernden Frau begegnet.“ Er war von sich selbst überrascht, so unverhohlen seine Sympathie zum Ausdruck zu bringen.
„Ich war 17 Jahre alt, als meine Eltern tödlich verunglückten“, sagte sie nach einer Pause. „Eigentlich war ich davon überzeugt, alt genug zu sein, um mich allein durchs Leben zu schlagen. Aber das war dann doch nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich hatte in dem Alter zwar kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, aber dann war es plötzlich doch sehr traurig, dass sie nicht mehr da waren.“
„O, das tut mir leid“, sagte Gerd. „Was ist passiert?“
„Sie waren auf dem Rückflug von Rio nach Paris. Jetzt liegen sie auf dem Grund des Atlantiks.“ Michelle stockte einen Moment. Gerd erinnerte sich, der Absturz einer Air-France-Maschine auf dieser Route hatte auch in Deutschland Aufsehen erregt.
Sie blickte Gerd prüfend an. Sie nahm wahr, dass er eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Vater hatte, mehr vom Wesen her als vom Aussehen. Auch ihr Vater hatte sich immer sehr aufgeschlossen und neugierig gegeben, gegenüber ihren Freundinnen und den ersten Jungs. Aber er war Regierungsbeamter gewesen, hatte viel Arbeit und wenig Zeit für die Familie gehabt.
„Ich habe die Schule vernachlässigt“, setzte Michelle ihre Erzählung fort, „und habe mich ins Pariser Nachtleben gestürzt, um den Verlust zu verdrängen, zu vergessen. Aber das kannst du nicht vergessen, weißt du?“ Sie war klug genug gewesen, um sich nicht vollkommen im Vergnügen zu verlieren. Immer wieder hatte sie sich aus der Gefahrenzone, in ein unstetes In-den-Tag-Hineinleben, in das Milieu von Drogen und Kriminellen abzugleiten, selbst befreit. Sie hatte zunächst bei ihren Großeltern bei Paris gelebt, die auf der einen Seite zwar großzügig waren, auf der anderen Seite aber auch ziemlich spießig. „Eben von vorgestern“, sagte sie, und plötzlich lächelte sie triumphierend Gerd an. „Die Verlockungen waren groß gewesen, aber ich habe nie Drogen genommen. Nicht einmal.“
Ausgestattet mit einer hinreichenden Waisenrente und Abfindungen von der Fluggesellschaft hatte sie zunächst keine finanziellen Probleme, als sie in jener Zeit versuchte, sich auf eigene Füße zu stellen. Sie konnte sich sogar ein kleines Appartement leisten, als sie mit 18 von den Großeltern wegzog. Außerdem hatte sie immer noch ein kleines Vermögen auf der Kante, durch den Verkauf des Nachlasses ihrer Eltern, zu dem unter anderem eine Segeljacht auf dem Mittelmeer gehörte.
Dann war sie mit einem jungen Mann zusammen, der an der Sorbonne Literatur studierte. Über ihn geriet sie ins Studentenmilieu, aber in eines, in dem Seminare und Vorlesungen nicht ganz so wichtig waren wie das Leben darum herum. Sie war mitunter mit in Vorlesungen und Seminare gegangen, obwohl sie nicht immatrikuliert gewesen war und auch kein Abitur gehabt hatte.
Sie hatte zu lesen begonnen, alles, was ihr über den Weg kam, die Klassiker, nicht nur französische Literatur, während andere Zeitgenossen sich nur noch mit ihren Smartphones abgaben. Dann waren sie einmal mit mehreren Freunden im Sommer im Süden für ein paar Wochen, im Hérault. Sie hatten mit ein paar Bekannten ein altes Haus in einem kleinen Dorf bezogen. Der Tagesablauf war immer gleich gewesen. Die jungen Leute schliefen bis zum Mittag und mussten sich dann mit den schlechtesten Plätzen an den Badestellen am Fluss zufriedengeben. Sie spielten Karten, einer bereitete das Abendessen vor, am Abend wurde im Haus philosophiert und dabei stets viel Rotwein getrunken. Die Beziehung zu Jean, ihrem damaligen Freund, war ausgerechnet hier in die Brüche gegangen.
„Non“, korrigierte sie sich selbst, „mittlerweile war ich ja mit Serge zusammen. Er war jeden Abend betrunken und schlief immer sofort ein. Die ganze Zeit haben wir uns nur voneinander entfernt, und ich habe dann einfach mit einem anderen Jungen geflirtet. Ach, ich hatte nur Beziehungen, die relativ kurz waren, ein halbes Jahr oder so dauerten. Das waren eigentlich ganz nette Jungs. Auch ein Kunststudent war darunter. Erst war es interessant und angeregt, dann wurde es fade, weil mich das nicht wirklich weiterbrachte. Wir gingen miteinander ins Bett und verloren uns dann wieder aus den Augen.“
Während die anderen nach dem Hérault-Ausflug nach Paris zurückkehrten, blieb sie einfach im Süden, weil ihr die Gegend zusagte. Sie war der Sorbonne überdrüssig geworden, ohne Immatrikulation. Paris, das Gewimmel in der Großstadt, die geschäftige Oberflächlichkeit in den Bars und bei privaten Treffen hatten sie am Ende nicht weitergebracht. Um sich selbst zu finden, war sie in der Gegend geblieben, um noch einmal von vorn anzufangen.
Sie hatte in Montpellier eine kleine Wohnung genommen und an einem privaten Lycée Aufnahme gefunden. „Es war eine Internatsschule. Ich habe nur noch gelernt. Ich wollte alles können, französische Grammatik, Mathematik, Englisch, Spanisch, Geographie, Philosophie, Physik. Die Lehrer haben mir dabei sehr geholfen. Sie hatten erkannt, dass es mir leichtfiel, das ganze Wissen aufzusaugen, das man für das Abitur braucht. Ich habe Mitschülern geholfen. Sie hatten mich akzeptiert, obwohl ich einige Jahre älter und in manchen essenziellen Dingen auch erfahrener war. Es war eine schöne Zeit, eine schöne Lebenserfahrung. Aber sie ging plötzlich zu Ende. Es gab eine große Abschlussfeier. Es war ein Freudenfest, denn wir hatten das Abitur bestanden, aber es war auch eine Abschiedsfeier.“
Gerd fasste ihre Hand, blickte sie staunend an.
„Die anderen gingen zu ihren Eltern zurück mit all ihren Plänen, dies oder das zu studieren. Und ich stand da, mit dem Baccalauréat in der Tasche. Ich wollte mich aber nicht sofort in den Hörsälen einer Universität wieder verlieren.“
Sie wollte irgendetwas Sinnvolles machen, arbeiten. Es war ein Zufall, dass die Wasserstraßenverwaltung einen Schleusenwärter in Agde suchte.
„So bin ich Schleusenwärterin geworden“, versuchte sie einen Schlusspunkt unter ihre Erzählung zu machen. „Seit drei Monaten lebe ich hier. Es ist schön. Man verdient zwar nicht viel, aber das Geld brauche ich auch nicht, ich bin bescheiden geworden, und ich habe einen verantwortungsvollen Job, der nicht weniger wert ist als deiner.“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.