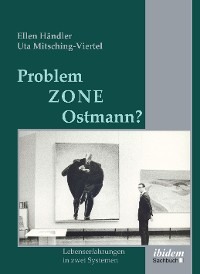Kitabı oku: «Problemzone Ostmann?», sayfa 5
Matthias, Jahrgang 1953 | 3 Kinder, verheiratet in zweiter Ehe
Ost: Dipl.-Ingenieur für biomedizinische Kybernetik, West: Oberbürgermeister von Potsdam,
Direktor für Ökonomie und Technik im Krankenhaus, Umweltminister und Ministerpräsident des
Umwelthygieniker, Minister in der Modrow*-Regierung Landes Brandenburg
Die Seele der Demokratie
ist die Liebe zum Kompromiss
Ich bin in Potsdam geboren und habe dort in der Berliner Vorstadt meine ersten 20 Lebensjahre verbracht. Wir haben in Potsdam in einer Gegend gewohnt, in der heute nur noch wenige alte Potsdamer leben, nämlich da, wo jetzt eher die Neupotsdamer zu Hause sind, es ist mittlerweile ein sehr teures Pflaster. Von meinen alten Nachbarn und Klassenkameraden wohnt so gut wie keiner mehr dort. Es ist auch damals ein sehr schönes Stadtviertel gewesen, war aber runtergekommen, wie alles in der DDR, aber so schön gelegen am Wasser zwischen Heiliger See und der Havel, gerade rüber vom Babelsberger Park, nicht weit von der Glienicker Brücke. Und wenn man als Kind Garten, Steg und Ruderboot hat, dann kann nur noch wenig fehlen. Es gab viele Nachbarskinder. Das Großwerden damals hatte einen gravierenden Unterschied zu heute, denn wir waren fast nur draußen. Ich kann mich erinnern, wenn wir abends nach Hause kamen, waren wir ausgepowert. Unsere Eltern mussten sich nie Gedanken darüber machen, wie sie uns beschäftigen können.
Meine Familie war für DDR-Verhältnisse eine sehr christlich-konservative. Meine Mutter Pfarrerstochter, mein Großvater einer der ersten Rundfunkpfarrer bei Radio DDR. Er hat dort oft die Morgenfeier sonntags um 9:00 Uhr gehalten. Mein Vater arbeitete am katholischen Krankenhaus in Potsdam als Arzt. Es ging uns gut, bürgerlicher ging's kaum. Wir hatten keine materielle Not, sondern eine sehr behütete Kindheit. Ich habe nur gute Erinnerungen. Ein Spezifikum unserer Kindheit war, dass um uns herum viele Russen in den Häusern lebten, weil der alliierte Grenzübergang Glienicker Brücke auf der Potsdamer Seite von Russen und auf der Westberliner Seite von Amis bewacht wurde. Nicht weit weg waren die Kommandantur und das russische Magazin, hier konnten wir einkaufen. All das prägt natürlich und gehörte zum Alltag. Das hat man gar nicht mehr bemerkt. Ich weiß aber auch, dass es sehr unterschiedliche Erlebnisse gab, denn nicht weit weg war das Gefängnis in der Leistikowstraße, wo u.a. der Bürgermeister von Potsdam 1952 verschwand und nie wieder auftauchte. Ich habe später, nach 1990, sein Grab auf einem Friedhof in Moskau besucht, er ist ermordet worden. Aber ich war damals Kind und zu uns Kindern waren die Russen immer sehr, sehr freundlich.
Ich habe zwei Schwestern und natürlich gab es den üblichen Streit zwischen Geschwistern, wir mögen uns aber bis heute sehr. In den ersten sechs Jahren besuchte ich in Potsdam die POS* Nadeschda Krupskaja*. Dann habe ich die Schule gewechselt. Walter Ulbricht hatte in den 1960er Jahren weiterführende Spezialschulen initiiert, denn er wollte der DDR einen technologischen Sprung verschaffen. Für seine Großforschungszentren, die er plante, benötigte er Leute, die eine fundierte mathematisch-physikalische Ausbildung hatten. Und so ließ er in jedem Bezirk eine sogenannte Spezialschule für Mathematik und Physik errichten. Und die für Potsdam war in Kleinmachnow, sie ist das heutige Weinberggymnasium. Um dort aufgenommen zu werden, musste man – und das war eine Novität – in der 6. Klasse eine Aufnahmeprüfung ablegen. Wir lernten dort von der 7. bis zur 12. Klasse. Diese Aufnahmeprüfungen waren schriftlich und mündlich und einige Tempoabfragen ganz schön heftig. Sie legten dabei sehr viel Wert auf logisches Denken. Es gab ein Internat, aber wir Potsdamer Schüler wohnten noch zu Hause, fuhren als Crew gemeinsam täglich mit dem Bus. Die Schule war richtig gut, die Klassen relativ klein. Die jungen und sehr gut ausgebildeten Lehrer haben sich viel Mühe gegeben. In den Hauptfächern Mathe, Physik und Chemie gab es geteilten Unterricht nur mit der halben Klasse. Das war sehr intensiv. Man kam permanent dran, konnte sich hinter niemandem verstecken. Wir hatten einen tollen Klassenlehrer. Allerdings war die Schule sehr jungslastig, für die Entwicklungsphase nicht ganz so schön. Aber das wurde dadurch ausgeglichen, dass in dem Gebäude noch eine normale Schule war. Wir legten schon in der 11. Klasse die Abiturprüfung ab. In der 12. Klasse bekamen wir Zusatzstoff. Von dieser guten Ausbildung habe ich lange gezehrt. Das erleichterte auch meinen Start im Studium deutlich. Ich habe biomedizinische Kybernetik und Bionik in Ilmenau an der heutigen Technischen Universität studiert.
Während der Schulzeit hatte ich mit meinem Vater viele intensive Debatten über sehr unterschiedliche Sichten auf die Welt, es waren sehr politische Diskussionen. Ich habe ihn bestimmt oft genervt, aber er hatte viel Geduld. Ansonsten haben wir uns immer gut verstanden. Das ist vielleicht so ein Reflex, wenn das Elternhaus konservativ ist, tickt man als 14- und 15-Jähriger erst mal anders. Dazu kam, dass ich die Schule gut fand und an den Sozialismus glaubte; mein Vater war aber anders drauf.
Am 21. August 1968* zum Beispiel, in den Schulferien, lag ich früh noch im Bett. Er musste aber ins Krankenhaus, riss die Tür zu meinem Zimmer auf und sagte: »Mach mal das Radio an, damit du hörst, was deine Kommunisten gerade in Prag anrichten.« Als ob ich daran schuld wäre. Andererseits hat er dafür gesorgt, dass ich alles erhielt, was es in der DDR zu lesen gab, Horizont, Sonntag, Junge Welt bis hin zur Neuen Zeit. Er kaufte das alles. »Du sollst alles wissen und irgendwann wird dir schon ein Licht aufgehen.« Hinzu kommt, dass meine beiden Großväter sehr prinzipientreu waren. Der eine aus Nordhausen, überzeugter Sozialdemokrat, ist 1933 arbeitslos geworden, war dadurch bis 1945 ein verfemter in Nordhausen, hat dort 1945 für den Landtag kandidiert, ist als Sozialdemokrat Chef der Arbeitsverwaltung geworden, Nachdem er sich mit Ulbrichts Leuten überwarf, war er ab 1952, 1953 wieder verfemt. Das prägt natürlich. Uns hat er als Kinder damals in den 1960er Jahren sehr beeindruckt. Zu seinem Geburtstag wollte sich die Kreisleitung*, weil er immer noch einen Namen hatte, wieder versöhnen nach dem Motto: »War ja alles nicht so gemeint« und stand mit einem Präsentkorb vor der Tür. Er hat durch seine Frau ausrichten lassen: »Ulbrichts Leute kommen mir nicht über die Schwelle, schick die wieder weg.« Meine Eltern erstarrten und wir Kinder waren über einen so renitenten Großvater stolz.
Ich habe meine erste Frau im Studium kennengelernt. Sie kam aus Thüringen und hatte auch diese Studienrichtung gewählt. Wir bekamen im letzten Studienjahr Zwillinge. Weil es noch keine Kita und Krippenversorgung gab, bekamen wir einen Sonderstudienplan und eine Studienverlängerung. Das Studium organisierten wir nach einer Art Wechselmodell. Immer einer blieb bei den Kindern, der andere ging zum Studium, und so wechselten wir uns ab. Das ging gut und hat dazu geführt, dass wir in dieser Zeit sehr intensiv mit den Kindern zusammen waren. Später zogen wir über die Absolventenvermittlung nach Karl-Marx-Stadt. Der Anreiz war, dass es dort eine Vierraumwohnung gab. Ich fand im Bezirkshygieneinstitut Arbeit im Bereich der Lufthygiene. In Karl-Marx-Stadt ist unsere dritte Tochter geboren, die heute in Schweden lebt und noch ganz stolz ist, dass in ihrem Ausweis als Geburtsort Karl-Marx-Stadt steht. Damit kann sie die Leute immer sehr erheitern. Unsere Kinder waren dort leider sehr oft krank, Bronchialkatarrh, der HNO-Arzt sagte: »Kein Wunder, bei der Luft hier.« Es hieß nicht umsonst Ruß-Chemnitz*. Wir sind nicht mehr nach dem Kriterium Wohnungsgröße, sondern nach Luftreinheit umgezogen und fanden auf der Landkarte Bad Freienwalde. Dort konnten wir mitten im Wald wohnen. Ich hatte mich eigentlich im dortigen Kreiskrankenhaus als Medizintechniker beworben. Beim Einstellungsgespräch schlug man mir jedoch vor, Direktor für Ökonomie und Technik zu werden. In so jungen Jahren bin ich das geworden, weil das so weit draußen, jwd*, lag und kein großer Andrang war.
Dann zog es uns aber wieder nach Potsdam. Dort arbeitete ich von 1982 bis 1990 als Abteilungsleiter für Umwelthygiene. In den 1980er Jahren bin ich auch immer mehr zur Politik gekommen. Der erste und deutliche Riss in meinem an sich gut gefügten Weltbild kam 1976 mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Übrigens nicht, weil ich ein Fan seiner Lyrik oder Lieder gewesen wäre, sondern weil mich mein Land enttäuschte. Ich habe die Ausbürgerung als ein Zeichen von Schwäche gesehen, nach dem Motto: »Wenn man so einen nicht aushält, wie ist dann die innere Verfassung?« Einem zu verweigern, in sein Land zurückzukommen! Der endgültige Riss entstand für mich, als 1979 im Dezember die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte. In Prag hieß es noch: »Wir müssen hier in Europa den Sozialismus verteidigen.« Obwohl das auch vorgeschoben war. Aber der Einmarsch in Afghanistan war blanke Geo- und Machtpolitik und nichts weiter.
Nachdem meine Eltern ausgezogen waren, wohnten wir wieder in unserem Elternhaus in Potsdam, am Wasser. Das war sehr schön, vor allem für unsere Kinder. Nach unserer Scheidung habe ich eine Wohnung in Babelsberg gefunden und sie Ende der 1980er Jahre ausgebaut. In der Wohnung lebe ich heute noch. Hier saß ich oft mit Freunden zusammen; wir hatten damals irgendwie viel mehr Zeit als heute. Es gab weniger Ablenkung und wir saßen abends im Küchenraum, aßen, debattierten und tranken schlechten Rotwein, was wir aber damals nicht wussten. Und wir verbesserten dabei natürlich immer die Welt. Alle hatten zwei, drei oder vier Kinder und fragten sich, was werden uns unsere Kinder in zehn oder 15 Jahren einmal fragen, genauso wie wir unsere Eltern löcherten, was sie gemacht, wie sie sich verhalten hatten und ob sie alles geschehen ließen.
Auf der Basis solcher Diskussionen teilte sich in gewisser Weise unser Freundeskreis. Eine Spaltung in diejenigen, die sagten, wir sehen für unsere Kinder keine Perspektive mehr in diesem Land, das zerfällt, wird knöchern, Mehltau breitet sich aus. Das fühlte man. Die haben Ausreiseanträge gestellt, Botschaften mit besetzt, was damals so anfing. Die anderen, zu denen gehörte ich, protestantisch geprägt, sagten: »Da, wo man hingestellt ist, da sollte man bleiben.« Und wir wollten versuchen, was zu ändern. Einer unserer Freunde hatte 1987 gerade eine Abschlussarbeit über die Geschichte des Belvedere in Potsdam geschrieben. Ein Schloss, ohne Kriegsschäden, was völlig verfallen war, nur weil es mitten im russischen, abgegrenzten Teil lag. Außerdem konnte man von da oben nach Westberlin gucken, sodass man es wie das Dornröschenschloss zuwachsen ließ. Das war ein Kulturschatz. Also machten wir uns einfach daran, trafen uns jede zweite Woche am Wochenende, stellten die Parkanlage wieder her und dachten: »In 20 Jahren bauen wir das Ding wieder auf.« Das hat zur Gründung der ersten Interessengemeinschaft Pfingstberg* geführt mit 25 jungen Leuten, die sich immer wieder trafen und dort arbeiteten. Das Verrückte war, dass ich das bis heute als ein Zeichen empfinde, was in unserem Land eigentlich los war. Wir fühlten und verstanden uns nicht als Opposition im klassischen Sinne, sondern wir wollten was verbessern. Die Staatssicherheit hat daraus, »politisch negative Elemente« gemacht. Die sind ab und zu hochgekommen und haben komische Fragen gestellt. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Leute freiwillig und ohne Geld so etwas machten. Ein Teil dieser Truppe und andere junge Leute haben 1988 im April die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Stadtgestaltung in Potsdam gegründet. Das war schon etwas politischer gemeint. Bei mir kam hinzu, dass ich beruflich viele Daten für Boden, Wasser und Lärm hatte. Und wir stellten immer mehr fest, wie unsere Lebensgrundlagen den Bach runtergingen, wie die Bausubstanz unserer Heimatstadt teilweise unwiederbringlich zerfiel. Und dann sollte noch die barocke Innenstadt abgerissen und durch Plattenbauten ersetzt werden. Da haben wir, die ›Hierbleiber‹, gesagt: »Das kann es nicht sein.« Es war wie ein Signal. Die erste Straße ist ja auch noch abgerissen worden. 1989 konnten wir den Fortgang der Dinge stoppen. Bürger fingen an, sich zu artikulieren und zu wehren. Wir haben in dieser Arbeitsgemeinschaft im April 1989 ein erstes DDR-weites Treffen veranstaltet. Das war damals sehr mühsam. Es gab kein Internet, kaum Telefon. Über 20 Gruppen aus der ganzen DDR, die ähnliches gemacht haben, aus Schwerin, Erfurt, Leipzig, Dresden, hatten wir nach Potsdam eingeladen. Das erregte viel Aufsehen und wurde strengstens beobachtet. Daraus bildete sich ein Netzwerk, aus dem sich ein halbes Jahr später, im Herbst, die Grüne Liga* gründete. Meine erste Aufgabe in diesem Verbund war es, ein Informationsnetzwerk aufzubauen. Das sah man damals als sehr verdächtig an, weil nur der Staat verantwortlich für Information war und niemand anderes. Ihr Denkmodell war: »Wenn die Potsdamer glauben, dass es in ihrer Stadt bergab geht, ist das schon nicht gut. Wenn die aber erfahren und diskutieren, dass es in den 20 anderen Städten ähnlich läuft, dann wird daraus was Gefährliches.«
Die Dinge nahmen ihren Lauf. Wir haben am 7. Oktober 1989 zum 40. Jahrestag der DDR ein zweites DDR-Treffen angemeldet. Das ganze Dachgeschoss unseres Besprechungsgebäudes war von der Staatssicherheit besetzt, um uns zu beobachten. Das bekamen wir mit. Sie konnten aber das Zusammentreffen von Abgesandten aus den Städten nicht verhindern, obwohl sie es versucht hatten. Nur die Leipziger kamen nicht, denn die hatten zu Hause eine Menge mit der Vorbereitung der großen Demonstration am 9. Oktober zu tun. Unsere in der Nacht verfasste und von allen verabschiedete Erklärung hat die Oberen sehr beunruhigt, weil sie mit dem Satz begann: »In einem solchen Land wollen wir nicht länger leben.« Wir wollten immer noch einen anderen Sozialismus, an anderes wurde noch gar nicht gedacht. Die Resolution schafften wir nach Berlin zu dieser und jener Zeitungsredaktion. Später konnte man in den Stasiakten lesen: »feindlich negative Elemente heizten die Stimmung an.« Dabei war die Debatte so ernsthaft, so gründlich, so ehrlich, aber das war schon zu viel. Am 7. Oktober wurden in Potsdam bei einer Demonstration sehr viele, auch einige unserer Gäste, festgenommen. Es war brutal, sodass wir dachten: »Das kann es nicht sein, so kann es nicht gehen. Warum reden die nicht mit uns?« Wir waren alles junge Leute und keine doofen, arbeiteten alle. In diesen Tagen hat die DDR ihren letzten Kredit verspielt. Bei mir kam noch ein persönliches Ereignis hinzu. Ich hatte Freunde in Ungarn und die haben wir Anfang September besucht. Man konnte dort bereits freier atmen, offen debattieren und zum Beispiel alle denkbaren Zeitungen kaufen. Als wir in Budapest ankamen, summte und wimmelte es von DDR-Bürgern und abgestellten Trabants – keiner von denen wollte mehr nach Hause zurück. Der ungarische Außenminister Horn sprach am 10. September im ungarischen Fernsehen und unsere Freunde übersetzten: »Ihr könnt ab 24:00 Uhr mit euren Personalausweisen nach Österreich fahren.« Plötzlich standen wir vor einer grundsätzlichen Entscheidung, denn wir wussten ja nicht, ob wir jemals wieder zurückkommen konnten. Das hatte etwas von endgültigem Abschied. Erstmalig dachte ich so, mit Mitte 30, über den Begriff Heimat nach. Und da habe ich gesagt: »Nein, wir gehören da hin, wo wir hingehören.« Wir sind ins Flugzeug nach Hause gestiegen, das war fast leer, weil so viele geblieben sind.
Drei Tage später wussten wir, dass wir alles richtig gemacht haben, denn es fingen die Unterschriftensammlungen für das Neue Forum* an. Wir machten mit und waren am 4. Oktober auf dem Weberplatz in Babelsberg bei der ersten großen Kundgebung mit mehr als 3.000 Leuten dabei. Das war noch vor Berlin, vor Leipzig. Die Bereitschaftspolizei wusste, dass sie stattfindet, und wollte die Kundgebung auflösen, hatte allerdings nur mit 300 bis 400 Leuten gerechnet. Als die Meldung kam, dass bereits 3.000 Leute da waren, hat der Einsatzleiter die Leute in die Kaserne zurückgeschickt. Bei nicht wenigen Funktionären gab es da wohl schon die Gedanken im Kopf, dass es so nicht weitergehen könne.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Wir konstituierten im November die Grüne Liga*. Ich wurde einer ihrer Sprecher und an den Zentralen Runden Tisch in Berlin delegiert. Das war eine sehr spannende, eine sehr demokratische, aber auch sehr wilde Phase. Hier kam alles zusammen: die alte Macht und die noch nicht formierte neue Macht, die neuen Bewegungen und die alten Parteikader. Auf der dritten Seite saß Hans Modrow* mit seiner Übergangsregierung, irgendwie in einer schwierigen Zwitterstellung. Der Runde Tisch hatte drei sehr gute Kirchenvertreter als Moderatoren, die immer wieder dämpften und ordneten. Das war sehr bewegend, weil es über diesem Tisch eigentlich nur ein einziges übergreifendes gemeinsames Motto gab: einen Übergang ohne Gewalt und Blutvergießen zu schaffen. Alles andere war different, auch die Ziele. Das rechne ich heute Hans Modrow noch hoch an, dass er das mit organisiert hat. Es waren immerhin noch 400.000 Menschen unter Waffen in der DDR. Und das so zu regeln, nicht wie in Rumänien und anderswo, das fand ich eine beeindruckende Motivation, bei mir sicher auch geprägt durch meine Großeltern.
Der Runde Tisch lief noch, wir bereiteten die Wahlen vor. Dann kamen die Verhandlungen mit Hans Modrow, der dachte, ihm schwimme das Land langsam weg, als er sagte: »Das geht so nicht mehr. Ich erwarte von den neuen Bewegungen, dass sie sich an der Verantwortung beteiligen, sonst könnt ihr das ohne mich machen.« Modrow* hatte damals bei allen hohe Reputation, man wollte auf ihn nicht verzichten. Der Deal war, die für den Mai geplante Wahl in den März vorzuziehen und das Zugeständnis der Bewegung war, dafür mit in die Regierung zu gehen und Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin dann in den Westen gefahren, erst zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich im Dezember 1989 bei Klaus Töpfer in Bonn. Jetzt ging es an die Evangelische Akademie nach Tutzingen – in eine Traumgegend –, um mit Leuten wie Genscher und Brandt zu diskutieren. Ich freute mich sehr darauf. Man hatte einige DDR-Leute dorthin eingeladen, von denen man dachte, aus denen könnte mal was werden. Ich war ein großer Willy-Brandt-Fan, nun sollte ich ihn aus der Nähe erleben – für mich ein Hochamt. Bevor es losging, wurde ich dort aber an die Rezeption, ans Telefon geholt, denn Handys gab es ja noch nicht. Die junge Grüne Partei der DDR hatte angerufen. »Du musst zurückkommen. Wir haben beschlossen, dass jede Bewegung einen Minister stellen soll. Du sollst für uns Minister werden.« Da habe ich gesagt: »Nein, ich bin gerade angekommen, ich will Willy Brandt hören, versucht, wen anderes zu finden«, habe also rumgezickt. Hinter mir stand ein Journalist vom ZDF, der bekam das alles mit und sagte: »Ich weiß nicht, was dich bewegt, aber auf so einen Anruf wartet man im Westen 30 Jahre und muss dafür hart arbeiten.«
Ich bin zurückgeflogen, habe das schöne Seminar nicht mitgemacht und wurde am nächsten Tag in der Volkskammer vereidigt. Ich hatte noch nicht mal einen passenden Anzug, bin zu nichts gekommen. Vorher brauchte ich keinen, hatte also einen Pullover an. Im DDR-Fernsehen wurde das alles übertragen. Abends rief mich meine Mutter an. »Klar«, dachte ich, denn es war das erste Mal, dass aus unserer Sippe einer Minister wurde. Aber sie sagte nur: »Junge, musste das sein, im Pullover!«
Plötzlich war ich Minister ohne Geschäftsbereich, eine spannende Zeit, in der ich mich u.a. um umweltpolitische Belange kümmerte. Wir besuchten auch die neue Regierung in Polen. Was mich besonders beeindruckte, war, mit Hans Modrow* zu Gorbatschow nach Russland zu fahren. Ich war früher schon mehrmals dort, habe auch mal ein Austauschpraktikum gemacht. Aber was ich dann sah, hat mich erschüttert. Viele arme Menschen auf den Straßen, die Versorgung war inzwischen miserabel, man sah, wie die Menschen in den U-Bahnhöfen den eigentlich verbotenen Alkohol tranken, und der Schwarzhandel blühte. Man hatte das Gefühl, dass das nicht mehr lange gut geht. Ein Jahr später war es ja auch vorbei.
Am 18. März 1990 bin ich für die Grüne Partei in das erste und letzte freigewählte Parlament der DDR gewählt worden. Dass alle Bürgerbewegungen zusammen bei dieser Wahl nur auf fünf Prozent kamen, war ein Schock. Aber viele Menschen hatten sich längst auf einen anderen Weg gemacht, sie wollten die schnelle Wiedervereinigung. Und wir hatten den Draht zu ihnen verloren.
Letztlich bildeten das Bündnis 90, die Grünen, die Frauenbewegung und andere eine kleine Fraktion in der Volkskammer mit 20 Leuten. In ihr fanden sich herausragende Köpfe der friedlichen Revolution wie Wolfgang Ullmann oder Jens Reich*. Ich wurde zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt und gehörte so dem Präsidium der Volkskammer an.
Die Regierung unter de Maizière bildete sich und es waren fast alle Parteien vertreten, Liberale, SPD, CDU, DSU, aber zwei Gruppierungen nicht: die PDS* und die Bürgerbewegung. Die eigentlichen Antipoden der Revolution fanden sich also in der Opposition wieder. Ich saß in der Volkskammer neben Gregor Gysi und wir lernten uns dadurch gut kennen. Wir haben viel gearbeitet, viele Gesetze verabschiedet, hatten jeden Tag große Stapel auf dem Schreibtisch. Aber man merkte in Ansätzen, Stück für Stück, dass die Aufbauhelfer aus dem Westen nicht selten sagten: »Lasst uns das mal machen, wir wissen, wie es geht.« Bei uns merkte man das nicht so, aber bei anderen Parteien sehr wohl.
Die Volkskammerzeit war vorbei und wir mussten uns überlegen, was wir mit unserem gerade angefangenen politischen Leben weiter machen. Ich bin in den Bundestag kooptiert worden, fuhr nach Bonn und wusste schnell, egal, was du politisch mal machst: Bonn wird es nicht. Ich kam aus einer Stimmung im Osten mit täglichen Demonstrationen, die Luft brannte, nach der Währungsunion brachen die Betriebe zusammen, die Leute waren auf 180 und manchmal auf 200 – und in Bonn plätscherte ruhig der Rhein vorbei, alles ging seinen normalen Gang. Mein Gefühl war, dass man hier in einer anderen Welt lebte.
Wir, eine Crew aus der Volkskammerfraktion – Günter Nooke, Marianne Birthler und ich –, überlegten uns: »Wir gehen in unser Stammland Brandenburg und treten da in den Landtagswahlkampf ein. Wir machen Wahlkampf als Bündnis 90 für unsere Vorstellungen aus der friedlichen Revolution.« Wir verabredeten uns für den Wahltag abends in einem Café. Wir wollten uns verabschieden und jeder in sein berufliches Leben zurückgehen, nur eben nicht kampflos, sondern einen Schlusspunkt setzen. Dann kam das Wahlergebnis, und siehe da: Die Grünen, sie kandidierten gegen uns, kamen nicht in den Landtag, aber das Bündnis 90. Also mussten wir uns am Abend wieder umorientieren. Wir stellten eine Fraktion mit sechs Leuten im neugewählten brandenburgischen Landtag. Wir gingen in Koalitionsverhandlungen mit der SPD unter Manfred Stolpe und der FDP. Daraus wurde die erste Ampelkoalition von 1990 bis 1994 und ich wurde Minister für Umweltschutz und Raumordnung.
Jedes Bundesland hat ein Partnerland, wir Nordrhein-Westfalen. Und NRW hatte alles für Brandenburg durchgeplant. Vor allem das Personelle. Ich hatte mich als Umweltminister in den ersten Tagen nach einem Staatssekretär umgetan, der sich in der EU und ihren Regularien auskannte. Vor Monaten hatte ich jemanden kennengelernt, der Sekretär des Umweltausschusses des Parlaments war, wir verstanden uns, und ich fragte ihn, ob er nicht für vier Jahre Lust hätte, mein Staatssekretär zu werden. Er sagte zu, war allerdings in der CDU. Der frischgebackene Chef der Staatskanzlei holte mich zum Gespräch. Er wählte dabei schon den falschen Anfang: »So, junger Mann, nun setzen Sie sich mal.« Ich sagte: »In dem Duktus wollen wir mal nicht weitermachen, wir sitzen hier auf gleicher Augenhöhe.« Wahrscheinlich war ich ihm suspekt. Er sagte: »Du kannst es ja machen, wie du dir das politisch vorstellst, aber ein CDU-Staatssekretär in der SPD-Regierung, das geht gar nicht. Und außerdem haben wir da bereits jemanden vorgesehen.« Ich habe gesagt: »Mein Lieber, das kann alles sein. Ich berufe diesen Staatssekretär, und der Ministerpräsident muss entscheiden, ob er das anders will. Dann muss er sich aber einen anderen Minister suchen.« Ich habe den Staatssekretär berufen. Heute würde ich natürlich auch sagen, dass Parteibindung eine Rolle spielt. Damals war ich eben trotzig.
Meinen Startvorteil bildeten die gute Ausbildung in der DDR und acht Jahre Arbeit im Umweltschutz. Ich war also fachlich recht gut vorbereitet. Die 1990er Jahre waren vom ersten Tag an eine unheimlich spannende, aufregende Zeit. Wenn ich früh kam, wusste ich nie, was abends war. Die Zeit hielt für unzählige Menschen große Härten bereit. Wir haben oft im Kabinett besprochen, welche Betriebsschließungen wieder zu verkünden seien und wer dorthin fahren würde. Es war frustrierend, weil man als Politiker den Menschen Hoffnung geben will. Man musste zu vielen Gelegenheiten sagen: »Es tut mir leid, ich kann euch nicht mal sagen, dass etwas Neues entsteht.« Und wir sagten auch: »Wenn ihr noch jung seid, sucht euch im Westen etwas, hier wird so schnell nichts Adäquates da sein.« In dieser Zeit verlor ich einen Teil meiner Haare. Für Fragen von Umwelt- und Naturschutz war zwar die Zeit nicht geeignet, weil die Leute andere Sorgen hatten, andererseits konnten wir sehr viel für den Landschafts- und Naturschutz in Brandenburg tun, was in einer nur mit Juristen besetzten Verwaltung vielleicht gar nicht mehr so gelungen wäre. Damals ging das noch.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich zwei Systeme erlebt habe, weil das Leben sich in Relationen abspielt und der Mensch Alternativen braucht und sie kennen sollte. Da ich 35 Jahre in dem einen System und bereits 30 Jahre in dem anderen gelebt habe, fällt mir der manchmal nötige Perspektivwechsel nicht so schwer.
Das Fazit für mich ist klar: Ein System, das aus Menschen quasi per Verordnung bessere Menschen machen will, kann nicht funktionieren. Einer meiner Hauptvorwürfe an die DDR ist: Freiheitsbeschneidung und Kreativitätsbegrenzung. Das macht jedes Land am Ende kaputt. Damit hat man auch den Grundgedanken einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, Gerechtigkeit für alle, Verteilung der Güter nach Möglichkeiten und Bedürfnissen, kaputt gemacht. Ich schätze heute an unserer Gesellschaft sehr, dass sie Liberalität aufweist, dass Menschen so, wie sie sein wollen, es materiell auch sind, sein können. Ich schätze nicht, dass wir zunehmend zulassen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet und deshalb die Freiheitsmöglichkeiten, die die Gesellschaft bietet, viele gar nicht nutzen können. Ich finde den Grundgedanken einer sozialen Markwirtschaft richtig, zu balancieren, wie man die Triebkräfte der Gesellschaft voranbringt. Die Menschen brauchen die Möglichkeit, eigene Ideen anzugehen. Auf der anderen Seite muss eine Begrenzung da sein. Helmut Schmidt hat einmal gesagt: »Ein Kapitalismus, der keine Begrenzung hat und nicht kontrolliert wird, wird automatisch zum Raubtierkapitalismus.« Gesellschaftsorganisation unter freiheitlichen Bedingungen ist eine Sisyphusarbeit. Der Stein ist unten, du musst ihn wieder hoch rollen, dann rollt er wieder runter, und du musst ihn wieder hochrollen. Bis vor kurzem hatten wir die neoliberale Phase, zum Beispiel die Privatisierung vieler öffentlichen Güter. Vieles davon bereuen wir heute wieder. Es ist bedauerlich, dass wir so eine Phase immer wieder brauchen. Ich glaube, der Kapitalismus hat sich durch den gefühlten Mitbewerber, das sozialistische Lager, besser benommen, weil er wusste, dass er sich beweisen muss. Als das weg war, konnte man noch mal dem neoliberalen Affen richtig Zucker geben. Das hat sich nicht unbedingt positiv ausgewirkt.
Dass ich 1995 Sozialdemokrat wurde, war durch Vater und Großvater mitgeprägt. Mein Vater war mit seinen DDR-Erfahrungen an sich dagegen, dass ich in eine Partei gehe. Er sagte: »Aber wenn du das schon machst, versuche wenigstens, ihr Vorsitzender zu werden.« Habe ich versucht. Es hat im Land Brandenburg für 13 Jahre geklappt. Im Bund gab es leider gesundheitliche Begrenzungen. An der Sozialdemokratie finde ich so faszinierend, dass es, wie Willy Brandt einmal sagte: »Hier ein donnerndes Sowohl-als-Auch gibt.« Nichts Extremistisches, immer neu denken an den sich wandelnden Interessen möglichst vieler Menschen entlang – schwierig, aber sinnvoll.
Was mir in unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Moment fehlt, ist die Liebe zum Kompromiss. Wir sind sehr absolut geworden. Es gibt viele widerstrebende Interessen, und wenn Demokratie einen Sinn haben soll, hat sie ihn dann, wenn man aus den vielen Interessen versucht, am Ende einen Kompromiss zu formulieren, mit dem alle einigermaßen leben können. Der Hauptvorwurf, der immer gemacht wird, ist, dass das alles so lauwarm ist. Da entgegne ich als Naturwissenschaftler: Der Mensch lebt bei 37 Grad Körpertemperatur, bei 42 Grad ist er tot, bei 32 Grad auch.
Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass die Seele der Demokratie die Liebe zum Kompromiss ist. Bei allem, was ich jetzt mache, die Beziehungen zu unserem russischen Nachbarn im Deutsch-Russischen Forum zu pflegen, Aufgaben in der Kohlekommission oder in der Einheitskommission wahrzunehmen, versuche ich immer zu vermitteln. Das Leben spielt sich meist in der Mitte von allem ab. Wir müssen versuchen, uns diese Fähigkeit zu erhalten. Die Fähigkeit des Zuhörens- und Verstehen-Wollens nicht zu verlernen, ist nicht lapidar. Ich möchte, wenn ich in eine Diskussion gehe, danach an zwei, drei Stellen klüger geworden sein – sonst war es Verschwendung von Lebenszeit.