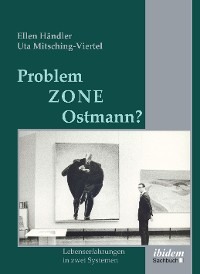Kitabı oku: «Problemzone Ostmann?», sayfa 6
Eduard, Jahrgang 1953 | 2 Kinder, verheiratet in erster Ehe
Ost: Gießereitechniker, West: Selbstständig, Inhaber einer Versicherungsagentur
Dipl.-Gießereiingenieur, Parteifunktionär
Geschäft und Geld sind im Westen
immer das Wichtigste
Ich bin Eddi, geboren 1953 in Döbeln in Sachsen. Heute lebe ich in einer anderen Stadt, aber auch in Sachsen. Ich bin verheiratet in erster Ehe und habe zwei Kinder. Nach der Grundschule machte ich eine Lehre als Gießereitechniker, arbeitete ganz normal in einem Betrieb, und bin nach fünf Jahren Fernstudium Gießereiingenieur geworden. In der Zeit als Technologe war ich in der FDJ* ehrenamtlich tätig. Ich bin zur FDJ-Kreisleitung* gegangen und wurde dort Sekretär. Ich war für die Arbeiterjugend zuständig. Nach zwei Jahren delegierte man mich zur SED-Kreisleitung* mit Zuständigkeit für Jugend und Sport. Später kam die Parteihochschule in Berlin dazu, und ich machte noch mal ein Direktstudium für drei Jahre. Das war kurz vor der Wende. Ich wurde zum sogenannten Kreisbeschleuniger* für den Kreis G. ernannt.
Ich war oft auf Foren, da wurde im Osten in den letzten Jahren auch über die Umwelt gesprochen. Vor allem bei jungen Leuten. Ebenso spielte die körperliche Arbeit eine größere Rolle. Sie war hoch anerkannt, vor allem der Arbeiter. Der hat auch mehr verdient. Als ich Technologe war, verdiente ich weniger als der Arbeiter, das war so gewollt. Alkohol wurde an allen Orten getrunken und war gesellschaftlich weit verbreitet – aus heutiger Sicht zu viel. Ich hatte damit kein Problem und lag so im Durchschnitt. Heute sieht man das bewusster. Ich liebe einen guten Rotwein, auch einen guten Kognak oder Whisky, aber zum Genießen und nicht zum Betrinken.
Man merkte, dass die Wende im Gange war. Es gab Demos, das Neue Forum* existierte und war sehr aktiv. Als das Sekretariat der Kreisleitung der SED zurücktrat, gab es eine große Versammlung, und es wurde über das Neue Forum geredet: Was das ist, was für Leute dazu gehören. Von den alten Parteimitgliedern konnte keiner darüber Auskunft geben – oder sie wollten nicht. Ich habe mich zu Wort gemeldet, vor allem, da ich vieles wusste. Und so bin ich dann der letzte erste Sekretär der Kreisleitung* geworden. Ich bin sozusagen über Nacht wie die Mutter zum Kind in diese Funktion gekommen. Dann kamen die Sonderparteitage in Berlin, und es kam zur Gründung der PDS*. Nun wurde ich hier im Kreis deren erster Vorsitzender. Nach zwei Jahren gab es eine große Gebietsreform, in der die Kreise zusammengelegt wurden. Unser Kreis verschwand von der Landkarte. Meine Aufgabe war damit beendet, ich baute Bestände und Personal ab. Als Abgeordneter sah ich recht schnell, dass hauptamtliche Mitglieder der SED keine Chance mehr hatten.
Ich überlegte lange, was ich machen sollte. Es war eine wilde Zeit. In die alten Räume zog eine Videothek ein, und ich dachte, dass das nicht schlecht sei und ich so immer genügend Filme gucken könnte. So bin ich Videotheksbetreiber geworden. Die Videothek war zwar gut besucht, denn nach der Wende wollte jeder erst mal Videos schauen, das war neu. Aber die Filme waren oft durchwachsen. Ich stellte deshalb relativ schnell fest, dass das nicht mein Ding war und ich das nicht bis zur Rente machen wollte. Ich wohnte weiter weg und fuhr täglich mehrere Kilometer bis nach Hause. In der Videothek hatte ich immer viel Zeit zum Nachdenken, und so fragte ich mich: »Was braucht man in dieser neuen Gesellschaft, was ist wichtig? Was interessiert die Menschen?« Ich kam zu der Erkenntnis, dass dies vor allem Geld war, darum geht es immer. Banker konnte ich nicht werden, denn dazu hatte ich keine Ausbildung. Aber was passierte? Nach der Wende kamen gleich die ersten Versicherungsvertreter, sagten: »Wir sind die Größten und ihr könnt bei uns arbeiten.« Die haben gezielt die Leute gesucht, die wieder viele andere kannten, und ich kannte viele. Versicherung klang also nicht schlecht, fast so gut wie Bank, und so machte ich jetzt einfach das. Ich habe bei einer Versicherung, einem Strukturvertrieb, angefangen, leider einem der übelsten Sorte. Da fängt man ganz klein an und muss sich hocharbeiten. Das habe ich circa zwei Jahre gemacht. Die Materie hat mich interessiert, ein weites Feld, und ich kam mit vielen Menschen zusammen, das hat mir gefallen.
In der Arbeit hatte ich ein sehr offenes, sachliches Verhältnis mit den Wessis. Ich hatte nicht das Gefühl, jemand dritter Klasse zu sein. Natürlich musste ich lernen, und man hat versucht, mir etwas beizubringen. Aber es hat mich damals verwundert und auch abgestoßen, dass das Geschäft und das Geldverdienen am wichtigsten war – noch bevor man uns erklärt hat, wie zum Beispiel eine Hausratversicherung funktioniert. Zwei Stunden wurden zu Beginn darauf verwendet, uns beizubringen, wie viel Geld wir eigentlich verdienen könnten, wenn wir es denn wollten.
Der Spruch »Ihr werdet alle eure Freunde verlieren, aber ihr werdet Millionäre werden« ist in diesem Geschäft eine Grundhaltung. So hat man uns versucht, zu motivieren, bei Laune zu halten. Meine damalige Vorgesetzte hat mich einmal eingeladen und wir haben zusammen eine Fahrradtour gemacht. Wenn ich unterwegs war, konnte ich bei ihr übernachten, im Kinderzimmer. Wir frühstückten zusammen, also ein recht ordentliches Verhältnis. Ich war nie Bürger zweiter Klasse, aber dennoch immer sehr auf das Geschäft ausgerichtet. Direkt gesagt, dass wir erst einmal richtig arbeiten lernen müssten, hat man nicht. Aber: »Die Ossis müssen sehr viel lernen, sie müssen in dieser neuen Gesellschaft ankommen, die sind nicht geeignet, können das nicht wissen, sie kommen aus der Diktatur heraus in eine freie Gesellschaft. Das ist für jeden schwer und für den Ossi besonders«, das sagten sie schon. Da war immer der Hintergedanke: Wir wollen mit ihm Geschäfte machen, er soll für uns Geld verdienen. Insofern hat man nicht gesagt: »Du bist ein Doofer«, sondern: »Du musst lernen.« Ich habe das erwartet, mich aber auch nie unter den Tisch verkrochen. Ich hatte ein gewisses Selbstbewusstsein. Man kann nicht alle Wessis über einen Kamm scheren. Es gab arrogante Menschen, von sich eingenommen, die haben genauso über uns Ossis geredet, und es gab Wessis, mit denen konnte man gut und vernünftig zusammenarbeiten, die haben den Wessi nicht raushängen lassen. Die haben versucht, zu helfen, uns zu verstehen, aber das waren die wenigsten. Die meisten haben gesagt: »Wir sind hier und ihr müsst euch anpassen. Nicht umgekehrt.«
1980 habe ich geheiratet. Meine Frau war immer voll berufstätig. Sie hat am Anfang in der Sparkasse gearbeitet, dann beim Rat des Kreises* in der Kultur und nach der Wende ist sie im Rathaus in der Verwaltung geblieben, wurde übernommen. Das war für mich gut, denn in der Zeit, in der ich die Videothek hatte, hat sie mehr verdient als ich. Zu DDR-Zeiten habe ich immer mehr verdient als sie. Arbeiter, drei Schichten sowieso und als Technologe auch. Nach der Wende hat sie lange die Familie getragen. Für mich war das kein Problem. Die Männer in der DDR hatten nie eine Ernährerrolle. Wir waren gleichberechtigt. Meine Frau hat das Meiste gemacht. Als ich in Berlin zum Direktstudium war, lag alles auf ihren Schultern. Ich war nur am Wochenende da. In der übrigen Zeit holte ich auch mal die Kinder ab und wir versuchten, uns die Dinge einzuteilen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass das Meiste auf ihren Schultern lastete. Ich war auch zu DDR-Zeiten abends und an den Wochenenden viel unterwegs. Meine Frau hat sich nie benachteiligt gefühlt, wir besprachen alles gemeinsam. Ich habe nichts gemacht, was meine Frau nicht hätte mittragen wollen. Es waren nicht nur Entbehrungen, das wäre falsch. Wir haben Vorteile gehabt. Ich hatte Arbeitszeiten, bei denen ich zwischendurch auch mal einkaufen gehen konnte. Das war eine schöne Arbeitsteilung. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, dass wir noch jung waren, vorankommen wollten. Meine Frau hat sich nie beschwert, aber es war manchmal hart. Meine Kinder haben auch nie gemault. Wir haben Wochenenden und Urlaube gemeinsam verbracht. Wir empfanden in dem Augenblick den Stress nicht so. Es war immer nur die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht. Mich hat in der DDR niemand zu etwas gezwungen. Wenn ich heute noch mal alles so machen sollte, würde ich es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen.
Meine Kinder sind immer gerne in den Kiga gegangen, und meine Enkel tun das heute auch. Man kann natürlich nicht alles 1:1 im Verhältnis damals zu heute umsetzen. Aus meinen Kindern ist was geworden, die waren nie auf der schiefen Bahn, die haben ordentliche Berufe und Studium, haben Familie, Kind und Karriere, sind beide voll berufstätig. Sie bekennen sich dazu, dass ihre Kinder in den Kiga gehen. Mein kleiner Sohn hat drei Kinder und viele Dienstreisen durch die ganze Welt. Seine Frau ist Ärztin. Die stehen beide also voll im Beruf. Auch wenn wir als Großeltern unterstützen. Wichtig ist, dass die Kinder solche Werte wie Zuverlässigkeit leben, sich nicht verbiegen, zu dem stehen, was sie machen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Ostmänner etwas wehleidiger sind, aber das ist nur ein Gefühl. Wir haben früher gemeint, dass wir gesund sind und gesund bleiben. Das ändert sich mit dem Alter und weniger mit der Gesellschaft. Wir haben früher über die Gesundheit nicht viel nachgedacht. Der Westen denkt mehr darüber nach. Zumindest heute. Früher wurde mehr Fleisch gegessen. Der Fleischkonsum war bestimmt gigantisch. Das schmeckt ja auch gut und war immer eine Delikatesse. Die Essgewohnheiten waren andere. Das hat sich angenähert. Wenn ich in den Westen fahre, wird da genauso gegrillt wie bei uns.
Der Westmann, ich habe immer mit ihnen zu tun, ist heute ein anderer. Wenn ich an die erste Zeit nach der Wende denke, war es üblich, dass der Wessimann der Ernährer war, das Familienoberhaupt, das Geld verdient. Das war weit verbreitet, ist aber heute nicht mehr so. Da gab es Annäherung. Eine Wandlung ist auf beiden Seiten erfolgt. Die Wessis sind von uns beeinflusst worden. Ganz spurlos ging die Entwicklung bis heute auch nicht an ihnen vorbei. Der Ostmann hat nach der Wende viel in den Westen eingebracht.
Seit 2004 habe ich eine eigene Firma. Wir arbeiten mit vielen westdeutschen Versicherungen, da ist das Verhältnis jetzt auf Augenhöhe. So wie wir uns dort einbringen, kommt es zurück. Das Verhältnis hat sich total verändert gegenüber der ersten Zeit, als ich dabei war. Die Akzeptanz unter Geschäftspartnern ist heute vorhanden. Nicht mehr von oben herab, mehr wohlwollend, großväterlich.
Für mich waren beide Zeiten schöne Zeiten. Ost und West. Ich möchte beides nicht missen. Als die Mauer fiel, war ich zwiegespalten. Die reinste Freude hat sich bei mir nicht eingestellt. Denn ich wusste, dass jetzt alles ganz anders würde – wie genau wussten wir nicht, und es gab noch lange Zeit die Illusion, dass die DDR sich ändert. Erst später wurde klar, dass sie verschwinden würde. Am Anfang ging es darum, dass das, was wir hatten, verändert und verbessert werden sollte. Später kam »Deutschland, einig Vaterland«. Ich hatte Zweifel, ob das alles so werden würde. Ich war einer der wenigen, der das Begrüßungsgeld nicht abholte. Das war mir zuwider, diese Bettelgroschen gingen mir gegen den Strich.
Sorge, arbeitslos zu werden, hatten die allerwenigsten, weil der Durchblick fehlte. Die meisten waren der Meinung, dass sich die guten Seiten der DDR mit den guten Seiten des Westens vereinen würde. Und deshalb wurde die Maueröffnung von den meisten Männern mit großem Jubel begrüßt – in den ersten Monaten. Bis der eine oder andere auf der Straße stand. Ich halte es für möglich, dass sich viele Männer aus Enttäuschung Pegida oder der AfD zuwenden. Ich kenne aber niemanden, der in der AfD ist. Ich kenne aber viele Sympathisanten, zum Teil als Kunden. Denn wir reden in unserer Arbeit nicht nur über das Geschäft. Gerade bei Männern, vor allem bei älteren Männern, gibt es eine große Sympathie für die AfD. Zum einen ist die AfD die neue Protestpartei, was früher die Linken und die PDS* waren, nämlich das Gegenstück zur Regierung. Dazu kommt zum anderen, dass die genau in den Wunden stochern, die die Leute bewegen. Also: »Wie viele Asylanten sollen denn noch kommen?« »Die oben hauen sich die Taschen voll und wir gehen leer aus!« Für einfache Dinge sind Männern empfänglicher als Frauen. Ich kenne mehr männliche Sympathisanten als weibliche, aber Frauen gibt es dort auch. Bei der AfD sind nicht alle rechts. Das ist mit Sicherheit nicht richtig. Einige sind dabei, die besonders heimatverbunden sind. »Wir sind deutsch« – sie kommen aus dieser Richtung oder haben andere Motive. Ich glaube nicht, dass eine Partei, die so wenig homogen ist, als rechts einzuordnen ist. Man kann auch nicht von den Linken sagen, dass das alles Linksextreme oder nur Linksliberale sind. Bei der AfD ist ein Großteil nicht rechts, aber ich fürchte, dass sie mehr oder weniger von rechts vereinnahmt werden. Die bestimmen leider die Politik und das Meinungsbild. Wenn jemand gegen Corona auftritt, sind es zuerst die Rechten, die sich vorne anstellen.
Der Ostmann hat bis zu einem gewissen Punkt mehr Schwierigkeiten, sich unterzuordnen. Aber eine Gleichsetzung – autoritärer Staat bedeutet autoritärer Mann –, das würde ich nicht so sehen. Ich hatte zu DDR-Zeiten ein relativ selbstbestimmtes Leben. Ich habe nie alles gemacht, was man mir angetragen hat. Ich machte meine Dinge aus Überzeugung. Im Westen war es genauso. Wer dort eine große Klappe hatte, der flog raus. Das war noch schlimmer als bei uns. Bei uns konnte jeder Arbeiter zu seinem Chef sagen: »Hey, Meister, das läuft schief, bring das mal in Ordnung.«
Gottfried, Jahrgang 1932 | 8 Kinder, verheiratet in zweiter Ehe
Ost: Pfarrer, Hausmeister, West: Pfarrer,
Leiter kirchliches Altenheim Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats
Was andere in der DDR nicht machen konnten,
konnten wir machen
Geboren bin ich 1932 in München und im Alter von fast drei Jahren mit meinen Eltern und meiner Schwester, die 1934 geboren wurde, in ein Dorf am Starnberger See gezogen. Mein Vater war mittlerer Beamter der Stadt München. Meine Mutter arbeitete nach der Heirat nicht mehr. Sie war in einer Schwesternschaft in Dresden selbstständig, gab alles auf und zog zu ihrem Mann nach München. In die Schule gegangen bin ich ab 1938. Ich war vier Jahre in der Volksschule und sollte auf die Oberschule kommen bzw. auf die Napola*. Mein Vater war 1925 in die NSDAP eingetreten, hatte aber keine Funktion. Für die Napola gab es ein Ausleselager, in dem ich für eine Woche war. Dort orientierte man sich am Erziehungsbild der Nationalsozialisten: »Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und schnell wie ein Windhund.« Auch mein Vater erzog mich für den Führer. Ich sprach sogar ein Abendgebet, in dem es um ihn ging. Eigentlich entsprach ich all diesen Anforderungen nicht. Trotzdem wurde mir bescheinigt, dass ich die Oberschule besuchen durfte. In Landsberg am Lech hatte ich eine Aufnahmeprüfung dafür gemacht. Dort blieb ich bis Kriegsende in einem Internat.
Wir wohnten etwas außerhalb des Dorfes. Am 30. April 1945, einem Montag, kamen die Amerikaner. Tags zuvor hatten wir keinen Strom mehr, dadurch auch keinen Radioempfang, später auch kein Wasser. Am Sonntag noch war am Bahnhof, etwa 15 Minuten vom Dorf entfernt, ein Zug mit KZ-Häftlingen abgestellt worden, der Tage lang eine Irrfahrt durch ganz Oberbayern gemacht hatte. Die Amerikaner ließen die fast verhungerten Menschen frei. Sie zogen durchs Dorf, denn die Amerikaner hatten bestimmte Wohnungen, so auch unsere, zur Plünderung freigegeben. Eine Woche später, am Sonnabend, sind sie zu uns gekommen, durchsuchten Schränke und nahmen alles, was sie brauchen konnten, mit. Sie fanden bei uns eine Zinkkiste mit einer alten Wehrmachtsuniform und gingen davon aus, dass dies eine SS-Uniform meines Vaters sein könnte. Wir konnten ihnen nichts erklären und so wurde mein Vater von ihnen geohrfeigt. Das war für mich schrecklich.
Gleich zu Kriegsbeginn 1939 wurde mein Vater eingezogen. Er hatte sich freiwillig gemeldet. Als Zahlmeister, später Oberzahlmeister der Wehrmacht war seine Einheit 1941 nach Polen verlegt worden. Noch vor dem Russlandfeldzug erlitt er im Juni 1941 einen Nervenzusammenbruch und kam ins Lazarett sowie in die Reha. Meine Mutter besuchte ihn dort. Ich frage mich bis heute, ob er damals Dinge über die Judenverfolgung in Polen mitbekommen hatte. Das passte doch eigentlich nicht in sein Weltbild der Menschenwürde, so wie er es gelernt hatte. Ich habe noch eine Landkarte und einen Stadtplan von ihm mit eigenen Eintragungen. Das konnte ich nie klären. Obwohl er in der NSDAP war, den Führer liebte und stolz darauf war, ihm einmal in den 1920er Jahren persönlich die Hand gedrückt zu haben, muss ihn dies sehr betroffen haben. Er schied aus der Wehrmacht aus, hatte fast ein Jahr eine Reha-Kur in Bad Tölz, wurde entlassen und war ab 1942 wieder in seinem Beruf als mittlerer Beamter der Stadt München tätig. Er gab jedoch keine Ruhe, bis er wieder eingezogen wurde und im Heeresfürsorge- und Versorgungsamt in Augsburg arbeitete. 1944 wurden diese Tätigkeiten der Zivilverwaltung übergeben. So schied er wieder aus der Wehrmacht aus und war bei Kriegsende kein Soldat mehr.
Ich habe nie mit ihm über diese Zeit gesprochen.
Gleich nach dem Krieg sagte mein Vater: »Wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst.« Ich fragte mich, was das soll. Die ganzen Jahre ging es ohne Kirche. Wir waren zwar ursprünglich evangelisch, aber aus der Kirche ausgetreten, gottgläubig, wie das so schön hieß. Ich musste dazu noch ein Lied auswendig lernen. Der Pfarrer lud uns Kinder zum Unterricht ein, am Montag von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Wir saßen aber bis 11:00 Uhr, weil das für uns so interessant und spannend war. Für mich vor allem, weil ich dort erstmalig erlebte, dass ich angenommen wurde, einfach so, wie ich bin, mit dem, was ich gesagt habe und was ich mir dachte, nicht bewertet wurde, ob man am stärksten, am kräftigsten oder am schnellsten war, dem Sollmaß beim Jungvolk entsprach. Ein Jahr später lud uns der Pfarrer zu einer einwöchigen Rüstzeit* ein mit Lernen, Spielen, Gesprächen. Obwohl es nicht weit von zu Hause war, wollten wir, meine Schwester und ich, unbedingt dort mitmachen und übernachten.
1948 wurde ich konfirmiert, zwei Jahre später als gewöhnlich, weil ich noch nicht so lange kirchlichen Unterricht hatte. Zur Vorbereitung auf die Konfirmation gab es eine Woche lang eine Rüstzeit*. Da bekamen wir, zehn Jungs und 30 Mädchen, eine Woche schulfrei; es entstanden da viele Bekanntschaften. Nach der Konfirmation wurde mir klar, dass ich Theologie studieren wollte – mein Vater hatte, weil er das Gymnasium besuchte, alte griechische Bücher, und die hatte ich mir vorgenommen. Mit diesem Entschluss machte ich Abitur und ging auf die kirchliche Hochschule in Neuendettelsau. In den ersten beiden Semestern lernte ich Griechisch und im dritten Hebräisch. Die weiteren Semester absolvierte ich an den Unis in Erlangen und Heidelberg. Das erste kirchliche Examen legte ich 1955 in Ansbach ab. Danach ging ich ins Predigerseminar nach Bayreuth. In Erlangen hatte ich meine erste Frau kennengelernt. Sie kam aus einem Pfarrhaus und studierte Germanistik und Geschichte. Ich habe mich mit ihr zunächst verlobt, denn wir konnten nicht heiraten. In der Landeskirche durfte man erst mit 27 Jahren heiraten, oder wenn man das zweite Examen gemacht hatte, das hatte ich aber noch lange nicht.
Zu uns ins Predigerseminar in Bayreuth war der Rektor des Predigerseminars aus Mecklenburg gekommen. Diese Kirche in Mecklenburg war die Partnerkirche von uns in Bayern. Es ging ihm darum, den Kontakt zur Partnerkirche zu festigen. Ich entschloss mich, mit meiner Verlobten nach Mecklenburg zu gehen. Dabei spielte eine Rolle, dass man innerhalb der Kirche etwas für die Partnerkirche tun wollte. Mir war das aber zu wenig, ich wollte etwas mehr erleben und erfahren. Als junger Mensch ist man bereit, den Aufbruch zu wagen, also etwas Abenteuer. Und außerdem mussten wir, damit meine Verlobte mitkonnte, vorher heiraten. So heirateten wir im Dezember 1956.
Ich kam natürlich nicht sofort nach Mecklenburg, sondern hatte erst einmal eine Vikarsstelle in Fürstenfeldbruck bei München von 1956 bis 1957, bis wir endlich die Einreisepapiere erhielten und 1957 in die DDR fahren konnten. Meine Eltern hatten nichts dagegen, das stand gar nicht zur Debatte. Wir wurden, als wir ankamen, sofort DDR-Bürger, bekamen Personalausweise der DDR. Mein zweites Examen legte ich schon in Schwerin bei der mecklenburgischen Landeskirche ab.
Die Situation war ziemlich schwierig, nicht so sehr von der mecklenburgischen Sprache her, die man gerne hörte und zu verstehen lernte, aber dass man zu wenig Kontakte zu anderen Kollegen hatte. Wir wohnten die ersten Wochen bei einem Kollegen, der ein paar Jahre älter war als ich. Ich fühlte mich ziemlich isoliert und wechselte 1965 zu einer Dorfpfarrstelle in die Nähe von Malchin. Hier war das Entscheidende für mich die Gemeindeseminararbeit, die wir zusammen mit drei weiteren Gemeinden entwickelten. Diese Idee kam von der brandenburgischen Kirche. Ich las darüber in Kirchenblättern und war angetan von der Idee, mit Gruppen in der Gemeinde Gesprächsabende zu gestalten. Dabei wurden schon in der Vorbereitung Laien, Nichttheologen, einbezogen. Wir sprachen in dieser Gemeindeseminararbeit über Bibel- und Literaturtexte. Vorgaben dazu gab es nicht, aber Texte, die vorgeschlagen wurden.
Einmal bekam ich eine Einladung mit Freistellung zu einem Studienkurs für drei Monate nach Greifswald. Wir sprachen über theologische Strömungen. So bekam ich einen weiteren Zugang zur Theologie. Dabei habe ich den Leiter des brandenburgischen Pastoralkollegs kennengelernt. Das war der Vater von Angela Merkel. Mit ihm gab es auch anlässlich eines anderen Kurses ein Nachfolgetreffen in Templin. Ich nahm teil und lernte eine Kollegin kennen, die in Brandenburg tätig war, mit der ich mich schnell sehr gut in theologischen Fragen verstand. Das war 1973.
Eines Tages besuchte sie mich in Mecklenburg mit einem Kollegen. Beide kamen von der Landjugendarbeit, suchten einen Nachfolger für Brandenburg und warben mich, bei ihnen einzusteigen. Es ging darum, mit den Berufstätigen, auch jungen Erwachsenen, die in der Landwirtschaft, in den LPGen, tätig waren, Kontakte herzustellen. Uns wurden auch mal seitens des Staates Steine in den Weg gelegt, aber im Wesentlichen hat man uns als Pfarrer machen lassen. Was andere in der DDR nicht machen konnten, konnten wir.
Meine Frau hatte inzwischen eine theologische Ausbildung gemacht, und es wurde ihr erlaubt, eine Pfarrstelle in Brandenburg zu übernehmen. Wir zogen 1974 nach Brandenburg um. Auch hier waren uns die Familienrüstzeiten* wichtig. Eine Woche im Winter, meist in den Winterferien, mit circa 40 Teilnehmern, Eltern mit ihren Kindern. Da waren zwei Pfarrer dabei und zwei Katechetinnen. So wurde für die Kinder und für die Erwachsenen etwas gemacht. Es gab Rüstzeitenheime, da konnte man zum Beispiel nach Eisenach oder Buckow fahren. Meine Arbeit mit Jugendlichen, Kindern, Konfirmanden und Familien in der Rüstzeit* behielten wir all die Jahre bei. Mit bis zu 40 Leuten haben wir gezeltet, sind gewandert. Für die Familien führten wir das auch an Wochenenden durch. Zu thematischen Abenden haben wir Bibeltexte gelesen. Den Jugendlichen übertrugen wir frühzeitig Verantwortung für die Betreuung der jüngeren Kinder.
Bei diesem Familienrüsten habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Ich hatte von ihr zwar schon gehört, war ihr bei kirchlichen Treffen begegnet, aber bei der Rüste in der Nähe von Potsdam sind wir uns sehr nahegekommen. Als ich nach Hause kam, wollte ich das meiner damaligen Frau nicht verschweigen und habe ihr von meiner Liebe erzählt, die ich auf dieser Rüste erlebt hatte. Ich besuchte meine zweite Frau zunächst in ihrem Dorf, wo sie mit ihren beiden Töchtern aus ihrer geschiedenen Ehe lebte, blieb über Nacht. Meine Frau konnte sich nicht vorstellen, dass ich noch mit einer anderen in einer Beziehung lebte. Ich konnte und wollte aber nicht den Kontakt zu ihr abbrechen und besuchte sie weiterhin. Daraufhin hat meine Frau sich an den Superintendenten gewandt, der ein Disziplinarverfahren gegen mich in Gang brachte. Ich musste aus dem Pfarrdienst ausscheiden, in einer zweiten Verhandlung wurde das Strafmaß auf zwei Jahre verkürzt. In dieser Zeit, 1981, bekam ich Arbeit in einem kirchlichen Krankenhaus in Berlin, wo ich Arbeiten im Hof und in den Grünanlagen, Transportfahrten für Krankenhausmaterial und ähnliche Dinge verrichten musste. Dabei konnte ich mich zumindest mit meiner jetzigen Frau und deren zwei Töchtern treffen. Beide Töchter hatten zu ihrem Vater keinen Kontakt. Gegen Ende des Jahres musste nun entschieden werden, was ich weiter mache und wo ich wohnen werde. Mir wurde die Leitung eines kirchlichen Altersheimes in einer Stadt nahe der Oder übertragen. Inzwischen waren wir geschieden. Bis zu unserer Eheschließung durfte meine jetzige Frau nicht bei mir wohnen. Unser Leben war quasi inoffiziell. 1982 im Februar heirateten wir standesamtlich. Ihre damals neun- und elfjährigen Töchter haben meinen Namen übernommen und ein Jahr später adoptierte ich sie. Sie sollten die gleichen Rechte haben wie das gemeinsame Kind, das wir erwarteten. Im Laufe des Jahres wurde unsere Tochter geboren und zwei Jahre später unser Sohn.
Zu den vier Kindern aus der ersten Ehe versuchte ich immer Kontakt zu halten. Unser Sohn, unser erstes Kind, machte damals die Ausbildung zum Diplomingenieur für Kfz-Technik und hat also keinen kirchlichen Beruf. Von den drei Töchtern studierte die erste in Rostock Theologie, hat ihren Mann dort kennengelernt und in dieser Zeit das erste Kind bekommen. Die zweite Tochter hatte nach ihrer Berufsausbildung mit Abitur in einer Papierfabrik ebenfalls angefangen, in Berlin Theologie zu studieren, hat ihren Mann, ebenfalls einen Theologen, kennengelernt, geheiratet und ist mit ihm nach Mecklenburg gezogen. Später haben sie einen Ausreiseantrag gestellt und sind in die Schweiz gezogen, wo sie heute noch leben. Die dritte Tochter hat einen Bolivianer kennengelernt, der in Deutschland studierte. Sie hat 1981 an der EOS* gerade Abitur gemacht und hatte es natürlich am schwersten gemeinsam mit der Mutter. Später heiratete sie diesen Bolivianer, konnte so die DDR verlassen und lebt in Kiel. Sie bekam vier Kinder. Nach deren Geburt oder zu deren Taufe konnte ich einen Reiseantrag stellen, den ich genehmigt bekam.
Bis zum Grundlagenvertrag 1971 gab es keine Reisen in den Westen, ich konnte weder meine Eltern noch meine Schwester besuchen. Mit dem Grundlagenvertrag änderte sich das und man konnte in dringenden Familienangelegenheiten zu Besuch reisen. Zu meinen Eltern hielt ich immer Kontakt. Sie besuchten uns regelmäßig. Wir schrieben damals noch Briefe. Telefonieren war sehr aufwendig und teuer.
1983 fragte mich der Oberkonsistorialrat, ob ich wieder in den Pfarrdienst möchte und bot mir drei Pfarrstellen an. Wir wollten in der Nähe zu Polen bleiben und möglichst intakte Kirchen, da ich vorher schon mal eine abgebrannte Kirche wieder aufbauen musste. In den Jahren davor hatte ich angefangen, Polnisch zu lernen. Wir wollte näher an die Oder. Die Stelle lag aber im Braunkohlegebiet. Im Oktober sind wir hingefahren, es schien die Sonne noch so schön. Ich sagte zu. Den Ruß der Brikettfabriken in der Luft bemerkten wir erst im Winter, als der Schnee so schmutzig wurde. 1984 übernahm ich die Pfarrstelle in G. mit vier Predigtstellen. Meine Frau war inzwischen wieder schwanger und musste längere Zeit ins Krankenhaus. So brachte ich morgens unsere Tochter in die Krippe und holte sie am Nachmittag wieder ab. Es wurde ein Sohn, 1984 geboren. Da war ich schon 52 Jahre alt.
Am 1. März sollte ich in meiner Pfarrstelle anfangen, da setzten die Wehen ein. Ich brachte meine Frau nach Frankfurt zur Entbindung, aber das Kind kam noch nicht. Ich bin zurück und kam am nächsten Tag gerade rechtzeitig wieder hin, als er geboren wurde. Als ich ihn auf dem Arm hatte, kamen mir die Tränen, ich hatte wieder einen Sohn nach so vielen Töchtern. Die große, dreizehnjährige Tochter meiner Frau war an diesem Tag, ihrem ersten Schultag, gefragt worden, wie viele Geschwister sie habe, und sie hatte geantwortet: »Zwei oder drei«, als wüsste sie es nicht. Sie konnte es wirklich noch nicht wissen.
Im Pfarrkonvent wurde gefragt, wer bereit sei, eine Schweizer Delegation von Pfarrern und Kirchenleuten, eine Gruppe von fünf Leuten, für eine Woche aufzunehmen. Ich schrie sofort: »Hier!« Ich wollte Kontakte vermitteln. Der strukturbestimmende Betrieb war die Braunkohle. Da ließ sich aber nichts vereinbaren. Das ging also nicht. Natürlich nahm ich Kontakt mit der Bürgermeisterin auf, was gut ging. Auch mit dem LPG-Vorsitzenden führten wir ein Gespräch. Mehr so nebenbei, nicht ganz offiziell. Wir wollten ja nicht, dass das abgelehnt wird. Es gelang uns, einen Gegenbesuch zustande zu bringen. Organisiert wurde er durch den Ökumenischen Jugenddienst in Berlin, der Dienstreisen bei den staatlichen Stellen vermitteln konnte. Mit zwei Leuten konnten wir in die Schweiz reisen. So fuhren die Frau des Gemeindekirchenratsvorsitzenden und ich die erste Woche in die französische Schweiz, die zweite Woche nach Zürich. Wir fuhren mit dem Zug. Auf der Rückreise haben wir unsere Partnergemeinden in Pforzheim und Wuppertal besucht. Mit dem einem Pfarrer aus der Schweiz sind wir bis heute befreundet. Wir haben unsere Kinder nicht als Kleinkinder getauft, sondern erst im Kindesalter. Das hatte meine Frau schon so mit ihren Kindern gemacht, und unsere gemeinsame Tochter suchte sich von den zwei Paten, die sie wollte, diesen Schweizer Pfarrer aus.