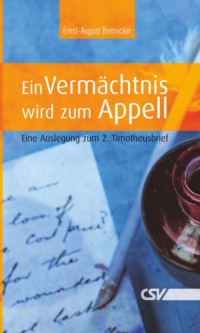Kitabı oku: «Ein Vermächtnis wird zum Appell», sayfa 2
Ermunterung zum Dienst
Das erste Kapitel bildet eine Einführung in den Brief. Nach den Grußworten kommt Paulus unmittelbar auf eines der zentralen Anliegen des Briefes zu sprechen: Er erinnert Timotheus daran, dass er die von Gott gegebene Gnadengabe anfachen soll. Damit appelliert er an ihn, seine Aufgabe zum Dienst nicht zu vernachlässigen, sondern im Gegenteil seine Bemühungen in der Arbeit für den Herrn zu intensivieren. Dabei verweist er auf sein eigenes Beispiel. Paulus hatte im Dienst nicht resigniert und Timotheus sollte es genauso wenig tun.
Neben dem Appell zum Dienst spricht Paulus von der Wichtigkeit, die von Gott gegebene Wahrheit nicht aufzugeben, sondern daran festzuhalten. Das Glaubensgut, das Timotheus bewahren sollte, war ein schönes und anvertrautes Gut. Gerade weil es Menschen gab, die in Gefahr standen, dieses Glaubensgut aufzugeben, sollte Timotheus seinerseits unter allen Umständen daran festhalten.
Das Kapitel lässt sich nicht ganz einfach strukturieren. Folgende Einteilung ist jedoch möglich:
1 Verse 1–5: Grußworte an TimotheusDie Grußworte sind sehr persönlich gehalten. Paulus erinnert sich dankbar an Timotheus. Er spricht von seinen eigenen Eltern sowie von der Mutter und Großmutter des Timotheus. Es wird klar, wie eng diese beiden Diener des Herrn miteinander verbunden waren.
2 Verse 6–14: Ein Appell an TimotheusPaulus fordert Timotheus auf, seine Gnadengabe nicht zu vernachlässigen und sich des Zeugnisses nicht zu schämen. Er soll an der Wahrheit festhalten und das Glaubensgut nicht aufgeben. Paulus untermauert seine Appelle mit der Erinnerung an die große Errettung, die Gott uns geschenkt hat. Gleichzeitig stellt er sein eigenes Beispiel vor. Paulus hatte einen besonderen Auftrag von Gott bekommen. Er war ein Herold, ein Apostel und ein Lehrer. In diesem Dienst hatte er bis zum Ende nicht aufgegeben.
3 Verse 15–18: Leid und Freude für PaulusPaulus hatte im Dienst manche Enttäuschung erlebt. Alle, die in Asien waren, hatten ihn verlassen. Das schmerzte ihn. Deshalb gab Gott ihm eine besondere Ermunterung durch das Verhalten von Onesiphorus.Die Einzelheiten sind lehrreich und nützlich für uns. Wir lernen sowohl von den Appellen an Timotheus als auch von dem Beispiel des Paulus.
Das Apostelamt des Paulus
Vers 1: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist.
Der Verfasser des Briefes ist uns gut bekannt. Dennoch stellt er sich hier in einer besonderen Weise vor, die wir an anderen Stellen so nicht finden. Paulus macht deutlich, wer ihn zum Apostel berufen hatte, was ihm die Autorität zu seinem Apostelamt gab und welchen Charakter sein besonderer Dienst hatte. Er tat das nicht etwa, weil Timotheus daran irgendeinen Zweifel hegte. Die Gründe sind vielmehr darin zu sehen, dass er erstens seinem jüngeren Mitbruder Mut machen wollte, nicht zu verzagen und aufzugeben. Zweitens wird allen, die diesen ernsten Brief heute lesen, klar dokumentiert, dass er eine verbindliche Botschaft hat. Es ist eine Botschaft, der wir nicht ohne Folgen ausweichen können.
Die Berufung zum Apostelamt
Der besondere Auftrag und Dienst von Paulus wurde dadurch gekennzeichnet, dass er der einzige Apostel war, der durch den verherrlichten Herrn vom Himmel her berufen wurde. Die entscheidende Begegnung fand vor den Toren von Damaskus statt. In Damaskus bekam er dann seinen Auftrag. Damit unterschied sich Paulus‘ Dienst von dem aller anderen Apostel. Die übrigen Apostel waren von einem auf der Erde lebenden Herrn berufen worden. Sie hatten Ihn hier gesehen und erlebt. Paulus hingegen hatte den verherrlichten Herrn im Himmel gesehen. Deshalb war ihm besonders das „Evangelium der Herrlichkeit“ (1. Tim 1,11) anvertraut worden. Der Inhalt dieses Evangeliums war bis zu diesem Zeitpunkt ein Geheimnis. Die Tatsache, dass er von der himmlischen Herrlichkeit aus berufen wurde, ist der Grund, warum es hier heißt: „Apostel Christi Jesu“ – und nicht „Apostel Jesu Christi“.
Petrus nennt sich in den einleitenden Worten seiner beiden Briefe jeweils „Apostel Jesu Christi“. Der Unterschied in der Reihenfolge der Namen bei Petrus und Paulus scheint nicht ganz ohne Bedeutung zu sein. Paulus wurde durch den erhöhten und verherrlichten Sohn des Menschen berufen. Dieser hatte einst in Niedrigkeit auf dieser Erde gelebt und war jetzt von Gott zum „Herrn und Christus“ gemacht worden. Petrus hingegen weist uns in seinem Dienst besonders auf den hin, dessen Weg durch Leiden (Jesus) zur Herrlichkeit (Christus) ging. Deshalb die andere Reihenfolge[1]. Paulus wusste nicht nur, wem er geglaubt hatte, sondern er wusste ebenso, wer ihn berufen hatte. Es war „Christus Jesus“, der verherrlichte Herr im Himmel, der ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet war.
Die Grundlage des Apostelamts
Paulus war sich darüber hinaus bewusst, auf welches Fundament sich sein Apostelamt und sein Dienst abstützten: „durch Gottes Willen“. Er wusste, was ihm die notwendige Autorität gab. Die ersten Verse des Galaterbriefes machen das sehr deutlich. Dort musste Paulus seine Autorität besonders betonen, weil die Galater in großer Gefahr standen und er sie ernstlich zurechtweisen musste. Der Wille Gottes steht hier im Gegensatz zu dem Willen der Menschen. Paulus hatte sein Apostelamt nicht von einem Menschen bekommen, sondern von Gott selbst. „Durch Gottes Willen“ bedeutet „aufgrund von Gottes Willen“. Das gab Paulus einerseits die notwendige Autorität und andererseits den Mut, seinen Dienst auszuüben. Später erinnert er Timotheus daran, dass seine Gnadengabe ebenfalls eine von Gott gegebene Gabe war. Allerdings bestand der Unterschied zu Paulus darin, dass es im Fall von Timotheus spezielle Weissagungen über seine Gabe gab (1. Tim 1,18; 4,14). Seine Gnadengabe – obwohl sie natürlich ebenso ihren Ursprung in Gott hatte – wurde durch Paulus vermittelt und die Ältesten machten sich durch Auflegen der Hände damit eins. Das war bei Paulus anders. Bei ihm war kein anderer Mensch irgendwie daran beteiligt.
Der Charakter des Apostelamts
Paulus formuliert den Charakter seines Apostelamts hier so: „... nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist“. Es handelt sich dabei nicht um eine irdische, sondern um eine ewige Verheißung. Sie steht mit dem Himmel in Verbindung. Es ist eine Verheißung des Vaters an den Sohn. Gemeint ist das ewige Leben, das „Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten“ (Tit 1,2). Dieses ewige Leben ist in niemand anderem als in Christus Jesus. In Titus 1,2 spricht Paulus von der „Hoffnung des ewigen Lebens“. Das bedeutet nicht, dass es im Blick auf das ewige Leben irgendeine Unsicherheit geben könnte. Ganz im Gegenteil: Die Tatsache, dass es „in Christus Jesus“ ist, macht die Verheißung völlig sicher. „Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn“ (1. Joh 5,11). Das ewige Leben ist bei Paulus – im Unterschied zu den Schriften von Johannes – in den meisten Fällen etwas, das noch vor uns liegt. Wir besitzen es grundsätzlich heute schon, werden es in seiner ganzen Fülle allerdings erst dann genießen können, wenn wir in der Heimat dieses ewigen Lebens – das ist das Vaterhaus – sind. Das Wörtchen „nach“ meint „im Hinblick auf“ und deutet eben dieses Ziel an. Paulus hatte den sicheren Tod vor Augen. Timotheus befand sich in schwierigen Umständen. Der Verfall hatte eingesetzt. Da war die Erinnerung an das Ziel ein echter Trost. Timotheus sollte daran denken, dass der Dienst von Paulus auf dieses Leben hin orientiert war.
F. B. Hole schreibt dazu: „In der Natur ist das Leben eine ungeheure Kraft, aber das Leben Christi Jesu ist unbesiegbar. Das natürliche Leben in all seinen Formen, das Leben Adams – also das menschliche Leben – eingeschlossen, unterliegt letztendlich im Wettkampf und wird vom Tod besiegt. Das Leben in Christus ist außerhalb der Reichweite des Todes, denn als Gestorbener und Auferstandener wurde Er zur Quelle des Lebens für andere. Dieses Leben war vor der Entstehung der Welt verheißen (Tit 1,2) und ist durch das Evangelium ans Licht gebracht worden (V. 10). Seine Frucht wird in zukünftigen Zeiten zu sehen sein. Deshalb wird hier von dem Leben als von einer Verheißung gesprochen.“[2]
Ein besonderes Verhältnis
Vers 2: Timotheus, meinem geliebten Kind: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn!
Das Verhältnis von Paulus und Timotheus war durch ein besonderes Band der Liebe gekennzeichnet. Er nennt ihn sein „geliebtes“ Kind. Er wusste nicht nur, dass Timotheus von Gott geliebt war, sondern er selbst hatte Timotheus von Herzen lieb. Ganz sicher hat er mit großer Freude an ihn gedacht.
Paulus war der Ältere, Timotheus der Jüngere. Gemeinsam hatten sie dem Herrn gedient. Kaum jemand hatte so viel von dem Apostel Paulus gelernt wie gerade Timotheus. Der Ausdruck „Kind“ lässt uns einerseits an Abstammung und andererseits an Beziehung denken. In diesem Sinn spricht Paulus zum Beispiel von seinem Kind Onesimus, den er in den Fesseln, d. h. im Gefängnis, gezeugt hatte (Phlm 1,10). Die neue Geburt ist natürlich immer ein Werk Gottes, Paulus war dabei sozusagen „Geburtshelfer“ geworden.
Bei Timotheus sind uns die Umstände, wie er zum Glauben kam, nicht bekannt. Man kann also nicht zwingend annehmen, dass Paulus das Werkzeug zu seiner Bekehrung war. Timotheus wird zum ersten Mal in Apostelgeschichte 16,1 erwähnt, als Paulus nach Derbe und Lystra kam. Der Bericht lässt keinen Zweifel, dass Timotheus zu diesem Zeitpunkt bereits ein Gläubiger war.
Dennoch war Paulus in einem anderen Sinn der geistliche Vater von Timotheus. Er hatte dazu beigetragen, dass dieser geistlich gewachsen war und gute Fortschritte gemacht hatte. Paulus nennt ihn an anderer Stelle sein „geliebtes und treues Kind im Herrn“ (1. Kor 4,17). In Philipper 2,22 spricht er von seiner Bewährung, „dass er, wie ein Kind dem Vater, mit mir gedient hat an dem Evangelium“. Für Paulus war das keine leere Redensart. Der Ausdruck zeugt vielmehr von seiner inneren Zuneigung zu diesem jüngeren Bruder. Auf diese Weise konnten der Zuspruch des Paulus und seine Warnungen auf fruchtbaren Boden fallen. Davon können wir in unseren geschwisterlichen Beziehungen – besonders zwischen Älteren und Jüngeren – lernen.
Gnade, Barmherzigkeit und Friede
Nun folgen die Grüße, die in der damaligen Zeit nicht am Ende, sondern zu Beginn eines Briefes formuliert wurden. Wir sind häufig geneigt, diese Grüße zügig zu überlesen. Ihr Studium ist allerdings der Mühe wert. Gerade in den Unterschieden zwischen den einzelnen Briefen werden wir interessante Hinweise finden.
Hier nennt Paulus – wie an anderen Stellen – Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Die drei Begriffe gehören eng zusammen. Der Sünder hat sie nötig, um vor Gott bestehen zu können. Jemand hat es einmal in etwa so formuliert: Gnade ist für Wertlose. Barmherzigkeit ist für Hilflose. Friede ist für Ruhelose. Solche waren wir von Natur aus alle. Deshalb die Notwendigkeit von Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Indes schreibt Paulus hier an Timotheus und damit an jemand, der längst errettet war; es geht hier also um Gläubige. Timotheus lebte täglich aus der Gnade, er brauchte Barmherzigkeit und sollte den Frieden im Herzen tragen. Kein Christ kann ohne Gnade, Barmherzigkeit und Frieden glücklich leben. Auf Gläubige angewandt ist mit Recht gesagt worden: Gnade benötigen wir für den Dienst, Barmherzigkeit für unser Versagen. Frieden haben wir für unsere Umstände nötig.
Gnade ist unverdiente Zuwendung Gottes an uns. Sie steht zu Recht immer am Anfang solcher Aufzählungen. Gnade entspringt dem Herzen Gottes. Er ist der „Gott aller Gnade“ (1. Pet 5,10). Das gilt für unsere Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Hier geht es um Gnade, die wir an jedem Tag unseres Lebens nötig haben. Gnade ist nicht nur eine Anfangserfahrung junger Christen. Sie ist vielmehr ein beständiger Strom, den wir im ganzen Leben nicht ausschöpfen können. Römer 5,2 sagt uns, dass wir in der Gnade Gottes stehen. Petrus schreibt von der wahren Gnade Gottes, in der wir stehen (1. Pet 5,12). Sie begleitet uns täglich. Sie gibt uns Fundament und Festigkeit für unser Glaubensleben. Wir benötigen – gerade in Zeiten von Rückgang und Niedergang – ein deutlicheres Empfinden dafür, mit welchen Gedanken Gott an uns denkt – mit Gedanken der Güte und der Liebe. Gott sieht in Gnade auf uns. „Gnade“ kann man auch mit „Gunst“ oder „Wohlgefallen“ übersetzen. Das zeigt, mit welchen Empfindungen Gott in dem Herrn Jesus auf uns blickt. Die Bibel endet nicht ohne Grund mit den Worten: „Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen“ (Off 22,21). Wir alle haben dieses tiefe Empfinden nötig, dass die Gnade Gottes uns jeden Tag trägt.
Barmherzigkeit ist das Mitempfinden Gottes in elenden Umständen. Gnade und Barmherzigkeit liegen in ihrer Bedeutung nahe beieinander. Beides ist nur in Gott zu finden. Beides ist völlig unverdient. Barmherzigkeit hat – wie Gnade – mit unserer Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft zu tun. Dennoch besteht ein Unterschied. Barmherzigkeit setzt – im Unterschied zu der Gnade – unbedingt einen bemitleidenswerten und elenden Zustand voraus. Barmherzigkeit kann nur geübt werden, wenn jemand da ist, der sich in Not befindet. Was die Barmherzigkeit tut, wird vortrefflich in Lukas 10 in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorgestellt. Gott ist der Gott aller Gnade – und zwar unabhängig davon, ob die Gnade einen Gegenstand findet oder nicht. Barmherzigkeit hingegen sucht notwendigerweise einen Gegenstand, an dem sie sich erweisen kann. Deshalb wird Gott nicht der „Gott aller Barmherzigkeit“ genannt. Allerdings lesen wir, dass Er „reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe“ (Eph 2,4). Dieser Gedanke macht uns glücklich. Der Reichtum seiner Barmherzigkeit hat uns gerettet. Der Reichtum seiner Barmherzigkeit steht uns jetzt an jedem Tag unseres Lebens zur Verfügung. Unsere Lebensumstände mögen sehr unterschiedlich sein. Dennoch lebt jeder von uns täglich von der Barmherzigkeit Gottes. Wir denken an die Zeitverhältnisse, in denen wir leben. Wir denken an unser persönliches und gemeinschaftliches Fehlverhalten im Blick auf das Haus Gottes. Wir denken an den Verfall um uns herum und bei uns selbst. Wo wären wir ohne die Barmherzigkeit? Der Schreiber des Hebräerbriefes gibt folgende Ermunterung: „Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe“ (Heb 4,16).
Frieden hat mit der Ruhe in Gott und mit der Ruhe in den Umständen zu tun. Der Gläubige hat grundsätzlich Frieden mit Gott (Röm 5,1). Was unsere Stellung betrifft, gibt es nichts, was zwischen uns und einem heiligen Gott steht. Doch Gott will uns mehr schenken. Philipper 4,7 spricht von dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Dieser Friede Gottes kann durch nichts erschüttert und gestört werden. Kolosser 3,15 erwähnt den Frieden des Christus, der in unseren Herzen regieren und entscheiden soll. Als der Herr Jesus auf dieser Erde war, sagte Er den Jüngern: „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“ (Joh 14,27). Dieser Friede, den Er uns gibt, ist der Friede des Christus. Damit sind wir – selbst in schwierigen Umständen – völlig ruhig. Paulus genoss diesen Frieden selbst im Kerker in Rom. Er wünschte seinem Kind Timotheus – und damit uns – diesen Frieden. In dem Frieden Gottes zu leben, ist der beste Schutzwall gegen alle Angriffe des Teufels. Frieden ist im Übrigen das Ergebnis von Gnade und Barmherzigkeit. Deshalb wird Friede immer nach Gnade bzw. nach Barmherzigkeit genannt – nie vorher. Nur wer im tiefen Bewusstsein der Gnade und der Barmherzigkeit lebt, kann den Frieden Gottes wirklich genießen. Wer den „Gott aller Gnade“ nicht kennt, weiß wenig oder nichts von „dem Gott des Friedens“.
Von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn
Gnade, Barmherzigkeit und Friede sprudeln aus einer Quelle hervor. Diese Quelle ist Gott, der Vater. „Vater“ hat im Neuen Testament mindestens eine dreifache Bedeutung: An einigen Stellen spricht es von Unterscheidung, an anderen Stellen von Beziehung und wieder an anderen Stellen von Ursprung. Im Sinn von Unterscheidung finden wir den Begriff zum Beispiel in Matthäus 28,19. Dort werden die Jünger aufgefordert, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Die Bedeutung der Beziehung finden wir zum Beispiel an den Stellen, wo uns gezeigt wird, dass der große Gott in dem Herrn Jesus jetzt unser Vater ist, der uns liebt. Besonders Johannes stellt uns in seinen Schriften diese Seite vor. Der Gedanke an Ursprung kommt zum Beispiel in Epheser 1,17 vor. Dort ist die Rede von dem „Vater der Herrlichkeit“. Damit ist gemeint, dass Gott der Ursprung der Herrlichkeit ist.
Der Gedanke an Beziehung steht in unserem Vers sicherlich im Vordergrund. Paulus erinnert Timotheus daran, dass Gott in dem Herrn Jesus jetzt unser Vater geworden ist. Das ist eine unermessliche Segnung. Die Tatsache, dass hier eigentlich „Gott Vater“ steht, lässt dabei parallel den Gedanken an Ursprung zu. Gnade, Barmherzigkeit und Friede finden eben ihre Quelle in Ihm.
„... und Christus Jesus, unserem Herrn“. Es gibt keine Abstufung zwischen Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist genauso Gott wie der Vater. Beide Personen stehen hier nebeneinander. Dennoch werden beide unterschieden. Vielleicht können wir sagen, dass der Gedanke an Christus Jesus, unseren Herrn, uns an den einzigen Weg (oder das „Mittel“) erinnert, auf dem Gnade, Barmherzigkeit und Friede zu uns gelangen. Hätte derjenige, der jetzt zur Rechten Gottes verherrlicht ist, nicht einst als Mensch in Niedrigkeit auf dieser Erde gelebt – wir hätten nichts davon erfahren.
Paulus war ein Gefangener Roms. Die politischen Autoritäten konnten scheinbar willkürlich mit ihm verfahren. Sie hatten die Verfügungsgewalt. Dennoch hatte Paulus ein tiefes Empfinden dafür, dass dieser Christus Jesus der Herr und damit die höchste Instanz ist. Deshalb sah er sich als seinen Gefangenen. Das sollte Timotheus nicht vergessen. Wir benötigen ebenfalls das tiefe Empfinden, dass unserem Herrn im Himmel alle Gewalt gegeben ist. Er ist nicht nur unser Heiland, sondern Er ist der Herr unseres Lebens. Was immer geschehen mag, Er hat zu allem das letzte Wort zu sagen. Ihm läuft gar nichts aus der Hand.
Gebet
Verse 3.4: Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt sein möge.
Nach den einleitenden Worten beginnt Paulus nun mit einem Dankgebet. Paulus hatte ein sehr reichhaltiges Gebetsleben. Es bestand nicht nur aus Bitten, sondern daneben vor allem aus Danksagung. Dabei geht der Dank häufig der Bitte voraus. Wenn Paulus seinem Gott dankte – und das wird Timotheus gewusst haben –, war das keine „Pflichtübung“ oder reine Gewohnheit, sondern ein tief im Herzen empfundener Dank. Wir können davon lernen.
Das Wort „Dank“ unterscheidet sich an dieser Stelle von dem, was wir zu Beginn anderer Briefe finden. Es ist ein zusammengesetztes Wort, das man anders mit „Gnade haben“ übersetzen könnte. In 1. Timotheus 1,12 wird der gleiche Ausdruck benutzt. Paulus empfand es offenbar als eine besondere Gnade, an Timotheus im Gebet zu denken. Das ist ein Beweis des besonderen Verhältnisses dieser beiden Diener Gottes, das uns als Vorbild dient.
Paulus betete unablässig oder unaufhörlich. Das bedeutet nicht, dass er nichts anderes tat als zu beten, sondern meint vielmehr, dass er es regelmäßig, d. h. immer wieder, tat. Es war ihm eine – im positiven Sinn des Wortes – gute Gewohnheit, der er immer wieder nachging. Darin ist Paulus uns bis heute ein Vorbild.
Paulus betete Nacht und Tag. Es ist sicher nicht von ungefähr, dass die Nacht vor dem Tag erwähnt wird. Das deutet die Intensität an, mit der Paulus betete. Natürlich hatte er im Gefängnis mehr Zeit dazu als im aktiven Dienst. Dennoch tat Paulus auch im aktiven Dienst und in Freiheit gewisse Dinge „Nacht und Tag“:
1 In Apostelgeschichte 20,31 lesen wir, dass er die Gläubigen Nacht und Tag mit Tränen ermahnt hatte.
2 Die Thessalonicher erinnerte er zweimal daran, dass er Nacht und Tag gearbeitet hatte, um niemand auf der Tasche zu liegen (1. Thes 2,9; 2. Thes 3,8)
3 In 1. Thessalonicher 3,10 finden wir ihn – wie hier – ebenfalls im Gebet. Dort flehte er Nacht und Tag, um anderen geistlich helfen zu können