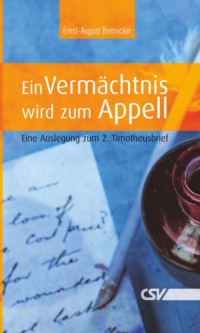Kitabı oku: «Ein Vermächtnis wird zum Appell», sayfa 3
Tränen
Paulus erwähnt nun die Tränen des Timotheus. Er hatte sie gut in Erinnerung. Wir fragen uns, wann Timotheus wohl geweint haben mag. Es wird uns nicht gesagt. Wir können uns gut vorstellen, dass Timotheus weinte, als Paulus sich von ihm verabschiedete. Seine Tränen waren kein Zeichen von Schwachheit. Sie zeigten vielmehr, dass Timotheus als gereifter Mann tiefe Empfindungen und geistliche Übungen hatte. Niemand von uns muss sich seiner Tränen schämen – selbst nicht im Dienst für den Herrn. Der Herr Jesus selbst hat geweint, als Er auf dieser Erde war. Das zeigt, wie vollkommen Er Mensch war. Paulus weinte ebenfalls. Als er Abschied von den Ältesten von Ephesus nahm, erwähnt er diesen Umstand gleich zweimal (Apg 20,19 und 31). Wir sollten Tränen nicht als ein Zeichen von Schwäche werten. Wer keine inneren Empfindungen hat, ist als Diener kaum nützlich.
Freude
Paulus befand sich in äußeren Umständen, die wenig Anlass zur Freude gaben. Wir fragen uns, wie er als ein Todgeweihter überhaupt von Freude sprechen kann. Er denkt hier nicht an die Freude, einmal bei seinem Herrn zu sein – eine Freude, die er ohne Zweifel gehabt hat (vgl. Kap 4,6–8). Er denkt nicht direkt an die „Freude im Herrn“ (Phil 4,4), die ebenfalls sein Teil war. Den Grund für die Freude gibt er an: Es war die Freude, Timotheus noch einmal wiederzusehen. Er war voll Verlangen, ihn zu sehen. Das Wort „Verlangen“ wird an anderen Stellen mit „Sehnen“ oder „begierig sein“ wiedergegeben. Das zeigt, wie sehr Paulus wünschte, sein Kind im Glauben noch einmal zu sehen. Wir erkennen, dass Paulus keineswegs abgestumpft war, sondern seine Einsamkeit tief empfand. Es würde für ihn eine Freude sein, Timotheus noch einmal bei sich zu haben, bevor er zu seinem Herrn gehen würde.
Als Paulus auf der ersten Reise nach Rom war – ebenfalls als Gefangener –, kamen ihm Brüder entgegen. Als Paulus sie sah, „dankte er Gott und fasste Mut“ (Apg 28,15). Wir lernen, welche positive Wirkung von der Gegenwart eines Bruders oder einer Schwester ausgehen kann, wenn sich jemand in misslichen Umständen befindet.
Das reine Gewissen des Paulus
Der Zwischensatz in Vers 3 ist nicht ganz einfach zu verstehen. Paulus spricht hier offensichtlich von der Zeit vor seiner Bekehrung und sagt, dass er Gott von seinen Voreltern her mit reinem Gewissen gedient hatte. In seiner Verteidigungsrede in Jerusalem vor dem Volk hatte Paulus gesagt: „Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien; aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott“ (Apg 22,3). Das wirft ein wenig Licht auf diese Aussage in unserem Vers. Wir könnten es vielleicht so erklären, dass Paulus hier seine eigene Beurteilung der Sache abgibt – so wie er es empfunden hatte. Gott sah das, was Paulus tat, natürlich nicht für richtig an. Paulus selbst verurteilt es an anderer Stelle deutlich. Was er tat, tat er dennoch – aus seiner damaligen Sicht – mit einem reinen Gewissen. Er war sich keiner Schuld bewusst – was ihn selbstverständlich nicht unschuldig machte. Er glaubte aufgrund seiner Ausbildung und Zurüstung tatsächlich, Gott einen Dienst zu erweisen, indem er die Gläubigen verfolgte.
Gott hat jedem Menschen ein Gewissen gegeben. Dafür sollten wir Ihm dankbar sein. Wir lernen allerdings, dass unser Gewissen allein kein geeigneter Maßstab ist. Es gleicht einer Waage, die geeicht sein muss, damit man etwas mit ihr anfangen kann. So müssen wir unser Gewissen am Wort Gottes ausrichten. Das Gewissen kann weder die eindeutigen Aussagen der Bibel noch die Leitung durch den Heiligen Geist ersetzen. Wir tun gut daran, dem Beispiel von Paulus zu folgen: Nachdem er gläubig geworden war, bemühte er sich, „ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen“ (Apg 24,16). Das Neue Testament spricht vom „guten“ und „bösen“ Gewissen, vom „reinen“ und vom „schwachen“ Gewissen. Das Gewissen ist in der Tat das innere Überwachungs- und Steuerungsinstrument im Menschen, das die Fähigkeit der Unterscheidung hat (Heb 10,2; Röm 2,15; 9,1; 2. Kor 1,12). Ohne das Wort Gottes und ohne den Heiligen Geist kann es uns trotzdem in die Irre führen.
Wir fragen uns, warum Paulus diesen Tatbestand gerade an dieser Stelle erwähnt. Eine mögliche Erklärung ist, dass er Timotheus daran erinnern will, dass dieser ihm etwas voraus hatte. Timotheus war anders erzogen worden als Paulus. Seine eigene Erziehung – selbst wenn sie von seinen Eltern gut gemeint war – hatte ihn auf einen falschen Weg geführt. Timotheus hingegen hatte eine Mutter und eine Großmutter, die ihm echten Glauben vorgelebt hatten. Davon spricht Paulus in Vers 5. Dieser ungeheuchelte Glaube war mehr wert als das reine Gewissen, auf das schon die Eltern von Paulus Wert gelegt hatten.
Ungeheuchelter Glaube
Vers 5: ... indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir.
Paulus erinnerte sich nicht nur an seine eigenen Voreltern. Er hatte ebenso eine Erinnerung – und zwar eine gute – an die Mutter und die Großmutter von Timotheus. In drei Generationen fand er ungeheuchelten Glauben. Dabei ist klar, dass es hier nicht um den jüdischen, sondern um den christlichen Glauben geht. Timotheus' Mutter war zwar Jüdin (Apg 16,1), aber sie war gläubig geworden. Sie glaubte also an den Herrn Jesus. Dieser ungeheuchelte Glaube war nicht einfach da, sondern Paulus war überzeugt, dass er in diesen drei Personen wohnte, d. h., er hatte dort einen festen Platz, ein „Zuhause“.
Der Glaube verbindet uns mit Gott. Er ist nicht nur die Hand, die das Heil ergreift, das Gott uns in Christus anbietet. Er ist gleichzeitig die Hand, die uns als Gläubige in ständiger Verbindung mit dem Himmel hält. Nur durch den Glauben sind wir in der Lage, den Segen zu genießen, den Gott uns gibt, um als himmlische Menschen auf der Erde zu leben. Deshalb soll dieser Glaube wachsen (2. Thes 1,3). Es ist nicht damit getan, einmal geglaubt zu haben. Durch den Glauben bleiben wir in dieser ständigen Beziehung nach oben. Dieser Glaube war bei Timotheus, bei seiner Mutter und bei seiner Großmutter vorhanden.
Dann wird der Charakter ihres Glaubens vorgestellt: Er war ungeheuchelt. Das Gegenteil ist ein geheuchelter Glaube. Das Wort „heucheln“ beschreibt zum Beispiel einen Schauspieler, der auf der Bühne etwas vorspielte, was nicht den Tatsachen und dem eigenen Charakter der Person entsprach. Solche Schauspieler gaben vor, jemand anderes zu sein, als sie in Wirklichkeit waren. Das ist eine Falschheit, die bei Timotheus und seinen weiblichen Vorfahren nicht gefunden wurde.
An uns geht ebenfalls die Aufforderung, einen „echten“ und „ungeheuchelten“ Glauben zu haben. Wir sollen in unserem Denken, Reden und Handeln echt, aufrichtig und transparent sein. Jede geistliche Schauspielerei gehört sich für einen Christen nicht. Wir sollen keine Maske tragen.
Paulus hatte im ersten Brief an Timotheus von Personen geschrieben, die vom Glauben abfallen werden (Kap. 4,1). Er hatte Menschen erwähnt, die in Bezug auf den Glauben Schiffbruch erlitten hatten (Kap. 1,19). Im Verlauf des zweiten Briefes spricht er von Menschen, die den Glauben anderer zerstörten (Kap. 2,18). Wie muss es ihn da gefreut haben, hier echten und ursprünglichen Glauben zu finden.
Das Neue Testament spricht in 1. Timotheus 1,5 noch einmal vom ungeheuchelten Glauben. Darüber hinaus lesen wir von der ungeheuchelten Liebe (Röm 12,9; 2. Kor 6,6), von der ungeheuchelten Bruderliebe (1. Pet 1,22) und von der ungeheuchelten Weisheit (Jak 3,17).
Die Familie des Timotheus
Glaube ist etwas ganz Persönliches. Glaube kann nicht vererbt werden. Dennoch ist es der erklärte Wille Gottes, dass der Glaube nicht bei einem Einzelnen bleibt, sondern in der Familie entwickelt wird. Das nimmt nichts von der persönlichen Verantwortung weg. Der Gedanke Gottes ist immer „du und dein Haus“. In der Familie des Timotheus – zumindest bei den Frauen – hatte sich ein gutes geistliches Klima entwickelt. Timotheus hatte gleich zwei Vorbilder, von denen er lernen konnte. Der Vater wird bezeichnenderweise nicht erwähnt. In Apostelgeschichte 16,1 wird lediglich gesagt, dass Timotheus der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau war und dass er einen griechischen Vater hatte. Wir können daraus eventuell die Schlussfolgerung ziehen, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht errettet war.
Auf uns übertragen heißt das, wir sind gefordert, ein gesundes geistliches Klima in unseren Familien zu entwickeln. Kinder beobachten ihre Eltern. Sie merken sehr schnell, ob der Glaube echt oder geheuchelt ist. Es ist wichtig, dass wir von unserem Glauben reden. Es ist wichtiger, unseren Glauben zu leben. Beides hat seinen Platz. Das „Vorleben“ haben wir hier. Später, in Kapitel 3,15, spricht Paulus von dem, was in der Familie des Timotheus „geredet“ wurde. Timotheus kannte von Kind auf die Heiligen Schriften. Wie war das möglich? Indem sie zu Hause gelesen wurden und Timotheus sie hören konnte.
Die Gnadengabe des Timotheus
Vers 6: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände.
Paulus kommt jetzt mit einem ersten Appell zu Timotheus. Er hatte diesen Appell durch das, was er einleitend gesagt hatte, gut vorbereitet. Deshalb sagt er: „Aus diesem Grund...“. Zugleich trägt er sein Anliegen in einer sehr milden Form vor. Es ist eine Erinnerung, die zwar den Charakter einer Ermahnung trägt, dabei jedoch gleichzeitig eine Ermunterung für Timotheus war.
Timotheus hatte eine besondere Gnadengabe von Gott empfangen. Dabei handelte es sich nicht – wie manchmal gesagt wird – um den Heiligen Geist, sondern es war eine ganz bestimmte geistliche Befähigung und zugleich ein Auftrag zum Dienst. Timotheus war wohl in erster Linie Evangelist (Kap 4,5). Zugleich hatte er einen Dienst als Hirte und Lehrer im Volk Gottes (1. Tim 4,13–16). Diese Gnadengabe sollte er anfachen.
Von der Gnadengabe des Timotheus werden zwei Dinge gesagt: erstens, dass sie von Gott kommt; zweitens, dass sie durch das Auflegen der Hände von Paulus vermittelt wurde. Die erste Aussage gilt für jede Gnadengabe. Die zweite Aussage bildet eine Ausnahme. Wir finden in den beiden Briefen an Timotheus mehrmals einen Hinweis auf seine Gnadengabe. Nur wenn wir diese Hinweise zusammen betrachten, ergibt sich ein vollständiges und damit richtiges Bild:
1 Der Ursprung der Gnadengabe des Timotheus ist ohne jede Frage Gott. Sie wird in unserem Vers „Gnadengabe Gottes“ genannt, was auf den Ursprung hinweist.
2 1. Timotheus 1,18 und 4,14 machen deutlich, dass es spezielle Weissagungen über seine Gnadengabe gegeben hat. Wem diese Weissagungen gegeben waren und wer sie ausgesprochen hat, wird nicht gesagt. Timotheus wird es sicher im Nachhinein gewusst haben.
3 Vermittelt wurde die Gnadengabe offensichtlich durch Paulus. Er hatte Timotheus die Hände aufgelegt, d. h., er hatte sich mit ihm einsgemacht. Paulus war also das Instrument, durch das die Gnadengabe in Timotheus tatsächlich wirksam wurde. Ihr Ursprung jedoch bleibt selbstverständlich Gott.
4 Die Ältesten seiner Heimatversammlung hatten sich mit ihm einsgemacht. Wir lesen in 1. Timotheus 4,14: „mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft“. Das war ein Ausdruck der Gemeinschaft. Sie erkannten die Gnadengabe Gottes in Timotheus an und freuten sich darüber.
Exkurs: Gnadengaben heute
Das Thema „Gnadengaben“ ist ein aktuelles Thema, das viele Christen beschäftigt. Deshalb dazu einige kurze Gedanken:
Das griechische Wort für „Gnadengabe“ ist von dem Wort für „Gnade“ abgeleitet und bedeutet so viel wie eine „wohlwollend gespendete Gabe“, ein „Gnadengeschenk“. An den meisten Stellen im Neuen Testament wird damit eine von Gott geschenkte geistliche Befähigung und Aufgabe zum Dienst bezeichnet. Die Bedürfnisse der einzelnen Glieder am Leib Christi sind ganz unterschiedlich. Deshalb hat Gott verschiedene Gnadengaben gegeben. Eine Gnadengabe sollten wir nicht mit einer natürlichen Befähigung verwechseln. Natürliche Fähigkeiten sind durchaus eine Gabe Gottes, jedoch keine Gnadengabe im eigentlichen Sinn. Ungläubige Menschen haben selbstverständlich ebenfalls von ihrem Schöpfer natürliche Fähigkeiten bekommen.
Eine Hilfestellung dazu gibt uns Matthäus 25,14.15. Dort spricht der Herr Jesus von den Talenten, die Er seinen Dienern anvertraut hatte. Diese unterschiedlichen Talente könnte man ebenfalls eine Aufgabe zum Dienst nennen und mit einer Gnadengabe vergleichen. Diese Talente werden je nach eigener Fähigkeit gegeben. Die eigene Fähigkeit können wir mit den natürlichen Befähigungen vergleichen, die Gott als Schöpfer uns gegeben hat (zum Beispiel die Fähigkeit, mit Kindern oder alten Leuten umzugehen, Sprach- und Redefähigkeit usw.). Die natürliche Fähigkeit eines Christen ist sozusagen das Gefäß, in das Gott eine Gnadengabe hineinlegt. Wer zum Beispiel nicht gut reden kann, dem wird Gott kaum die Gabe des Lehrens geben, es sei denn, er kann gut schreiben. Wer nicht gut mit Menschen umgehen kann, wird kaum die Gabe eines Hirten bekommen.
In der Christenheit hat man heute kaum mehr eine biblisch fundierte Kenntnis über die Gnadengaben. Der Grund dafür liegt darin, dass in vielen Kirchen und Gemeinden offizielle Amtsträger eingestellt worden sind, die die unterschiedlichen Dienste übernehmen sollen. Selbst da, wo man die Freiheit des Geistes im Dienst kennt, hat man oft eine eingeschränkte Sichtweise der von Gott gegebenen Gnadengaben. Es wäre falsch, hierbei nur an Hirten, Lehrer und Evangelisten zu denken. Es ist wohl wahr, dass diese drei Gnadengaben in Epheser 4 genannt werden. Man muss allerdings erstens bedenken, dass in Epheser 4 für „Gabe“ ein anderes Wort als für „Gnadengabe“ benutzt wird. Zweitens ist es wichtig zu beachten, dass es in Epheser 4 die Personen selbst sind, die der erhöhte Herr der Versammlung als „Gabe“ gegeben hat. Das Ziel wird dabei wie folgt angegeben: „zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus“ und zwar „bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann“ (Eph 4,12.13).
Wenn wir ein richtiges Bild über die Verschiedenheit der Gnadengaben haben wollen, müssen wir Römer 12 und 1. Korinther 12 lesen. Dort sehen wir die Vielfalt der Gnadengaben in unterschiedlichen Bereichen. An beiden Stellen wird die Versammlung mit einem menschlichen Körper verglichen, der aus vielen Gliedern besteht. So wie an diesem Körper jedes Glied seinen eigenen Platz und seine besondere Funktion hat, so ist es auch in dem (geistlichen) Leib Christi. Beide Texte nennen eine Vielzahl von verschiedenen Gnadengaben, wobei die Aufstellung immer nur beispielhaft und nicht vollständig ist. In Römer 12 werden zum Beispiel sieben Gnadengaben ausdrücklich genannt: Weissagung, Dienst, Lehre, Ermahnung, Geben, Vorstehen, Ausüben von Barmherzigkeit.
Bis heute gibt es von Gott gegebene Gnadenaufgaben. Sie sind notwendig, damit das christliche Zeugnis weiter ausgebreitet wird und aufrechterhalten bleiben kann. Wenn wir die verschiedenen Abschnitte, in denen von Gnadengaben die Rede ist (besonders Röm 12 und 1. Kor 12) im Zusammenhang besehen, dann können wir die Belehrung über dieses Thema wie folgt kurz zusammenfassen:
1 Der Ursprung einer Gnadengabe ist immer Gott. Deshalb ist es keine menschliche Gnadengabe, sondern eine Gnadengabe Gottes (2. Tim 1,6).
2 Der Geber ist der verherrlichte Herr im Himmel. Er sorgt vom Himmel aus dafür, dass für jede Aufgabe die notwendige Gnadengabe vorhanden ist (Eph 4,11).
3 Der Heilige Geist teilt ebenso die Gnadengaben aus. Zugleich gibt er Kraft zur Ausübung. Ohne seine Kraft ist es nicht möglich, eine Gnadengabe richtig auszuüben (1. Kor 12,11).
4 Die Gnadengaben werden in Verantwortung dem Herrn gegenüber (1. Kor 12,5) und unter der Leitung des Heiligen Geistes ausgeübt (Apg 13,2). Der Heilige Geist gibt nicht nur die Kraft, eine Gnadengabe zu praktizieren, sondern Er leitet uns in der tatsächlichen Ausübung.
5 Es sind verschiedene Gnadengaben, die der Herr gibt (1. Kor 12,4). Niemand könnte von sich behaupten, alle Gnadengaben in sich zu vereinen. Die Folge ist, dass wir einander nötig haben (1. Kor 12,21).
6 Es gibt niemand im Volk Gottes, der nicht eine Gnadengabe empfangen hätte (1. Pet 4,10). Daraus folgt, dass jeder an seinem Platz gebraucht wird.
7 Der Besitz einer Gnadengabe ist einerseits ein großer Segen. Er zieht andererseits die Verantwortung nach sich, sie richtig und angemessen zum Nutzen anderer und zur Ehre des Herrn auszuüben (1. Kor 12,7).
Die Gnadengabe anfachen
Timotheus wird nun aufgefordert, die Gnadengabe anzufachen, die in ihm war. Dieser Hinweis scheint mehr vorbeugend als korrigierend zu sein. Das Wort „anfachen“ wird im Neuen Testament nur an dieser Stelle verwendet. Das Bild ist gut verständlich: Es geht um ein Feuer, das man wieder anfacht, wenn es auszugehen droht. Die Glut soll wieder entflammt werden bzw. das Feuer soll brennend erhalten werden. Die benutzte Zeitform weist darauf hin, dass es nicht um eine einmalige, sondern um eine beständige Handlung geht. Gaben werden durch ständige Benutzung aktiviert bzw. aktiv gehalten. Bei Nichtgebrauch verschwinden sie zwar nicht, verlieren allerdings ihre Wirkung.
In 1. Timotheus 4,14 hatte Paulus bereits einen ähnlichen Hinweis gegeben. Dort wird Timotheus aufgefordert, die Gnadengabe nicht zu vernachlässigen. Eine Gnadengabe wird dann vernachlässigt, wenn sie nicht aktiv eingesetzt wird. Hier drückt Paulus sich positiv aus: Er sollte die Gnadengabe anfachen. In der konkreten Situation, in der er sich befand, hatte Timotheus diesen Hinweis nötig. Zum einen war Timotheus wahrscheinlich durch eine natürliche Zurückhaltung und Demut geprägt. Diese an und für sich positiven Eigenschaften konnten ihn daran hindern, seine Gnadengabe mit Mut und Elan auszuüben. Dazu kamen die nicht einfachen äußeren Umstände. Unter den Gläubigen war sicher bekannt, dass er treu zu Paulus stand. Insofern wird man ihn als Freund von Paulus unter Umständen eher kritisch betrachtet haben. In seiner Arbeit als Evangelist konnte er leicht mutlos werden, da es durchaus gefährlich war, sich öffentlich auf die Seite der Christen zu stellen.
Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit
Vers 7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Paulus spricht jetzt nicht länger nur von Timotheus, sondern er schließt sich mit ein. „Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben.“ Das gilt für jeden, der eine Gnadengabe bekommen hat. Wenn Gott eine Gnadengabe gibt, dann gibt Er ohne Zweifel gleichzeitig die Kraft, sie auszuüben.
Es stellt sich die Frage, ob mit „Geist“ der Heilige Geist oder der Geist des Menschen gemeint ist. Das für „Geist“ benutzte griechische Wort bezieht sich manchmal auf den Heiligen Geist und manchmal auf den menschlichen Geist. Hier steht es ohne Artikel, was ein Hinweis darauf sein mag, dass es sich nicht um den Heiligen Geist, sondern um den menschlichen Geist handelt, genauer gesagt um die Geisteshaltung des Christen, die natürlich wieder nur durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes hervorgerufen wird. Insofern ist eine Trennung nicht ganz einfach.
Furchtsamkeit meint Feigheit. Das Wort kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor und hat einen negativen Beigeschmack. Es ist das Gegenteil von Entschlossenheit und Beherztheit. Timotheus benötigte geistliche Entschiedenheit, um in einer schweren Zeit das Evangelium zu predigen und für die Wahrheit einzustehen. Gleiches gilt für uns heute. Die benötigten Hilfsquellen sind vorhanden. Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Das sind keine natürlichen Qualitäten des Menschen, sondern eine innere Haltung, die Er durch seinen Geist in uns schafft. Schauen wir sie uns kurz im Einzelnen an:
Kraft: Wir sahen, dass Gott nicht nur die Gnadengabe gibt, sondern gleichzeitig die nötige Kraft, um sie auszuüben. Wir haben moralische und vor allem geistliche Kraft nötig. Wir können diese nur bekommen, wenn wir unsere eigene Schwäche eingestehen. Paulus hatte das selbst erfahren. Ihm wurde gesagt, dass die Kraft des Herrn in Schwachheit vollbracht wird. Nachdem Paulus das gelernt hatte, sagte er selbst: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ (2. Kor 12,10). Die Kraft, die wir haben, ist nicht unsere eigene Kraft. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes (vgl. Apg 1,8).
Liebe: Die Liebe muss das Motiv zur Ausübung jeder Gnadengabe sein. Es ist zuerst die Liebe zu Gott, dem Geber der Gabe. Es ist dann zweitens die Liebe zu unseren Mitgeschwistern und darüber hinaus die Liebe zu allen Menschen. Es soll die Liebe des Christus sein, die uns drängt. Kraft allein kann egoistisch und emotionslos ausgeübt werden. Deshalb gehört Liebe unbedingt dazu.
Besonnenheit: Besonnenheit meint „Selbstbeherrschung“, „Nüchternheit“, „gesunder Sinn“. Zur Kraft und Liebe kommt diese dritte Eigenschaft hinzu. Kraft und Liebe allein können den Diener schwärmerisch und unnüchtern machen. Die Besonnenheit benutzt den Verstand, den Gott uns gegeben hat. Kein Christ wird dazu aufgefordert, den Verstand ausschalten. Wir sollen uns zwar nicht auf unseren Verstand stützen, ihn jedoch sehr wohl einsetzen. Wir sollen am Verstand Erwachsene (Vollkommene) werden (1. Kor 14,20). Es ist bemerkenswert, wie häufig im Buch der Sprüche über den Verstand gesprochen wird. Es ist wieder die Gnade, die uns zur Besonnenheit unterweist (Tit 2,12).
Man kann von diesem Vers aus eine gewisse Parallele zu 1. Korinther 12–14 ziehen. In diesen drei Kapiteln wird das Thema der geistlichen Gnadengaben ausführlich behandelt. In Kapitel 12 geht es um den Geist der Kraft, d. h., um die Kraft, in der die Gaben ausgeübt werden. Kapitel 13 spricht von der Liebe, dem wahren Motiv für jeden Dienst. Kapitel 14 zeigt uns den Geist der Besonnenheit, der bei der Ausübung der Gaben nicht fehlen darf.