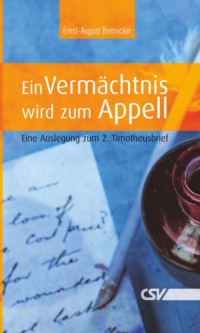Kitabı oku: «Ein Vermächtnis wird zum Appell», sayfa 4
Schäme dich nicht
Vers 8: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium, nach der Kraft Gottes.
Timotheus stand aufgrund seines Umfeldes in einer gewissen Gefahr, sich zu schämen. Die benutzte Zeitform macht klar, dass es sich um eine vorbeugende Warnung handelt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Timotheus sich bereits geschämt hatte. Er befand sich möglicherweise in einer bestimmten Gefahr, der Paulus vorbeugen wollte. Deshalb hatte er in Vers 7 von dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gesprochen. Die angesprochene Gefahr gilt für uns ebenso. In Segenszeiten fällt es nicht so schwer, stark zu sein und sich zu dem Herrn zu bekennen. Wenn der Wind uns allerdings entgegenbläst und wir zum Beispiel in ungläubiger Umgebung auf uns allein gestellt sind, mag es schnell anders aussehen.
Als mögliche Ursache für die Scham des Timotheus nennt Paulus zwei Gründe: erstens das Zeugnis des Herrn und zweitens sich selbst, den Gefangenen des Herrn.
Das „Zeugnis des Herrn“ kann man auf zweierlei Weise verstehen: Zum einen kann es sich um das Zeugnis handeln, das der Herr uns gegeben hat. Dann ist die christliche Lehre, das Glaubensgut, gemeint, das wir predigen und weitergeben. Da es hier mit dem Evangelium verbunden wird, geht es wohl konkret um die uns anvertraute Botschaft des Heils in Christus. Zum anderen kann man an das Zeugnis denken, das wir von unserem Herrn und über Ihn ablegen (vgl. Apg 4,33). Beide Seiten sind eigentlich nicht zu trennen. Das Evangelium der Gnade ist genauso untrennbar mit der Person unseres Herrn Jesus verbunden wie die christliche Glaubenswahrheit.
Paulus war ein Gefangener Roms. Dennoch bezeichnet er sich weder hier noch an anderen Stellen so, sondern nennt sich ein Gefangener des Herrn. Sich zu diesem Gefangenen zu bekennen, konnte für Timotheus unangenehme Folgen haben. Einerseits hatten alle Gläubigen in Asien sich von Paulus abgewandt. Andererseits war er ja gerade aufgrund seines Glaubens ein Gefangener in Rom.
Paulus selbst war ein Vorbild für Timotheus. In Römer 1,16 schreibt er, dass er sich des Evangeliums nicht schämte. In Vers 12 unseres Kapitels wiederholt er diese Aussage. Onesiphorus war ebenfalls ein positives Beispiel (Kap 1,16), und in Kapitel 2,15 wird Timotheus gesagt, dass er sich befleißigen sollte, sich als ein Arbeiter Gott bewährt darzustellen, der sich nicht zu schämen hat.
Leide Trübsal
Timotheus wird dann aufgefordert, mit dem Evangelium Trübsal zu leiden. Der Kontrast ist auffällig. Sich nicht zu schämen wird dem „Trübsal leiden“ gegenübergestellt. Dreimal spricht Paulus in diesem Brief davon. In Kapitel 2,3 wird Timotheus aufgefordert, als ein guter Streiter Christi Jesu an den Trübsalen teilzunehmen. In Kapitel 4,5 wird gesagt: „Leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst.“
Wir alle nehmen gern an dem Segen des Evangeliums teil – und das ist richtig so. Unser Herr erwartet dabei gleichzeitig, dass wir bereit sind, mit dem Evangelium zu leiden. In dem Evangelium zu kämpfen, kann in der Tat Trübsal und Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Es geht im Evangelium ohnehin nicht primär um den äußerlichen Erfolg. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen begeistert sind und uns zustimmen. Wir sind sicher dankbar, wenn Gott uns Frucht unserer Arbeit sehen lässt; das ist jedoch nicht der Hauptgedanke. Von außen betrachtet war das Leben von Paulus durchaus nicht von bleibendem Erfolg gekrönt. Er war im Gefängnis, und diejenigen, die er zum Herrn geführt hatte, wandten sich von ihm ab. War das ein Beweis für erfolgreiche Arbeit? Oberflächlich betrachtet nicht.
Wir schauen nicht primär nach den Ergebnissen aus. Wir wollen das festhalten, was der Herr uns gegeben hat und die Predigt nicht aufgeben. Die Ergebnisse zeigen sich vielleicht nicht auf der Erde, aber ganz gewiss im Himmel. Da sehen wir, dass jedes Werk Gottes erfolgreich war. Hier auf der Erde kann es sogar sein, dass wir Trübsal leiden werden.
Es ist augenscheinlich, dass wir dazu ebenfalls Kraft nötig haben. Diese Kraft steht uns tatsächlich zur Verfügung. Wir leiden Trübsal mit dem Evangelium (oder für das Evangelium). Wir tun es „nach der Kraft Gottes“.
Ein Einschub
Vers 9: ... der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ...
Bevor Paulus in Vers 12 weiter über das Thema Scham und Trübsal spricht, gibt er in den Versen 9–11 einen knappen Überblick über herrliche Tatsachen, die mit diesem Evangelium in Verbindung stehen. Man hat fast den Eindruck, dass er Timotheus daran erinnern will, dass äußere Trübsal nur eine mögliche Begleiterscheinung dieses Evangeliums ist. Für den Christen selbst eröffnet sich im Evangelium eine gewaltige Fülle an inneren Schönheiten und Segnungen, die Paulus hier nur mit knappen Worten andeutet.
Wenn wir einen Beweis für die Kraft Gottes suchen, dann finden wir ihn unter anderem im Evangelium. Das Evangelium ist „Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden“ (Röm 1,16).
Es ist Gott, der uns sowohl berufen als auch errettet hat. Beides finden wir im Evangelium offenbart und vorgestellt. Das große Thema des Evangeliums ist ja gerade das Heil (die Errettung) Gottes. Gott ist ein Heiland-Gott, der alle retten will. Damit beginnt Paulus hier. Er spannt dann einen Bogen, der über die Ewigkeit vor der Zeit („vor ewigen Zeiten“) in die Gegenwart („jetzt aber offenbart worden ist“) hineinreicht und schließlich sogar in die Zukunft geht („an jenem Tag“ in V. 12).
Errettet und berufen
Gott hat uns erstens errettet und zweitens berufen. Errettung und Berufung sind zwei Segnungen, die wir wohl unterscheiden, jedoch nicht voneinander trennen können.
Errettung ist mehr als die Vergebung der Sünden – so groß und gewaltig diese an sich schon ist. Als das Volk Israel unter dem Blut des Passahlamms stand, waren sie von dem Gericht befreit, das die Ägypter traf. Damit waren sie allerdings noch nicht aus dem Machtbereich des Pharaos gerettet. Das war erst der Fall, als sie am anderen Ufer des Roten Meers standen und das Lied der Erlösung anstimmten. Die Befreiung von Strafe und Gericht ist eine Seite des Evangeliums. Die Rettung aus dem Machtbereich Satans und die Befreiung von dem Zwang, sündigen zu müssen, ist eine andere Seite. Beides besitzen wir durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Das macht der Römerbrief in seinem lehrmäßigen Teil (Kapitel 1–8) sehr klar.
Wenn von Errettung die Rede ist, wird uns häufig gezeigt, wovon wir errettet sind und woher wir kamen. Wir sind gerettet aus der Gewalt der Finsternis (Kol 1,13). Wir werden gerettet von dem kommenden Zorn (1. Thes 1,10). Wir sind gerettet aus der Hand unserer Feinde (Lk 1,74). Wir sind gerettet von dem bösen und verkehrten Geschlecht (Apg 2,40). Diesen Blick zurück tun wir mit großer Dankbarkeit, weil wir wissen, in welcher Gefahr wir alle standen.
Gott hat uns nicht nur gerettet. Er hat uns ebenfalls berufen – und zwar mit heiligem Ruf. Lässt uns die Errettung eher nach hinten sehen, so richtet sich der Blick im Gedanken an unsere Berufung eher nach vorn. Wenn von Berufung die Rede ist, wird uns an manchen Stellen gezeigt, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen zu seinem wunderbaren Licht (1. Pet 2,9). Wir sind berufen, Segen zu erben (1. Pet 3,9). Wir sind zur Freiheit berufen (Gal 5,13). Wir sind zur Herrlichkeit berufen (1. Pet 5,10; 2. Thes 2,14). Wir sind zum ewigen Leben berufen (1. Tim 6,12). Wenn es um das Ausmaß unserer Berufung geht, dann lernen wir in Epheser 1, dass wir zur Kindschaft und zur Sohnschaft berufen sind. Das alles ist dazu angetan, den Diener Gottes in schwerer Zeit zu ermuntern. Es gibt jedoch ebenfalls eine Berufung für diese Zeit. In Apostelgeschichte 13,2 lesen wir ausdrücklich, dass Barnabas und Paulus von dem Heiligen Geist zu einem besonderen Werk berufen waren. Es ist denkbar, dass Paulus diesen Gedanken hier ebenfalls vor Augen hat und die Berufung mit der Gnadengabe des Timotheus und dem Zeugnis unseres Herrn verbindet, wovon er vorher gesprochen hat.
Dabei wird noch etwas deutlich: Paulus erinnert daran, dass wir mit (oder zu) heiligem Ruf berufen worden sind. Der Ursprung unserer Berufung ist himmlisch (Heb 3,1). Das Ziel der Berufung Gottes ist „nach oben“ (Phil 3,14). Der Charakter – und das steht hier vor uns – ist „heilig“ (vgl. 1. Pet 1,15; 1. Thes 4,7). Wir sind zur Heiligkeit berufen. Heilig bedeutet nicht nur, dass wir von der Welt getrennt sind, sondern es bedeutet, dass Gott uns für sich haben will. Gott hat von Anfang an Licht und Finsternis geschieden (1. Mo 1,3). Daran wird Timotheus hier erinnert, weil sich viele seiner Zeitgenossen dieser heiligen Berufung nicht würdig erwiesen.
Nicht aus Werken
Errettung und Berufung sind nicht aus uns. Wir konnten und können dazu nichts beitragen. Römer-, Galater- und Epheserbrief machen das ganz deutlich (vgl. z. B. Röm 3,20; Gal 2,16; Eph 2,9). Errettung und Berufung sind niemals die Belohnung für eigenes Tun. Sie haben ihre Quelle ausschließlich in Gott. Der ungläubige Mensch kann gar kein gutes Werk tun. Seine Werke sind tote Werke. Gott kann sie nicht anerkennen.
Dennoch hat Gott in seiner Gnade gehandelt. Paulus zeigt nun die Absicht Gottes, das Motiv Gottes und den Weg Gottes, den Er gegangen ist.
1 Die Absicht Gottes: Wir sind errettet und berufen nach seinem eigenen Vorsatz, d. h., sein Handeln wurde bestimmt von dem Plan, den Er in der Ewigkeit vor der Zeit gefasst hat. Es war der ewige Plan (Vorsatz, Absicht) Gottes, es so zu machen. Längst vor dem Sündenfall hatte Gott es in seinem Herzen, Menschen zu sich zu bringen. In Bezug auf sein irdisches Volk Israel hatte Gott einen zeitlichen Ratschluss gefasst. In Bezug auf sein himmlisches Volk lesen wir von einem ewigen Vorsatz (Eph 3,11). Der Vorsatz selbst geht weiter als Errettung und Berufung. Wir werden – dem Bild seines Sohnes gleichförmig – als Kinder und Söhne Gottes im Vaterhaus sein (Röm 8,29). Um diesen Ratschluss Wirklichkeit werden zu lassen, musste Gott uns erretten und berufen. Der Ausdruck „nach seinem eigenen Vorsatz“ zeigt die Souveränität Gottes. Niemand konnte Ihn daran hindern, diesen Ratschluss zu fassen und ihn dann auszuführen.
2 Das Motiv Gottes: Er hat in Gnade mit uns gehandelt. In uns gab es nichts, was Gott hätte veranlassen können, uns zu retten und zu berufen. Es waren seine Gnade und seine Barmherzigkeit – Ausfluss seiner Liebe. Diese Gnade ist uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Das will sagen, in dem ewigen Ratschluss Gottes war diese Gnade bereits in der Ewigkeit vor der Zeit vorhanden. Tatsächlich offenbart wurde sie in der Zeit in der Person des Herrn Jesus. In Ihm ist die Gnade Gottes erschienen. Wir sehen hier, dass Gnade viel weiter geht, als nur eine Antwort auf das Problem der Sünde zu geben. Schon vor dem Sündenfall gab es Gnade – sie war nötig, wenn der Ratschluss Gottes erfüllt werden sollte.
3 Der Weg Gottes: Es gibt nur einen Weg zum Heil. Dieser Weg ist der Herr Jesus. Das Heil ist uns „in (oder durch) Christus Jesus“ gegeben. Bereits in der Ewigkeit vor der Zeit stand fest, dass die Gnade uns nur auf diesem Weg erreichen konnte. Dazu war es nötig, dass Er Mensch wurde und das Werk am Kreuz vollbrachte. Deshalb ist Er zugleich das Lamm Gottes, das zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt (1. Pet 1,20), aber offenbar geworden am Ende der Zeiten. Das führt dann direkt zu Vers 10.
Die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus und ihre Folgen
Vers 10: ... jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
„Erscheinung“ nimmt immer Bezug auf etwas, das erkennbar wird, sei es eine Sache oder eine Person. In Verbindung mit dem Herrn Jesus geht es darum, dass Er sichtbar „offenbar“ wird. Mit Ausnahme unserer Stelle nimmt „Erscheinung“ an allen anderen Stellen im Neuen Testament Bezug auf seine Erscheinung in Macht und Herrlichkeit vor der Aufrichtung des 1000-jährigen Friedensreiches (1. Tim 6,14; 2. Tim 4,1; 2. Tim 4,8; Tit 2,13; 2. Thes 2,8). Nur hier ist es anders. Paulus erinnert daran, dass die Gnade Gottes in Christus erschienen ist. In Ihm ist die Gnade Gottes erschienen, „Heil bringend für alle Menschen“ (Tit 2,11).
„Jetzt aber...“ meint in der Haushaltung der Gnade, die ihren Anfang nahm, als der Herr Jesus als Heiland auf dieser Erde sichtbar für alle Menschen erschien. Er tritt hier als der „Heiland Jesus Christus“ vor uns. Heiland bedeutet Retter. Jesus ist sein Name als Mensch. „Du sollst seinen Namen Jesus nennen“ (Mt 1,21). Als Christus ist Er nach vollbrachtem Werk jetzt zur Rechten Gottes hoch erhoben. Gott hat Ihn zum „Herrn und zum Christus gemacht“ (Apg 2,36).
Tod und Verwesung sind Folgen des Sündenfalls. Sie sind der Beweis, dass die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist. Gott hatte das Gericht angekündigt, bevor der Mensch in Sünde fiel. Seit dem Sündenfall gibt es auf dieser Erde Tod und Verwesung. Das Gesetz konnte daran nichts ändern. Es ließ die Sünde allerdings umso deutlicher hervortreten. Doch dann kam der Heiland Jesus Christus auf diese Erde. In Ihm war Leben. Er ging freiwillig in den Tod. Die Tatsache, dass der Tod der Lohn der Sünde ist, galt nicht für Ihn. Er starb nicht als Folge eigener Sünde. Er tat es für uns. Dadurch hat Er den Tod besiegt. Der Tod herrscht nicht mehr über uns. Er ist unser „Diener“, nicht mehr unser „Herr“. Der Herr Jesus hat „durch den Tod den zunichtegemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel“ (Heb 2,14).
„Zunichtemachen“ bedeutet so viel wie außer Kraft und Wirksamkeit setzen. Das Wort wird ebenfalls in Hebräer 2,14 benutzt. Der Tod ist noch nicht abgeschafft. Es gibt ihn immer noch. Für uns ist er jedoch wirkungslos gemacht. Der Tod wird der „König der Schrecken“ genannt (Hiob 18,14). Für Gotteskinder hat er seinen Schrecken (seinen Stachel) verloren. Erst im ewigen Zustand wird es den Tod gar nicht mehr geben (Off 21,4). Gleiches gilt für die Verweslichkeit. Triumphierend schreibt Paulus an die Korinther: „Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: ‚Verschlungen ist der Tod in Sieg‘“ (1. Kor 15,54).
Ans Licht gebracht durch das Evangelium
Von alledem hätten wir nichts gewusst, wenn das Evangelium nicht zu uns gekommen wäre. Evangelium bedeutet „gute Botschaft“. Es ist die gute Botschaft Gottes an uns Menschen. „Ans Licht gebracht“ geht weiter, als nur einfach etwas zu sehen oder zu zeigen. Es meint, dass durch das Evangelium diese Dinge in ihrem wahren Charakter dargestellt und offenbart worden sind. Diese „gute Botschaft“ umfasst viel mehr als „nur“ Vergebung von Sünden – so unendlich groß und gewaltig sie als solche bereits ist. Im Alten Testament war das in dieser Form nicht bekannt. Israel wusste etwas von einem Erlöser. Die gläubigen Juden warteten darauf, dass Er kommen und sie von ihren Feinden retten würde. Das allerdings, was jetzt im Evangelium offenbar gemacht ist, geht weit darüber hinaus.
Ein besonderer Auftrag
Vers 11: ... zu dem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen.
Paulus spricht jetzt von seinem besonderen Auftrag. Ihm war das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes anvertraut (1. Tim 1,11). Hier spricht er davon, dass er dazu bestellt, d. h. bestimmt oder gesetzt worden war. Paulus hatte sich nicht selbst dazu gemacht. Er war nicht von anderen dazu „ordiniert“ worden. Der Gedanke einer Ordination durch Menschen liegt dem Wort Gottes völlig fern. Nein, Paulus war von Gott dazu bestimmt worden. Er sollte dieses Evangelium verkünden und verbreiten – und er hat es getan. Er tat es als Herold, als Apostel und als Lehrer der Nationen.
Ein Herold ist ein Prediger oder Verkündiger einer Botschaft (vgl. 1. Tim 2,7; 2. Pet 2,5). Ein kaiserlicher Herold im Römischen Reich war ein Ausrufer öffentlicher Botschaften. Die Vollmacht des Herolds liegt nicht so sehr in seiner Person, sondern in der Botschaft, die er bringt. Ein guter Herold würde die Botschaft seines Herrn nie verändert haben. So verkündigte Paulus die Botschaft genau so, wie sie ihm von seinem Auftraggeber gegeben worden war. Er tat nichts hinzu. Er nahm nichts weg. Er veränderte nichts.
Als Apostel (Gesandter) Christi Jesu durch Gottes Willen brachte er die Botschaft mit göttlicher Autorität. Sie war ihm offenbart worden und er gab sie mit allem Nachdruck weiter.
Als Lehrer der Nationen verkündigte Paulus das Evangelium nicht nur mit Autorität, sondern er erklärte es. Seine Botschaft galt nicht nur den Menschen aus dem Volk Israel, sondern sie richtete sich an alle Menschen. Paulus war der Apostel und Lehrer der Nationen (vgl. Röm 11,13; Gal 2,8). Bei seiner Berufung war ihm das klar gesagt worden (vgl. Apg 9,15). Diesen Auftrag hat er bis zum Ende seines Lebens nicht vergessen.
Die Glaubenszuversicht des Paulus
Vers 12: Aus diesem Grund leide ich dies auch; aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren.
Paulus nimmt an dieser Stelle den Faden wieder auf, den er in den Versen 9–11 kurz verlassen hatte. Er stellt sich jetzt selbst als Beispiel vor seinen jüngeren Freund und Bruder. Paulus war ein Gefangener in Rom. Dennoch litt er nicht als ein Krimineller. Er litt nicht wegen eigenen Fehlverhaltens. Er litt vielmehr wegen der Verkündigung des Evangeliums. So war es schon bei seiner ersten Haft in Rom gewesen. Davon schreibt er mehrfach. In Epheser 3,1 bringt er seine Haft in Verbindung mit der Verkündigung des Geheimnisses von Christus und seiner Versammlung. In Epheser 6,19.20 schreibt er, dass er wegen des Geheimnisses des Evangeliums ein Gesandter in Fesseln war. Von Anfang an war ihm klar gesagt worden, dass er für den Namen des Herrn leiden würde (Apg 9,16). Diese Leiden waren schon während seines hingebungsvollen Dienstes sein Teil, aber jetzt war er im Gefängnis und hatte den Tod vor Augen. Hinzu kam, dass ihn alle in Asien verlassen hatten. Darunter litt Paulus ebenfalls sehr. Es gab zudem Widerstand gegen die Wahrheit (Kap. 2,25) und Verfolgung durch böse Menschen (Kap. 3,11–13; 4,14). Dennoch wurde Paulus nicht mutlos. Er schämte sich nicht. Er verfiel nicht in zweifelnde Überlegungen und stumpfes Grübeln. Andererseits lehnte er sich nicht gegen sein Schicksal auf. Wir finden bei ihm weder Resignation noch Depression oder gar Opposition.
Wir fragen uns: Wie kann es sein, dass Paulus, obwohl er so unendlich litt, dennoch voll Zuversicht war? Die Antwort gibt er selbst: „Ich weiß, wem ich geglaubt habe.“ Es geht an dieser Stelle nicht so sehr darum, was Paulus glaubte, sondern wem er glaubte. Beides ist natürlich wichtig. In Kapitel 3,14 wird Timotheus aufgefordert: „Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist.“ Hier hingegen geht es nicht zuerst um die Lehre und die Glaubenswahrheit, sondern um die Person, die das Zentrum dieser Wahrheit ist. Es geht um den Herrn Jesus selbst. Was Paulus hier ausdrückt, ist tiefes Vertrauen. Sein Herr hatte ihn nie verlassen und Er würde es ganz sicher in der Zukunft nicht tun. Paulus stützte sich nicht auf seinen Auftrag und auf seinen Dienst. Sonst hätte er vielleicht doch einen Grund gefunden, mutlos zu werden und sich zu schämen. Nein, Paulus setzte sein ganzes Vertrauen allein auf den Herrn.
Paulus „wusste“, wem er geglaubt hatte. „Wissen“ und „Kennen“ sind nahe beieinander, aber doch nicht identisch. Das Wort „Kennen“ bedeutet, dass man etwas durch Erfahrung gelernt hat. „Wissen“ hingegen drückt mehr eine innere Überzeugung aus. Paulus war bei seiner Bekehrung vor Damaskus zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Das Wort „glauben“ steht hier in einer Zeitform, die auf einen in der Vergangenheit zustande gekommenen Glauben hinweist, der immer noch andauerte. Paulus sagt mit anderen Worten: Ich habe geglaubt, mit dem Ergebnis, dass mein Glaube bis heute ganz fest ist.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.