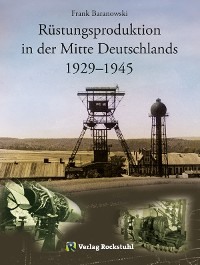Kitabı oku: «Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929 – 1945», sayfa 2
Einführung
Zu einem Zeitpunkt, als im gesamten Deutschen Reich Kriegsführung und -rüstung erste Zerfallserscheinungen zeigten, der bevorstehende Zusammenbruch der Fronten sich abzeichnete und gezielte Luftangriffe der Alliierten die Schaltstellen der Rüstungsindustrie massiv lähmten, gab es in quasi letzter Minute Bestrebungen, wichtige Rüstungsbetriebe namentlich der Flugzeugindustrie in den Südharz zu verlegen. Dies, obwohl die Region um Nordhausen bis dahin in der Rüstungspolitik keine wesentliche Rolle gespielt hatte. Mit Ausnahme der unterirdischen Munitionsanstalten, die das Heer ab 1934 in stillgelegten Kaliwerken von Bernterode bis Sondershausen eingerichtet hatte, war im Gegensatz zum angrenzenden Gau Südhannover-Braunschweig ein nennenswerter rüstungskonjunktureller Aufschwung bis Mitte 1943 ausgeblieben; allenfalls Zulieferaufträge gingen in geringem Umfang an Betriebe südöstlich des Harzes. Auch hatten sich bis zu dem Zeitpunkt nur wenige Firmen zum Zwecke der Kriegsproduktion in Nordthüringen neu angesiedelt, so etwa die Gerätebau GmbH oder der Röhrenhersteller Lorenz in Mühlhausen. In den westlichen Harzkreisen Goslar und Osterode bot sich hingegen ein anderes Bild. Dort ließ sich in den Jahren 1934 bis 1938 eine Vielzahl neu gegründeter Betriebe nieder; eine Vorrangstellung nahmen dabei die chemische und die metallverarbeitende Industrie ein. In Göttingen verzeichneten Unternehmen der Feinoptik starke Zuwächse, ein weiteres wichtiges Standbein stellten Luftwaffenaufträge dar.1 Noch weitaus prononcierter war die Entwicklung in und um Braunschweig. Die Grundlagen dafür hatte die Reichswehr bereits Anfang der 1930er Jahre mit ihrem Bestreben gelegt, sich trotz der auferlegten Beschränkungen des Versailler Vertrages ein engmaschiges Netz an Zulieferern für den „Bedarfsfall“ zu schaffen. Eine Vielzahl gerade alteingesessener Unternehmen profitierte davon. Bereits frühzeitig warben sie Rüstungsaufträge ein, die ihnen das Überleben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sicherten, bevor sie später ganz von Rüstungsaufträgen abhängig wurden. So entstand – zudem durch die Ansiedlung der Reichswerke Hermann Göring und einiger anderer mit Staatsmitteln alimentierter Firmen – eine Industriedichte, die im Reichsgebiet beispiellos blieb und zur Gründung ganzer Städte (Salzgitter, Wolfsburg) führte.2
Diese Ausweitung der Kriegsproduktion im Gau Südhannover-Braunschweig hatte zur Folge, dass in zunehmendem Maße Fremd- und Zwangsarbeiter herangezogen, später auch mehr und mehr KZ-Sklaven eingesetzt wurden. Da in der nordthüringischen Industrie ein solcher rüstungskonjunktureller Aufschwung nicht stattfand, blieb die Nachfrage nach ausländischem Personal zunächst gering. Erst mit der verstärkten Einberufung zur Wehrmacht im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Sowjetunion begann ein stetiger Anstieg der Zahl der Fremd- und Zwangsarbeiter; bis Ende 1943 war das allerdings nur in den wenigsten Fällen auf eine wesentliche Aufstockung der Rüstungskapazitäten zurückzuführen. Allein Rheinmetall-Borsig behauptete mit seinem Betrieb in Sömmerda eine Sonderstellung. Der Konzern hatte in Thüringen unter Missachtung der Bestimmungen des Versailler Vertrages bereits im April 1921 die Zünderfertigung wieder aufgenommen und im Folgejahr die Entwicklung einer neuen Maschinenpistole vorangetrieben. Im Oktober 1922 beauftragte die Reichswehr das Unternehmen, die gesamte von den Alliierten für Deutschland zugelassene Menge an Zündern herzustellen.3
Unmittelbar nach der Machtübernahme begann Rheinmetall-Borsig mit einer stetigen Ausweitung seiner Kriegsproduktion in Sömmerda, die von nun an nicht mehr verdeckt betrieben werden musste. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich das Werk zum bedeutendsten Rüstungsunternehmen Nordthüringens, stand damit jedoch allein und völlig losgelöst von der sonstigen Entwicklung in der Region. 1944 beschäftigte Rheinmetall Sömmerda zeitweise 13.000 Arbeitskräfte; damit mehr als die im Juni 1944 jeweils 12.000 Beschäftigten bei Hanomag oder Conti, den beiden größten Unternehmen des Rüstungskommandos Hannover.4 Die wirtschaftliche Situation in Nordthüringen änderte sich in dem Moment, als die Raketenmontage in die von der Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft (Wifo) geschaffene und von Häftlingen des eigens gegründeten Buchenwalder Außenkommandos Dora unter unmenschlichen Bedingungen ausgebaute Stollenanlage bei Niedersachswerfen verlagert wurde. In ihrer Verblendung plante die NS-Führungselite seit dem Frühjahr 1944, nach dem Beispiel „Dora“ weitere Produktionsstätten in Nordthüringen unter Tage zu dislozieren, vorrangig solche der Flugzeugindustrie, wie es das Heer seit 1934 vorexerziert hatte. Dadurch bedingt wurden fast explosionsartig weitere KZ-Außenlager gegründet, um deren Insassen als Arbeitssklaven auf den zahlreichen Baustellen der Sonderstäbe auszubeuten, bis ihre Lebenskräfte sie verließen. Keine dieser projektierten und unter hohen Menschenopfern in Angriff genommenen „Großanlagen“ ging in Betrieb.
Gleichzeitig fand ab Mitte 1943 in immer stärkerem Umfang eine oberirdische Verlagerung von wichtigen Rüstungsbetrieben in diesen „Mittelraum“ statt. Die Betriebsverlegungen nahmen derartige Ausmaße an, dass spätestens im zweiten Quartal 1944 kaum mehr freier Produktionsraum zur Verfügung stand und das Rüstungskommando dazu überging, im ganzen Gebiet Wirtschaftszweige insbesondere der Textilindustrie, zugunsten rüstungsindustrieller Verlagerungsbetriebe stillzulegen. Deren Nutznießer war erneut vor allem die Flugzeugindustrie, die damit zu einer führenden Stellung in Nordthüringen gelangte. Federführend war dabei der Junkers-Konzern, der zahlreiche seiner dezentralisierten Betriebe im Harz und Harzvorland unterbrachte. Mit dieser Verlagerungsbewegung erhöhte sich allein die Zahl der in Nordhausen tätigen Ausländer, bezieht man die in der Boelcke-Kaserne untergebrachten Zivilarbeiter der „Nordwerke“ ein, auf über 10.000.5 Auf diese Weise kam es im Stadtgebiet zu einem Ausländeranteil von fast 25 %, weit mehr als z. B. in der Industriestadt Essen, die die meisten ausländischen Arbeitskräfte im Arbeitsamtsbezirk Rheinland zählte.6

Im Rohbau erstellte Werksanlage der Firma Bruns Apparatebau, ab Oktober 1944 von den Heinkel-Werken genutzt (Sammlung Baranowski)
Intention der vorliegenden Arbeit ist es, diese Strukturveränderungen und ihre Gründe zu analysieren. Es soll der Weg vom „Notstandsgebiet“ Nordthüringen zu einem wenn auch unvollendet gebliebenen Rüstungszentrum dokumentiert und nachgezeichnet werden; eine Zusammenballung von Waffenschmieden, die als Torso nur durch Ausbeutung von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen entstand und Zahllosen das Leben kostete. Als Kontrast wird im ersten Kapitel ein Blick auf den schon ab 1933 zur Blüte gelangten industriellen Ballungsraum Salzgitter-Braunschweig-Hildesheim – eines der Rüstungszentren des Reiches von Anfang an – und die weitaus geringer, aber dennoch intensiv vom Rüstungsaufschwung betroffenen südniedersächsischen Landkreise Göttingen, Goslar, Osterode und Northeim geworfen. Bei nahezu gleichen Ausgangsbedingungen nahm die Entwicklung dort einen ganz anderen Verlauf. Der rüstungsbedingte Aufschwung hielt in diesen Kreisen bis Kriegsbeginn an, erhielt nach 1939 durch den Krieg aber keine neuen Impulse. In der Endphase des NS-Regimes blieben hier nennenswerte Verlagerungstendenzen aus, wie sie in Nordthüringen zu umwälzenden Veränderungen führten. Von gewisser Relevanz waren lediglich die Untertage-Bauvorhaben im Hils bei Holzen (Projekt „Hecht“), in denen Zwangsarbeiter in großer Zahl zum Einsatz kamen; eine rüstungswirtschaftliche Nutzung der Untertagebauten war dennoch nicht erkennbar.7 Nennenswert ist noch der Flugzeugbauer Heinkel, der im Herbst 1944 eine seiner Fabriken aus dem polnischen Mielec nach Bad Gandersheim in Gebäude der Firma Bruns Apparatebau, die gerade bezugsfertig geworden waren, auslagerte. Er ließ dort von mehr als 500 Häftlingen des werkseigenen KZs Flugzeugrümpfe montieren.8
Es lässt sich nachweisen, dass der zeitversetzte Rüstungsaufschwung nicht nur infrastrukturelle Gründe hatte. Vielmehr war er im heutigen Niedersachsen bereits in der Weimarer Republik angelegt und hatte seine Grundlagen in den frühen, unter Verletzung der Abrüstungsbestimmungen des Versailler Vertrages betriebenen Aufrüstungsbestrebungen der Militärs. Die ‚Flucht aufs Land und in die Provinz‘, insbesondere in das bis 1943 nur untergeordnet mit Rüstungsaufträgen bedachte Nordthüringen, war hingegen einzig aus der Not des alliierten Bombenkriegs und dem Streben nach Dezentralisierung der Kriegsmaschinerie erwachsen, ohne nachhaltige Auswirkungen auf die Zeit nach dem Krieg. Zur Verdeutlichung dieser in Schüben vollzogenen Entwicklung sind die Steuerungsmechanismen aufzudecken und die an dem Prozess beteiligten administrativen Entscheidungsinstanzen auf politischer und militärischer Ebene zu benennen. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach Verantwortung, Schuld und ‚Täterschaft‘, insbesondere von Industrie und Wirtschaft.
Nachdem die ‚Quelle‘ ausländischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener nahezu versiegt war, griffen die Unternehmen verstärkt auf das letzte noch verbliebene Arbeitskräftereservoir zurück und integrierten in zunehmendem Maße KZ-Häftlinge, zum Teil in Baracken unmittelbar neben der Fabrik untergebracht, in ihren Produktionsablauf. In diesem Zusammenhang sind die unterschiedlichen Lebens- und Existenzbedingungen in der Fabrik und in der Vielzahl an Untertagebaustellen der SS zu untersuchen und bestehende Unterschiede aufzuzeigen. Abschließend ist zu erörtern, ob es ein gezieltes Programm der „Vernichtung durch Arbeit“ gab, also der Einsatz von Häftlingen Mittel zum Zweck ihrer Vernichtung war, oder ob die Vernichtung eine einkalkulierte, nicht aber vorsätzlich und willentlich herbeigeführte Folge des Zwangsarbeitereinsatzes war.
Forschungsstand
Nach der Kapitulation Deutschlands Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Offizierkorps erleben müssen, wie Heer und Marine auf einen Bruchteil ihrer Vorkriegsstärke reduziert wurden und wie die ehemals privilegierte Stellung des Standes in Staat und Gesellschaft ins Wanken geriet. Gleichermaßen betroffen waren die großen deutschen Rüstungsunternehmen, die nicht nur ihre lukrativen und gewinnträchtigen Aufträge verloren hatten, sondern darüber hinaus unter Kontrolle der Alliierten entmilitarisiert wurden und einen Großteil ihres Maschinenbestandes abzugeben hatten. Der Versailler Vertrag legte der Industrie enge Beschränkungen auf und reglementierte die Herstellung von Rüstungsgütern, die bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr zugelassen waren, auch nicht für den ausländischen Markt. Wirtschaftsunternehmen und Militär standen dem neuen Staat daher gleichermaßen ablehnend gegenüber. Die Reichswehr war nicht gewillt, den eingetretenen Zustand auf Dauer hinzunehmen und strebte schon zu Beginn der 1920er Jahre die Restauration ihrer bisherigen Macht an, nötigenfalls durch einen Angriffskrieg. Im Rahmen ihrer „wirtschaftlichen Mobilmachungsvorarbeiten“ unterhielt die Reichswehr ab 1923 hinter dem Rücken und ohne Kenntnis der Reichsregierung Beziehungen zur Industrie, die der umfassenden Vorbereitung der gesamten Wirtschaft auf ihren Einsatz im Kriegsfalle dienten.1 Spätestens ab 1926 lagen in den Schubladen der verantwortlichen Reichswehroffiziere konkrete Pläne für die Aufstellung eines 21-Divisionen-Heeres.2 Um den daraus resultierenden Bedarf zu decken, ging der Nachschubstab des Heereswaffenamtes frühzeitig daran, in Frage kommende Rüstungsfirmen systematisch zu erfassen und ihnen bedingt mit finanziellen Mitteln, teils aus „schwarzen Kassen“, unter die Arme zu greifen.3 Diese vorbereitenden Handlungen der Reichswehr bildeten die Grundlage der NS-Aufrüstungspolitik, und ohne sie wäre eine rasche ‚Mobilmachung‘ nach 1933 undenkbar gewesen. Die bisherige Literatur hat ihren Fokus auf die Aufrüstungsbestrebungen des neuen Regimes ab 1933 gerichtet und ist zumeist nur am Rande auf die Vorarbeiten der Reichswehr eingegangen.4 Bis heute gibt es nur eine sehr überschaubare Zahl an Studien, die das Thema der frühen Aufrüstungsbestrebungen der Reichswehr aufgegriffen oder gar zum Kernthema gemacht haben.
Schon in den 1950er Jahren hatte sich Hallgarten der Thematik angenommen und die Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee aufgezeigt.5 Außerdem ist die von General Georg Thomas im Oktober 1944 zum Abschluss gebrachte Arbeit über die „Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft“ zu nennen, die 1966 von Wolfgang Birkenfeld neu herausgegeben wurde.6 Von November 1928 an war Thomas nach seiner Ernennung zum Major im Heereswaffenamt des Reichswehrministeriums führender Kopf in Fragen der Bedarfsplanung für den Kriegsfall. Aus seiner Feder stammt die am 22. November 1928 Reichminister Groener vorgelegte Denkschrift über „Zweck, Notwendigkeit und Umfang der wirtschaftlichen Aufstellungsarbeiten“.7 Als Chef des Stabes des Heereswaffenamtes erlebte der zwischenzeitlich zum Oberstleutnant aufgestiegene Thomas die ‚Machtübernahme‘ Hitlers. Am 1. September 1934 wurde er zum Leiter der neu errichteten Dienststelle „Wehrwirtschafts- und Waffenwesen“ im Wehrmachtsamt des Reichswehrministeriums ernannt. In den ersten Jahren der Naziherrschaft war Thomas der Vertreter der Wehrmacht in allen Fragen der Wirtschaft und Rüstung. Sein Einfluss und seine Macht schwanden allerdings in dem Maße, wie die Verantwortung für die Rüstung auf das neu geschaffene Reichsministerium für Bewaffnung und Munition unter Fritz Todt überging. Nach dessen Tod bei einem Flugzeugabsturz am 8. Februar 1942 war unter dem Amtsnachfolger Albert Speer schon bald klar, dass Thomas den Kampf um die Steuerung der Kriegswirtschaft verloren hatte. Mitte November 1942 trat er als Chef des Rüstungsamtes zurück.8
Am 11. Oktober 1944 verhaftete die Gestapo ihn. Seine Beteiligung an der Opposition, insbesondere um die Jahreswende 1939/40, war im Laufe der Untersuchungen nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 aufgedeckt worden. Die Gestapo brachte Thomas zunächst in ihr Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Str., bevor er am 2. Februar 1945 ins Konzentrationslager Flossenbürg eingewiesen und am 9. April 1945 weiter in das KZ Dachau gebracht wurde. Danach geriet Thomas in amerikanische Gefangenschaft, in der er am 29. Dezember 1946 verstarb.9 Birkenfeld gelang es, die Ausarbeitung von Thomas in wesentlichen Teilen mit den teils verschollenen Anhängen zu rekonstruieren und so die frühen Kriegsvorbereitungen der Reichswehr zu dokumentieren. Thomas hält als Ergebnis seiner Arbeit fest, „dass bis 1928 auf dem wehrwirtschaftlichen Gebiet in der Hauptsache nur theoretische Vorarbeiten geleistet werden konnten, die darauf hinausgingen, die deutsche Wirtschaft neu zu erfassen und sich ein Bild von ihrer Leistungsfähigkeit zu verschaffen“.10
Anja Bagel-Bohlan legt in ihrer 1975 publizierten Arbeit „Hitlers industrielle Kriegsvorbereitung 1936 bis 1939“ dar, dass die sich aus der Bewaffnung und Ausrüstung der Reichswehr ergebenden Industrieaufträge einen sehr geringen Stellenwert gehabt hätten und die „schwarz“ betriebenen Maßnahmen die Situation nicht wesentlich hätten ändern können. So habe die Reichswehr Entwicklungsarbeiten und Prototyp-Erprobungen auf dem Luftwaffen- und Marinegebiet gefördert und die Forschung auf dem Gebiet von ‚unerlaubten‘ Waffen, Geschützen und U-Booten vorangetrieben. Diese geheim betriebenen Arbeiten hätten nur zu „Schubladenergebnissen“ geführt, seien aber im Übrigen ohne nennenswerte fabrikatorische Auswirkung geblieben.11
Ernst Willi Hansen weist nach Auswertung von Unterlagen des Heereswaffenamtes in seiner 1978 veröffentlichten Studie zu „Reichswehr und Industrie“ erstmals nach, dass die Reichswehr bereits seit 1924 eine Anzahl privater, nicht für die Rüstungsfabrikation zugelassener Fabriken aus geheimen Mitteln mit Spezialmaschinen zur Herstellung von Kriegsmaterial ausstattete und finanzielle Mittel bereitstellte, von denen vor allem die wenigen von den Alliierten zugelassenen Monopolfirmen profitierten.12 Im gleichen Jahr erschien in einem von Müller/Opitz organisierten Sammelband eine thematisch gezielte Abhandlung Hansens zum „Militärisch-Industriellen-Komplex“ in der Weimarer Republik, in der er seine Ergebnisse nochmals in komprimierter Form darstellte.13 Im selben Werk erschien ein Beitrag von Michael Geyer zu der Thematik, im dem er darlegte, dass drei Elemente die vom Militär betriebene Restauration bestimmt hätten. So sei diese Entwicklung unter anderem geprägt gewesen durch die innenmilitärische Systematisierung und Zentralisierung, sowie die langfristige Planung der Rüstungspolitik mit dem Ziel des Aufbaus einer ‚Zukunftsarmee‘.14 Auf seinen bisherigen Erkenntnissen aufbauend publizierte Geyer 1980 eine Gesamtstudie über „die Reichswehr in der Krise der Machtpolitik in den Jahren 1924 bis 1934“, ließ dabei aber die Problematik der Zusammenarbeit zwischen Militär und Industrie nahezu unberücksichtigt.15
Über die bisherigen Ansätze und Publikationen hinausgehend legte Manfred Zeidler 1993 in einer systematischen Darstellung die Beziehungen zwischen Reichswehr und Roter Armee von 1920 – 1933 offen. Er stellt den Aufbau des Junkers-Werkes im russischen Fili, den Beginn der Zusammenarbeit beider Luftwaffen seit 1924/25, den Aufbau des Waffenerprobungszentrums in Lipeck, der Panzerschule in Kazan und des Testgeländes für chemische Kampfstoffe in Vol’sk ausführlich und detailreich dar.16 Barbara Hopmann hat sich in ihrer 1996 erschienenen Dokumentation über die Geschichte der Industrieverwaltungsgesellschaft (IVG) intensiv mit der Entwicklung und der Ausgestaltung der ‚fabrikatorischen Vorbereitung‘ von Rüstungsbetrieben in staatlicher Hand befasst, so etwa der sprengstoffverarbeitenden Industrie, durch die „Montan“.17 Für die Flugzeugindustrie und die Luftrüstung hat die 1998 von Lutz Budraß verfasste Studie Vorreitercharakter. In einem separaten Kapitel arbeitete er die gemeinsamen Rüstungsbestrebungen der Reichswehr und der Flugzeugindustrie in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre akribisch auf und belegt seine Erkenntnisse erstmals in der Literatur an Hand ausgewählter Unternehmen wie Rohrbach, Heinkel und Junkers.18 Insbesondere die Arbeiten von Hansen, Zeidler und Budraß zeigen, dass die im Geheimen betriebenen Aufrüstungsmaßnahmen viel umfangreicher waren als weithin angenommen und über rein theoretische Planspiele hinausgingen. Welchen Stellenwert sie tatsächlich hatten, ist bis heute empirisch nicht aufgearbeitet. Eine systematische Dokumentation über die Verflechtungen der Reichswehr und Industrie, den tatsächlichen qualitativen/quantitativen Umfang sowie das Ausmaß der geheimen Aufrüstung steht, mit Ausnahme des Bereiches der Luftwaffe, bis heute aus.
Bedeutend besser erschlossen ist das Phänomen des Ausländer- und Zwangsarbeitereinsatzes in der deutschen Rüstungsindustrie. Das Thema rückte in Absetzung vom politischen Mainstream und der bis dahin vorherrschenden Rechtfertigungsmentalität erstmals Mitte der 1980er Jahre in das Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit, angestoßen durch regionale Geschichtswerkstätten und Schülerarbeiten, die anfangs zumeist auf Interviews von Zeitzeugen – Oral History – fußten. Während auf dem Gebiet der DDR schon seit den 1950er und verstärkt seit den 1960er Jahren zum Thema Zwangsarbeit geforscht wurde,19blieb die Fremdarbeiterproblematik bis in die 1980er Jahre in der westdeutschen Geschichtsschreibung weithin unbeachtet. Positive Ausnahme waren die Arbeiten von Martin Broszat,20 Hans Pfahlmann21 und Eberhard Jäckel.22
Ulrich Herbert setzte mit seiner 1985 in erster Auflage veröffentlichten Publikation „Fremdarbeiter. Politik und Praxis des ‚Ausländer-Einsatzes‘ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches“ einen Meilenstein und schuf die Grundlagen für eine neue Qualität der Geschichtsschreibung im Sinne einer zeitkritischen und quellenorientierten Auseinandersetzung. Mit seinen in den Jahren von 1991 bis 2001 herausgegebenen Studien, die nahtlos an das Erstlingswerk anknüpften, beleuchtet Herbert weitere Facetten des „Reichseinsatzes“.23 2001 präsentierte Marc Spoerer eine Gesamtdarstellung zum „Zwangsarbeitereinsatz unter dem Hakenkreuz“, die einen Überblick über das Thema in seiner ganzen Breite gibt. Zudem bietet sein Buch eine umfangreiche Literaturliste und ein ausführliches Kapitel über die Entschädigung von Zwangsarbeitern. Der Komplexität des Themas entsprechend erschienen ab Mitte der 1980er Jahre vornehmlich Einzelstudien, die sich auf bestimmte Firmen24 – oft im Zusammenhang mit der Darstellung ihrer Rüstungsbetriebe – Regionen oder bestimmte Nationalitäten,25 oder aber einzelne Gesichtspunkte des Ausländereinsatzes konzentrierten.26 Mittlerweile ist ein nahezu flächendeckendes Netz an Regional- und Detailstudien entstanden, auch für die von der vorliegenden Arbeit erfassten Region. Den Anfang machte Gerd Wysocki mit seiner 1982 veröffentlichten Dokumentation über den Zwangsarbeitereinsatz bei den Reichswerken Hermann Göring in Salzgitter.27
Unter dem Titel „Geschichte und Gegenwart einer deutschen Stadt 1942 – 1992“ erschien genau zehn Jahre später ein von Wolfgang Benz herausgegebener Sammelband zur Entwicklung der Stadt Salzgitter. Darin liefert Beatrix Herlemann einen Beitrag, der sich mit den Lebensbedingungen ausländischer Zwangsarbeiter in den Reichswerken befasst.28 Daran schloss 1995 eine Studie von Gudrun Pischke über das nationalsozialistische Lagersystem in Salzgitter nahtlos an.29 Für die Stadt und das Land Braunschweig leistete Paul Liedtke seit 1983 Pionierarbeit.30 Als Mitautor war er auch an dem 2003 von Gudrun Fiedler und Hans-Ulrich Ludewig herausgegebenen Gemeinschaftswerk über „Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig 1939 – 1945“ beteiligt, einer ersten Vor-Ort-Studie, die sich zusammenfassend mit der Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte durch Kriegswirtschaft, Verwaltung und Landwirtschaft innerhalb einer ‚geschlossenen‘ Region befasste.
Die Thematik des Zwangsarbeitereinsatzes in Hildesheim wurde von Max Lichte,31 Gerhard Notzon-Hillmann32 und Markus Roloff33 aufgearbeitet. Das 1937 mit Staatsmitteln im Hildesheimer Stadtwald errichtete Bosch-Werk beherrschte die örtliche Szene. Die Unterlagen des Betriebsarchivs überstanden den Krieg nahezu unversehrt. Sie hatten Manfred Overesch uneingeschränkt zur Verfügung gestanden, als er 2008 die Ergebnisse seiner fünfjährigen Recherchen präsentierte. Umfassend handelt er die einzelnen Entwicklungsphasen des Hildesheimer Bosch-Werkes ab, von der Ansiedlung über die Aufnahme der Produktion bis zum Kriegsende und in die Anfänge des Wiederaufbaus nach 1945 hinein. Ein eigenständiges Kapitel befasst sich mit den mehreren hundert ausländischen Arbeitskräften, die der Rüstungszulieferer an seinen Werkbänken beschäftigte.34 Für Göttingen sind die Arbeiten von Cordula Tollmien maßgeblich, vor allem ihre Dissertation aus dem Jahr 1999.35 Im Auftrag der Stadtverwaltung forschte sie über Zwangsarbeiter in Ämtern, Dienststellen und Betrieben der Stadt,36 ebenso wie in der Göttinger Rüstungsindustrie.37 Zudem ist sie Initiatorin der Homepage www.zwangsarbeit-in-goettingen.de. Weiterführend zeigte Eckart Schöle 2007 am Beispiel von Sartorius und Feinprüf (Mahr) den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte in Göttinger Industriebetrieben auf.38
Die Arbeit von Günter Siedbürger gibt einen Gesamtüberblick über den Zwangsarbeitereinsatz im gesamten Landkreis Göttingen, von Hann.-Münden bis Duderstadt und dem Eichsfeld.39 In einem gesonderten Teil befasst sich seine Synopse mit der Geschichte des Rhumspringer Schickert-Werkes und des Duderstädter Polte-Werkes. Mit diesen beiden Kapiteln knüpft Siedbürger an die vorangegangenen Arbeiten von Hans-Heinrich Hillegeist40 und des Autors aus den 1990er Jahren an.41 In vier Sammelbänden sorgfältiger Detailforschung dokumentiert Detlef Creydt Zwangsarbeit und Rüstungsindustrie im Weserbergland.42
Im Oberharz hoben erstmals Michael Braedt und die von ihm mitbegründete Initiative gegen Rüstungsaltlasten das Thema Mitte der 1980er Jahre am Beispiel der Sprengstofffabrik „Tanne“ in Clausthal-Zellerfeld ins öffentliche Bewusstsein. Ende November 1989 stellte die Initiative auf dem Bundeskongress „Altlasten der Rüstungsindustrie“ in Göttingen ihre Ergebnisse vor. Dieser Beitrag und die Resultate ähnlicher Projekte in anderen Regionen erschienen noch im gleichen Jahr in einem Kongressbericht,43 der weitere Forschungen anregte. 1993 erschien in einem von der Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatfreunde e. V. veröffentlichten Sammelband eine erste Übersichtsdarstellung von Michael Braedt, Hansjörg Hörseljau, Frank Jakobs und Friedhart Knolle über die Sprengstofffabrik „Tanne“, die den Ausländereinsatz in dem Werk nicht aussparte. 1998 legte das Autorenteam eine erweiterte Fassung des Textes als Monographie vor.44 Neben einem Beitrag zur Rüstungsindustrie in Clausthal-Zellerfeld hatte Hans-Heinrich Hillegeist in dem 1993 editierten Sammelband der Südniedersächsischen Heimatfreunde e. V. Einzelbeiträge über die Rüstungsbetriebe OIGEE und HEMAF in Osterode, die Schickert-Werke in Bad Lauterberg und Rhumspringe sowie das Untertageprojekt „Dachs IV“ publiziert; der Einsatz von Zwangsarbeitern stand dabei nicht im Vordergrund.45
Für Walter Struve steht – minutiös erhoben – der Ausländereinsatz in wichtigen Industriebetrieben der Stadt Osterode im Mittelpunkt seiner Arbeit aus dem Jahr 1992.46 Struve stützt sich dabei auf eine sorgfältige Auswertung von Archivquellen, aber auch auf eine Vielzahl Interviews, die er mit Zeitzeugen geführt hat; sie geben einen Einblick in die Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber den ausländischen Arbeitskräften. Friedhart Knolle befasste sich mit der Geschichte der Metallwerke Silberhütte, Schmiedag und Odertal.47 2007 veröffentlichte er gemeinsam mit Michael Braedt und Peter Schyga einen Artikel über „NS-Zwangsarbeit und Kriegsgefangeneneinsatz im Westharz unter besonderer Berücksichtigung medizinischer Aspekte“. Schyga war es auch, der 1999 zur NS-Geschichte Goslars forschte.48 Helmut Lüder arbeitet seit Jahren über Bad Lauterberg und hat mehrere Arbeiten über Zwangsarbeiter, die in der Harzstadt ihr Leben ließen, vorgelegt.49 Einen Gesamtüberblick über den Ausländereinsatz im Landkreis Osterode bietet die Veröffentlichung von Claus Heinrich Gattermann, in der er die Quellen- und Forschungslage durch eigene Recherchen anreichert.50 In den Unterlagen der Krankenkassen fand er umfassendes statistisches Material, mit dem sich die Bedeutung des Zwangsarbeitereinsatzes quantitativ ermessen ließ. 2006 legten Günther Hein und Claudia Küpper-Eichas ihre Untersuchung zur Arbeits- und Wirtschaftsgeschichte im Oberharz in der Zeit des Nationalsozialismus vor, die insbesondere aus Unternehmersicht die Notwendigkeit beleuchtet, Zwangsarbeiter einzusetzen.51
In Nordthüringen – den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Mühlhausen und Sömmerda – sind Zwangsarbeit und Rüstungsindustrie bislang nur in Ansätzen erforscht. Zwar hat der Autor dazu veröffentlicht,52 doch darüber hinaus liegen nur wenige Monographien oder Regionalstudien vor.53 Mit dem rüstungswirtschaftlichen Strukturwandel im gesamten Land Thüringen befassen sich zwei Arbeiten von Jürgen John und die jüngst von Markus Fleischhauer veröffentlichte Struktur- und Funktionsgeschichte des NS-Gaus Thüringen.54 Ein Beitrag von Wolfgang Bricks und Paul Gans über die staatlich gesteuerte Industrieansiedlung ergänzt diese Erkenntnisse.55 Annegret Schüles Arbeit über die Geschichte des Rheinmetall-Werkes in Sömmerda spannt einen Bogen von der Gründung des Unternehmens über die geheime Wiederaufrüstung während der Weimarer Republik bis hin zur nationalsozialistischen Firmen- und Personalpolitik. Auch die Nachkriegszeit spart sie nicht aus.56 Weitere Informationen lassen sich dem achten Band des Heimatgeschichtlichen Wegweisers zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 – 1945 in Thüringen entnehmen.57
Die 2002 von Norbert Moczarski, Bernhard Post und Katrin Weiß herausgegebene, klar gegliederte Quellenedition zur Zwangsarbeit in Thüringen 1940 – 1945 bietet Material für weiter reichende Erkenntnisse zu Kriegsproduktion, Arbeitskräftemangel sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen ausländischer Arbeitskräfte.58 Aussagekräftig und bewegend zugleich sind die in Buchform veröffentlichten Erinnerungen von Krystyna Ewa Vetulani-Belfoure über ihr Leben als polnische Zwangsarbeiterin in Nordhausen in den Jahren 1942 – 1945.59 Das KZ-Lagersystem in Nordthüringen und in Niedersachsen ist dagegen durch die Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre gut dokumentiert.
Die westdeutsche Geschichtsforschung hatte die Konzentrationslager bis Ende der 1950er Jahre nahezu komplett ausgeblendet. 1962 eröffnete Eberhard Kolbs Monographie über Bergen-Belsen die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem KZ-Einzellager.60 Drei Jahre später veröffentlichte Martin Broszat seine grundlegende Gesamtdarstellung über die nationalsozialistischen Konzentrationslager, die aus einem Gutachten für den Frankfurter Auschwitz-Prozess hervorging.61 Mit seinen „Studien zur Geschichte der Konzentrationslager“ legte Broszat Einzeluntersuchungen zu sechs Konzentrationslagern vor, darunter auch Mittelbau-Dora.62 Damit endete im Westen bereits diese erste Phase der Auseinandersetzung mit der Geschichte nationalsozialistischer Konzentrationslager. Bis auf Falk Pingels Arbeit über „Häftlinge unter SS-Herrschaft“63 fand über Jahre hinweg eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema nicht statt. Die wichtigen Studien westdeutscher Historiker ließen sich bis Ende der 1970er Jahre problemlos auf einem Regalmeter unterbringen. Mit vornehmlich regionalgeschichtlichen Ausarbeitungen erwachte die KZ-Forschung erst Mitte der 1980er Jahre zu neuem Leben. Dem zweibändigen, von einem Autorenteam unter Leitung von Rainer Fröbe erarbeiteten Sammelband über Konzentrationslager in Hannover64 folgten bald zahlreiche zum Teil ins Detail gehende Untersuchungen über verschiedene KZ-Außenlager.65