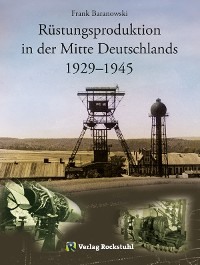Kitabı oku: «Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929 – 1945», sayfa 6
Die mit Staatsmitteln ausgelöste Ansiedlung von Rüstungsbetrieben als Element der
„fabrikatorischen Vorbereitung“
Das 2. Rüstungsprogramm der Reichswehr forderte einen schnellen Aufbau von Produktionsmöglichkeiten für das in den 1920er Jahren im ‚Untergrund‘ erforschte und entwickelte Kriegsgerät. Neben der zuvor praktizierten finanziellen Unterstützung einzelner Firmen favorisierte das Heereswaffenamt die Gründung von Staatsbetrieben. Diese Anlagen sollten für den ‚Mobilmachungsfall‘ in Bereitschaft stehen und technisch so ausgelegt sein, dass sie bei Bedarf bereits in Friedenszeiten Teilbereiche der Produktion aufnehmen konnten.1 Die heereseigenen Fabriken sollten an die Stelle der früheren Heereswerkstätten treten, im Gegensatz zu ihnen aber nicht in staatlicher, sondern in privatwirtschaftlicher Form betrieben werden. Dahinter stand die Bestrebung, das militärische Primat der Wehrmacht in der Kriegswirtschaft zu sichern und übermäßigen Rüstungsgewinnen entgegenzuwirken.2 Ein erstes Werk nach diesem Konzept gründete das Heereswaffenamt in Donauwörth. Die dortige Werkzeug- und Maschinenfabrik hatte bis 1929 im Auftrag der Reichswehr Artilleriemunition hergestellt. Wegen angeblicher Qualitätsprobleme wurde der Firmeninhaber Loeffellad abgesetzt und der enteignete Betrieb 1934 reaktiviert. Zur Verschleierung bediente sich das Heereswaffenamt der Verwertungsgesellschaft für Montanindustrie GmbH (Montan), einer Tochtergesellschaft der zum Flick-Konzern gehörenden Maxhütte.3
Drahtzieher im Hintergrund war Eugen Böhringer, der Generaldirektor der Maxhütte. Er verfügte über einen Vertrauten im Beschaffungswesen des Heereswaffenamtes, den Referenten für kaufmännische und Vertragsangelegenheiten, Johann ‚Max‘ Zeidelhack.4 Bis 1933 noch Rechnungsprüfer bei der Maxhütte, war Zeidelhack Anfang 1934 zum Militär gewechselt. Unmittelbar nach seiner Einstellung unterbreitete er General Liese den Vorschlag, Donauwörth auszubauen, und im Frühjahr trat die Maxhütte die „Montan“ unentgeltlich an die Heeresverwaltung ab. Die „Montan-Anteile“ wurden zunächst auf Zeidelhack persönlich übertragen; erst 1938 erfolgte die formale Übernahme durch das Reich.5 Die „Montan“ wurde fortan zur Holding des Heereswaffenamtes für dessen Rüstungsbetriebe ausgebaut; sie finanzierte zahlreiche Neubauten auf Rechnung des Reiches.6 Die Geschäftsführung oblag bis 1943 Zeidelhack.
Die Standortwahl der heereseigenen Betriebe erfolgte nicht nach Gesichtspunkten ökonomischer Optimalität, sondern aus militärischen Gründen in möglichst abgelegenen Gegenden, fernab der großen Industriezentren und Verkehrsknotenpunkte. Ende November 1935 befanden sich eine Vielzahl heereseigener Betriebe in Planung; einige waren sogar schon im Bau. Die Fertigstellung dieser ‚fabrikatorischen Anlagen‘ war bis auf wenige Vorhaben spätestens Ende 1936 vorgesehen. Der Termin wurde in den meisten Fällen aber überschritten. Eine Aufstellung des Reichskriegsministers vom November 1935, die er am 8. Januar 1936 dem Reichs-Rechnungshof übermittelte, listet unter Decknamen 40 derartige Bauvorhaben auf. Für diese wehrmachtseigenen Produktionsstätten, soweit sie bis März 1936 geplant waren, standen Finanzmittel von über 226 Millionen RM zur Verfügung.7 Bis zum 15. November 1936 war der Betrag in den Militärhaushalten von Heer, Marine und Luftwaffe auf 333,65 Millionen RM heraufgesetzt worden; etwa die Hälfte der Kosten entfiel auf das Heer.8 Im Frühjahr 1937 wurde die „Montan-Hauptverwaltung“ von München nach Berlin verlegt und wenige Monate später der Jurist Dr. Karl Birkmeyer zum weiteren Direktor und stellvertretenden Geschäftsführer, ohne Änderung der Alleinvertretungsbefugnis Zeidelhacks, ernannt.9 Nachdem der Sitz der „Montan“ bei Luftangriffen im Herbst 1943 fast völlig zerstört worden war, wurde sie im November 1943 zum Schutz vor Bombardements in die Kleinstadt Lippoldsberg an der Oberweser verlegt. Nach Inbetriebnahme der ersten Fabrik in Donauwörth stieg die Zahl der von der „Montan“ verwalteten Betriebe rasch an.
Ende März 1943 verfügte sie über 126 Werke, die sie an 58 private Gesellschaften verpachtet hatte.10 Dabei errichteten auf einem von der „Montan“ für das Deutsche Reich erworbenen Gelände Unternehmen der Privatindustrie Fabrikanlagen, deren Einrichtungskosten das Oberkommando des Heeres trug. Die Regularien waren in einem Mantelvertrag geregelt, in dem sich die privaten Muttergesellschaften verpflichteten, für den Aufbau der Fabriken, ihre Betriebsfähigkeit und die Instandhaltung zu sorgen. Nach Abschluss des Auftrages und Abnahme durch das OKH gingen die Betriebe in das Eigentum der „Montan“ über, die sie an eine zu 100 % von der Muttergesellschaft gegründete Tochterfirma verpachtete. Diese zu Produktionszwecken eingerichteten Tochtergesellschaften waren in technischer und finanzieller Hinsicht von der Konzernmutter auszustatten. Die Muttergesellschaft hatte ihr Personal und ihr gesamtes Know-how einzubringen, ein Technologietransfer mit kaum einschätzbaren Risiken für die Rüstungsproduzenten.11 Der Nachteil lag aus Sicht der Privatindustrie insbesondere in der ständigen Kontrolle durch staatliche Dienststellen.12
Hinzu kam, dass sich das OKH in den Verträgen das Recht vorbehielt, einen Pächter, der nicht mehr genehm oder den gestellten Anforderungen nicht gewachsen war, durch ein anderes Unternehmen abzulösen oder die Anlage selbst zu betreiben.13 Im Pachtvertrag zwischen der „Montan“ und den Tochtergesellschaften – in der Regel mit einer Laufzeit von 15 Jahren – verpflichtete sich die Betreiberfirma zur sorgfältigen Verwaltung der gepachteten Anlagen.14 Bei zu geringer Auslastung konnte das OKH die Betriebe stilllegen. So geschah es im Juli 1940 mit der Gerätebau GmbH, Pachtwerk der Gebrüder Thiel-Seebach GmbH (Ruhla) in Kassel; mit der Kündigung des Pachtverhältnisses wurde Platz für einen Junkers-Verlagerungsbetrieb geschaffen.15 Etwa zeitgleich gab es Planungen, die Mühlhäuser Dependance desselben Zünderproduzenten zu schließen, doch konnte sich die Gerätebau GmbH in diesem Fall behaupten und einer Räumung entgegenwirken.16
Die Verträge mit der „Montan“ wurden zumeist auf freiwilliger Basis geschlossen und nur in den wenigsten Fällen staatlicher Druck ausgeübt. Um das Risiko zu begrenzen und auf diese Weise Erträge zu erzielen, die noch über den ohnehin schon hohen Profitraten der Rüstungsindustrie lagen, ließen sich zahlreiche Unternehmen bereitwillig auf den Deal ein.17 Als Nutzungsentgelt hatten die Muttergesellschaften bis 1943 eine variable Pacht von 33 % bis 50 % des von der Firma für das Geschäftsjahr bilanzierten Brutto-Betriebsüberschusses zu zahlen. Aus dieser gewinnabhängigen Pacht ergab sich für das Reich nur eine geringe Verzinsung. Daher drängte Speer 1943 auf die Durchsetzung neuer Pachtverträge mit einer festen Verzinsung von jährlich sechs Prozent auf den halben Anschaffungswert der verpachteten Grundstücke und Anlagen. Dies stieß auf den Protest der betroffenen Rüstungsunternehmen, die nicht gewillt waren, eine solche Änderung hinzunehmen und damit ihr Betriebsrisiko zu erhöhen. Bis Herbst 1944 gelang es der „Montan“, nur acht der bestehenden Pachtverträge umzustellen; in 12 weiteren Fällen waren Vertragsverhandlungen im Gange.18 Die von außen undurchschaubare Konstruktion des ‚Rüstungsvierecks‘, in der Auftraggeber und Betreiber unter mehreren Firmennamen auftraten, damals eine Verschleierungstaktik, hat rechtliche Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Die meisten Betreibergesellschaften wurden nach dem Krieg liquidiert, so dass es keine Rechtsnachfolger gibt, die für umweltschädliche Altlasten in Haftung genommen werden könnten.19
Als Muttergesellschaften traten u. a. so renommierte Firmen wie Polte (Magdeburg), Gebrüder Thiel (Ruhla), Stock & Co., Dynamit AG, Deutsche Sprengchemie, Wolff & Co., I.G. Farben und die Hugo Schneider AG auf. Die Verwertchemie betrieb 27 „Montan-Werke“ mit einem Anschaffungswert von ca. 1,8 Milliarden RM, darunter zwei Werke im Harz.20 Neben der Dynamit AG hatte auch die WASAG über ihre Tochtergesellschaft, die Deutsche Sprengchemie GmbH, zahlreiche Sprengstofffabriken von der „Montan“ gepachtet. Ebenso betrieb die Wolff & Co. KG aus Walsrode bei Hannover unter dem Decknamen Eibia GmbH Liebenau, Bomlitz und Dörverden fünf Fabriken zur Herstellung von Sprengstoff. Die Deutsche Gold und Silberscheideanstalt mit Hauptsitz in Frankfurt unterhielt unter dem Tarnnamen „Paraxol GmbH“ ebenfalls mehrere Produktionsstätten, eine davon in Lippoldsberg bei Göttingen.21 Ebenso profitierte der von den Alliierten im Juli 1921 für die Herstellung von Kriegsmaterial zugelassene Magdeburger Polte-Konzern von einer frühzeitigen staatlichen Unterstützung seines Hauptwerkes, das die Reichswehr aus „schwarzen Kassen“ mit neuen Maschinen und Einrichtungen ausstattete. Zusätzlich ließ sich Polte mit Staatsmitteln in Genthin (Werk Liesewald), Magdeburg und Grüneberg weitere Werke bauen.
Die „Montan“ hatte sie an eine 100%ige Tochterfirma des Magdeburger Rüstungsproduzenten, die Silva Metallwerke GmbH, verpachtet.22 Zudem betrieb Polte in Duderstadt ein Zweigwerk zur Herstellung von 2-cm-Munition, das ebenfalls aus Mitteln der Luftwaffe errichtet worden war.23 Schon 1934 hatte die Reichswehr den Aufbau eines Polte-Zweigwerkes in Bad Lauterberg, der Metallwerk Odertal GmbH, in Form eines unwiederbringlichen Zuschusses mitfinanziert.24 Auch die Gebrüder Thiel-Seebach GmbH, die von den Alliierten zur Produktion von Zündern zugelassen worden war, nutzte staatliche Drittmittel, um eine weitere Niederlassung in Mühlhausen (Thüringen) zu errichten. Die veranschlagte Bausumme belief sich auf 11,8 Millionen RM; knapp die Hälfte dieses Betrages hatte das Reich bis Ende 1935 investiert. Die Produktion sollte im April 1936 aufgenommen werden,25 doch die beiden Produktionshallen und das zugehörige Verwaltungsgebäude standen erst Ende 1937 für die Herstellung von Zeitzündern bereit.26 Andere reichseigene Werke betrieb die „Montan“ in eigener Regie, wie die Feinmechanische Werke GmbH Erfurt und die Hanseatische Kettenwerk GmbH Hamburg.27
Etwa 10 % der vom Reich verausgabten „Montan-Mittel“ flossen in den heutigen südniedersächsischen Raum. Seit 1934 befanden sich heereseigene Betriebe in Bad Lauterberg [Metallwerk Odertal GmbH, bewirtschaftet durch Polte Magdeburg], in Göttingen [Feinmess- und Prüfgeräte GmbH, durch Carl Mahr, Esslingen], in Langelsheim [Chemische Werke Harz-Weser GmbH, durch Deutsche Aktiv-Kohle GmbH] sowie in Herzberg und in Clausthal-Zellerfeld [Dynamit AG] im Aufbau. Allein die Investitionen für den Bau des letztgenannten Sprengstoffwerkes „Tanne“ beliefen sich bis März 1936 auf über 12,4 Millionen RM und rangierten damit an Position vier aller 40 aus öffentlichen Mitteln finanzierten Vorhaben.28 Die Konzentration dieser Staatsbetriebe hatte nachhaltige Auswirkungen auf die bis dahin eher von kleineren und mittelständischen Unternehmen geprägte Wirtschaftsstruktur. Besonders die wenig erschlossenen Harzgemeinden zogen aus dieser Entwicklung Nutzen, einerseits durch Aufträge an die heimische Bauindustrie, andererseits durch die Heranziehung einheimischer Arbeitskräfte für den Produktionsbetrieb. Die wirtschaftliche Bedeutung der heereseigenen Betriebe für die Region zeigt sich namentlich daran, dass das Metallwerk Odertal sowie die beiden DAG-Werke in Clausthal-Zellerfeld und Herzberg 1943 mit zusammen über 8.000 Arbeitskräften zu den 20 größten Betrieben des Rüstungskommandos Hannover gehörten.29
Der rüstungskonjunkturelle Aufschwung im Gau Südhannover-Braunschweig
Die Einbeziehung südniedersächsischer Firmen in die Rüstungsproduktion – ein Kurzüberblick
Die staatlich begünstigte Ansiedlung von Chemiebetrieben und Sprengstoffwerken
Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen die Vielschichtigkeit der flächendeckenden Einbeziehung von Betrieben verschiedenster Wirtschaftszweige in die Kriegsmaschinerie außerhalb der Ballungszentren Braunschweig-Hannover-Hildesheim-Salzgitter, des Universitätsstandortes Göttingen sowie der Städte Hildesheim und Osterode.1 Von den teils frühen Aufrüstungsbestrebungen profitierten insbesondere Standorte im Harz, aber auch solche am nördlichen und südlichen Rand des Gebirges. Die größte mit Staatsmitteln subventionierte Ansiedlung im Bereich des Rüstungskommandos Hannover nahm das NS-Regime in Clausthal-Zellerfeld vor.2 Die Anfänge des Harzer Sprengstoffwerkes gehen auf das Jahr 1934 zurück, als Vertreter der Dynamit AG (DAG), ehemals Alfred Nobel & Co. aus Troisdorf, im Oberharz Ausschau nach einem geeigneten Gelände für eine „Trinitritoluol-Fabrik“ hielten. Die Entscheidung fiel auf eine etwa 120 ha große Waldfläche am Ortsausgang von Clausthal-Zellerfeld, die die „Montan“ 1935 und 1936 von der Preußischen Staatsforstverwaltung für das Deutsche Reich erwarb, aus Tarnungsgründen aber unter dem Deckmantel einer privatrechtlichen Gesellschaft figurieren ließ.3 Ende 1936 war diese Fabrik „Tanne“ in ihrem Grundbestand errichtet. Die Anlage war eines von mehreren ‚Schlafwerken‘ im Deutschen Reich, die nach Bauabschluss zunächst nicht in Betrieb gingen, sondern ausschließlich für den Bedarfsfall errichtet wurden.4

Gebäudereste auf dem Gelände des Werkes „Tanne“ in Clausthal-Zellerfeld, 1992
(Sammlung Jürgen Müller)

Zerstörtes Tri-Gebäude auf dem Gelände des Werkes „Tanne“ in Clausthal-Zellerfeld, 1992 (Sammlung Jürgen Müller)

Ehemaliges Säuregebäude des Werkes „Tanne“, 1992 (Sammlung Jürgen Müller)
Anfang 1938 kam es zur Reaktivierung des ‚Schläfers‘ und einer Fortführung der Bauarbeiten im Harz. Um Produktionsausfällen entgegenzuwirken, war fast jede Werksabteilung doppelt vorhanden. Zur Fabrik gehörten 214 Einzelgebäude, die zumeist in Skelettbauweise errichtet worden waren, um im Falle von Explosionen die Verluste so gering wie möglich zu halten.5 Pächterin und Betreiberin des Clausthal-Zellerfelder Sprengstoffwerkes und der angeschlossenen Füllstation war die Verwertchemie, eine 100 %ige Tochterfirma der DAG, die die Gebäude zu Beginn des Jahres 1939 formell übernahm. Die TNT-Produktion kam im April 1939 in Gang, drei Monate später als ursprünglich vorgesehen.6 Am 6. Juni 1940 forderte eine schwere Explosion in der Tri-Nitrierung 61 Tote, 38 Schwer- und 126 Leichtverletzte.7 Ab Februar 1942 beschäftigte die DAG in ihrem Werk „Tanne“ im Mittel etwa 2.500 Personen,8 darunter eine Vielzahl von Zwangsarbeitern. Im Vergleich zu den Großbetrieben um Braunschweig war diese Belegschaftsstärke noch relativ gering, trotzdem gehörte die DAG-Niederlassung zu einem der führenden Betriebe des Rüstungskommandos Hannover. Im zweiten Quartal 1944 nahm das Unternehmen nach seiner Beschäftigtenzahl den zehnten Rang im Rüstungskommando ein.9 Am 7. Oktober 1944 war der Betrieb Ziel eines alliierten Luftangriffs; 70 der 214 Gebäude wurden dabei teils schwer bis mittelschwer beschädigt, fünf von ihnen sogar völlig zerstört. 61 Arbeitskräfte des Werkes ließen dabei ihr leben, unter ihnen 47 russische und ein belgischer Zwangsarbeiter. Weitere fünf verstarben im Krankenhaus.10

Gebäude der Borvisk-Kunstseiden AG, 1936 (StadtA Herzberg)

Das durch Explosion zerstörte DAG-Werksgelände am Pfingstanger, April 1945 (Sammlung Matwijow)
Die Bleikupferhütte in Oker und die Zinkhütte in Harlingerode belieferten das Clausthaler DAG-Werk mit Oleum (rauchende Schwefelsäure).11 Ein weiterer Zulieferer war die Wifo. Sie hatte 1937 die Langelsheimer Chlorkaliumfabrik übernommen und in den folgenden Monaten zu einer Salpetersäureanlage umgebaut, die 1939 ihre Fabrikation aufnahm. Monatlich stellte das Werk etwa 4.800 t an 98%iger Salpetersäure (HOKO) her, die im Werk „Tanne“ zu Sprengstoff weiter verarbeitet wurde. Die Langelsheimer Wifo-HOKO-Anlage deckte acht Prozent des Gesamtbedarfes des Deutschen Reiches.12 Zusätzlich hatte die Wifo nur wenige Meter von ihrer Schwefel- und Salpetersäurefabrik entfernt 12 Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 600 m3 für Toluol aufgestellt, die im August 1938 in Nutzung gingen. Über diese Anlage konnten in 15 Stunden zwei Kesselwagen gefüllt und für den Abtransport nach Clausthal-Zellerfeld bereitgestellt werden. In unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich weitere sechs Tanks zur Aufnahme von Ammoniak.13
Etwa ein Jahr nach Inbetriebnahme des Werkes „Tanne“ entschieden sich die NS-Planer, eine weitere Füllstelle im Harz zu schaffen. Im Juni 1940 erwarb die „Montan“ aus der Konkursmasse der Borvisk-Kunstseiden AG das am Herzberger Pfingstanger gelegene Werksgelände. Der Umbau der Fabrik war schon im Sommer 1941 abgeschlossen.14 Die hinter der Verwertchemie stehende DAG trat wie in Clausthal-Zellerfeld als Betreiberin des Rüstungsbetriebs auf, der auf die Füllung von 50-kg- und 250-kg-Bomben spezialisiert war. Ende 1943 fuhr der Konzern die Befüllung von Bomben drastisch zurück, um so Kapazitäten für die Herstellung von Tellerminen zu schaffen, von denen von nun an bis zu 6.000 Stück pro Tag gefüllt werden konnten. Am 4. April 1945 kam es in der Fabrik zu einem Brand, der sich schnell ausbreitete und eine Explosion von 8.000 mit Sprengstoff gefüllten Minen auslöste. Die Füllstelle wurde nahezu vollständig zerstört. Bei dem Unglück kamen 29 Personen ums Leben; weitere 58 wurden schwer verletzt.15
Zusätzlich zu den bereits genannten Rüstungsstandorten hatte die Wifo in Langelsheim für 5,7 Millionen RM eine weitere Fabrikanlage auf Staatskosten erbaut. Die Chemischen Werke Harz-Weser stellten in den Gebäuden ab 1940 Aktivkohle für Gasmaskenfilter her. Die Kapazität lag bei monatlich etwa 150 t. Im April 1945 beschäftigte das Unternehmen 153 Personen.16 Die Pulver- und pyrotechnische Fabriken GmbH J. F. Eisfeld in Liebenburg nördlich von Goslar arbeitete seit 1936 ebenfalls für die Wehrmacht. Ihr Werk „Kunigunde“ produzierte unterschiedliche Schwarzpulversorten und stellte Nebelhandgranaten, Leuchtmunition, Landungsfackeln sowie Nebelbomben her.17

Die Langelsheimer Wifo-HOKO-Anlage in den 1940er Jahren
(Sammlung Frank Jacobs)
Von weitaus größerer wirtschaftlicher Bedeutung war die Neuansiedlung des Schickert-Werkes zur Herstellung von Wasserstoffperoxyd in Bad Lauterberg. Bereits während des Ersten Weltkrieges bestand Interesse an der militärischen Nutzung der chemischen Substanz, doch es fehlten noch die Mittel einer großtechnischen Herstellung. Sie wurden durch die Elektrochemischen Werke München (EWM) erst in den folgenden Jahren geschaffen. Der Kieler Chemiker und Ingenieur Dr. Helmut Walter hatte für das Oberkommando der Marine im Zusammenhang mit modernen Triebwerken neue Treibstoffe erforscht und erprobt. Seine Ergebnisse lösten einen wahren Entwicklungsschub aus. Er nutzte den bei der katalytischen Zersetzung von Wasserstoffperoxyd freiwerdenden Sauerstoff zur Verbrennung von Treibstoff und ermöglichte damit der Firma EWM die militärische Nutzung in großem Stil, auf die sie lange Zeit gewartet hatte.18 Es zeichnete sich bereits frühzeitig ab, dass das Unternehmen die geforderten Mengen an Wasserstoffperoxyd nicht an einem Standort herstellen konnte, zumal neben der Marine auch andere militärische Stellen Interesse bekundeten.
Die Schaffung einer weiteren Fabrikationsstätte war unausweichlich. Im Sommer 1938 fiel die Entscheidung für die Gründung einer Niederlassung im Odertal in Bad Lauterberg. Ausschlaggebend für die Ansiedlung in der Harzstadt war die Nähe zu der 1933 gebauten Odertalsperre, die hinreichend Wasser zur Kühlung der Elektrolyse und der Erzeugung von Wasserdampf bereithielt. Im August 1938 beauftragte die EWM den Architekten Proebst aus Ingolstadt mit der Bauplanung dieser „Anlage Z“ in Bad Lauterberg, die aus fünf identischen, voneinander aber völlig unabhängig arbeitenden Produktionseinheiten bestehen sollte.19 Am 8. Dezember 1938 wies der Reichsminister der Luftfahrt die Elektrochemischen Werke an, der Ausbau der Fabrik in Lauterberg habe sofort in vollem Umfang zu erfolgen, und ebenfalls sei mit der Projektierung eines zweiten Werkes in Rhumspringe mit fünf Einheiten umgehend zu beginnen. Die rechtlichen Grundlagen wurden dagegen erst knapp ein Jahr später mit der Unterzeichnung eines „Aufbauvertrages“ am 26. Oktober 1939 geschaffen, in dem sich das Reich verpflichtete, im Odertal bei Bad Lauterberg auf eigene Kosten ein Werk „zur Erzeugung von chemischen Stoffen für den Wehrmachtsbedarf“ zu errichten.20

Bei der Herstellung von Nebelbomben im Werk „Kunigunde“ in Dörnten bei Goslar (Sammlung Frank Jacobs)
Zum Zwecke der Geheimhaltung hatte sich EWM im September 1938 zur Gründung der Otto Schickert & Co. KG entschieden, die nach außen hin als Betreibergesellschaft des Bad Lauterberger Werkes hin auftrat. Ende Januar 1941 ging die erste Halle zur Erzeugung von 35%igem Wasserstoffperoxyd samt der zentralen Anlage zur Hochkonzentration der Chemikalie auf 80 – 85 % in Betrieb. Die zweite Halle zur Produktion von 35%igem Wasserstoffperoxyd lief im Sommer 1941 an. Der Bau von Halle 3 war im Frühjahr 1942 und von Halle 4 im November 1942 abgeschlossen.
Der Aufbau des Chemiewerkes war mit der Inbetriebnahme von Halle 5 im Juni 1944 vollendet. Die vom Reich zu übernehmenden Kosten für den Bau der Fabrik in Bad Lauterberg beliefen sich auf 70 Millionen RM.21 Bei der Planung des Rhumspringer Werkes kam es hingegen zu Verzögerungen infolge einer vorübergehend geringeren Nachfrage nach Wasserstoffperoxyd. Anfang Mai 1940 plädierte daher die Rüstungsinspektion Hannover beim RLM für eine Rückstellung des geplanten Zweigwerkes.22 Mitte Juni 1942 kam das Oberkommando der Marine auf die Vorplanungen aus dem Jahr 1938 zurück. In dem Bericht des Rüstungskommandos vom 18. Juni 1942 heißt es: „Die Bauarbeiten für das Werk Rhumspringe wurden auf Anordnung des OKM wieder aufgenommen und sollen mit großem Nachdruck vorangetrieben werden“.23 In Rhumspringe sollten wie in Bad Lauterberg fünf Produktionshallen errichtet werden, allerdings wurden die Pläne auf drei Hallen und die entsprechenden Hilfsgebäude zusammengestrichen. Die Produktion in Halle 1 sollte am 1. Mai 1945, in Halle 2 am 1. September 1945 und in Halle 3 am 1. März 1946 aufgenommen werden.24 Obwohl Ende Dezember 1944 über 1.300 Arbeitskräfte auf der Baustelle in Rhumspringe tätig waren,25 ließen sich diese Zeitvorgaben bei Weitem nicht einhalten. Bei Kriegsende waren von Halle 1 gerade mal die Fundamente gegossen. Die Arbeiten am zweiten Produktionsgebäude waren am weitesten fortgeschritten, so dass Schickert im Frühjahr 1945 mit dem Einbau des Maschinenparks begann. Die Produktionsaufnahme stand im März 1945 unmittelbar bevor.26

Das im Aufbau begriffene Schickert-Werk Bad Lauterberg, 1939 (Foto Lindenberg)

Großbaustelle Schickert-Werke Bad Lauterberg, 1939 (Foto Lindenberg)

Gesamtansicht des Lauterberger Schickert-Werkes, 1942 (Foto Lindenberg)

Modell des Schickert-Werkes Rhumspringe, 1942 (Sammlung Baranowski)
Ebenso nahm die seit 1885 in Hann.-Münden bestehende Firma Händler & Natermann Anteil am Rüstungsgeschäft.27 Spätestens ab 1942 stellte sie spezielle Aluminiumfolien für die Marine und Walzblei für die Accumulatorenfabrik Hannover (Afa) her. Zudem arbeitete der Betrieb als Zulieferer für die Deutschen Edelstahlwerke in Hannover (Panzerwaffenteile) und die Torpedo-Werkstätten in Eckernförde. Auch Feststellvorrichtungen für Bordfenster verließen die Fabrik. Außerdem lieferte Händler & Natermann den Polte-Werken Geschossdraht sowie spezielle Bleidichtungen für das U-Boot-Programm. Anfang Januar 1942 beschäftigte der Mündener Rüstungszulieferer 152 Arbeitskräfte.28 Im ersten Quartal 1944 übernahm die Firma als Ausweichbetrieb für die Berliner Bamag-Meguin AG zusätzlich die Produktion von Ruderfeststell-Vorrichtungen für Flugzeuge. Der Betrieb deckte etwa 25 % des Gesamtbedarfs der deutschen Flugzeugindustrie.29 Bis September 1944 kletterte die Beschäftigtenzahl auf 274; darunter befanden sich 45 Ostarbeiter und 37 weitere, zumeist aus Westeuropa stammende Arbeitskräfte.30
Die 1924 aus dem Goslarer Stadtgebiet nach Oker verlegte Gebrüder Borchers AG war ebenfalls in die Rüstungsproduktion einbezogen, mit heute noch einschneidenden Folgen für Umwelt und Natur. Das Unternehmen war bei der Herstellung von Wolfram und Molybdän marktbeherrschend. 1935 erwarb die Firma H. C. Starck von der Hildesheimer Bank die Aktienmehrheit an der Gebrüder Borchers AG und bildete gemeinsam mit Krupp, der Gesellschaft für Metallurgie und der I.G. Farben ein Konsortium zur Gewinnung einheimischer Rohstoffe zur Stahlveredelung. Um die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern, hatte es sich dieses „Ofensauenkonsortium“ zur Aufgabe gemacht, aus den Schmelzrückständen des Mansfelder Kupferschiefers Molybdän zu gewinnen, technologisch ein energieintensiver und äußerst umweltschädlicher Prozess. Die Anlagen wurden ab 1935 in Oker gebaut. Ein weiteres Standbein war die Produktion von Arsen als Vorprodukt von „Schädlingsbekämpfungsmitteln“ und offenbar auch chemischen Kampfstoffen.31 Seit August 1938 war die Borchers AG offiziell Unterlieferant der Luftwaffe.32 Die konkrete Zahl der bei Borchers beschäftigten Personen ließ sich nicht ermitteln. Bekannt ist nur, dass die Chemiefabrik mehr als 500 ausländische Arbeitskräfte beschäftigte.

Im Bau befindliche Heizzentrale des Rhumspringer Schickert-Werkes, April 1945
(CIOS-Bericht)

Links: Blick in das Innere, Fraktionssäulen des Schickert-Werkes Lauterberg (Foto Lindenberg)
Rechts: Batteriezellen im Schickert-Werk Rhumspringe (CIOS-Bericht)

Halle 3 des Schickert-Werkes Rhumspringe; die Halle 4 im Vordergrund ist im Aufbau begriffen, April 1945 (CIOS-Bericht)
Unter ihnen 94 französische Kriegsgefangene, die unter unvorstellbaren Bedingungen im Werk arbeiteten. In einem zeitgenössischen Bericht heißt es über diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen: „Bei Ankunft des mineralhaltigen Gesteins laden fünf oder sechs Gefangene es ab. Eine harte, aber nicht gefährliche Arbeit. Dieses Erz kommt in die Halle, wo die Hochöfen stehen. Drei Kameraden, die in dieser Halle arbeiten, sind damit beschäftigt, die Hochöfen mit dem Erz und anderen nicht gesundheitsschädlichen chemischen Produkten zu beladen. Eine sehr anstrengende Arbeit bei großer Hitze. Zwei bis drei Meter lange Flammen kommen aus den Hochöfen, die auf 800 bis 900 Grad aufgeheizt werden. Das Produkt aus diesem Schmelzvorgang wird aus den Hochöfen gekippt und von unseren Kameraden mit dem Vorschlaghammer zerstückelt, wenn es erkaltet ist. Diese Stücke werden dann weiter zerkleinert und zu einem feinen Staub zermahlen. Bei jedem Abstich holen die Kameraden neun Schubladen voll dieses feinen Staubes auf Arsenbasis, der ätzend ist, die Schleimhäute verbrennt, die Augen tränen lässt und von dem man niest. Die Gefangenen arbeiten ohne Schutzmaske, erhalten weder Milch noch eine Zusatzration, während die Zivilarbeiter über all diese notwendigen Schutzmaßnahmen verfügen. Der aus dieser Bearbeitung entstandene Staub wird mit Säuren gemischt. Die Mischung kommt dann unter Hochdruck in Pressen. Die Gefangenen müssen die Pressen leeren, aus denen übel riechende Gase und ätzende Dämpfe hervortreten“.33 Eine Chronik, in der die heute noch bestehende und „verantwortlichen Handelns“ rühmende Firma sich ihrer Verantwortung stellt, steht nach wie vor aus.
Der aufrüstungsbedingte Wandel der metallverarbeitenden Industrie
Neben der chemischen war die metallverarbeitende Industrie im heutigen südniedersächsischen Raum stark vertreten. Eine Vorreiterrolle nahm dabei der Magdeburger Rüstungsproduzent Polte ein, der schon 1934 die Anfang der 1920er Jahre von der Stokelbusch Holzrohr AG in Bad Lauterberg im Odertal errichtete Fabrikanlage erworben hatte, um an dem Standort wiederum mit staatlichen Mitteln ein Zweigwerk zu eröffnen. Der Röhrenhersteller Stokelbusch war kurz nach der Fertigstellung der Gebäude in Zahlungsschwierigkeiten geraten und musste deshalb 1925 Konkurs anmelden.34 Das Werksgelände ging danach zu gleichen Teilen in das Eigentum der Reichsbankhauptstelle Hannover und der Magdeburger Firma Gerecke über. Bis zur Übernahme durch Polte hatten die neuen Eigentümer das Werk an die Deutsche Holzröhren AG (Deuhrag) verpachtet. Bereits 1934 begann der Magdeburger Rüstungslieferant mit dem Umbau des Fabrikgebäudes, um fortan 7,92-mm-Gewehrmunition zu produzieren. Der Betrieb, der unter dem Namen Metallwerk Odertal GmbH firmierte, nahm 1935 seine Lieferungen auf.35 Anfang Januar 1943 waren 935 Personen für den Rüstungsproduzenten tätig, und die Zahl schnellte im Laufe des Jahres drastisch in die Höhe. Ab Januar 1944 sind Belegschaftszahlen von mehr als 2.000 Personen nachgewiesen. Ende Dezember 1944 waren sogar 2.349 Arbeitskräfte mit der Herstellung von Gewehrmunition beschäftigt.36

Arbeiter der Stockelbusch Holzrohr AG auf dem Betriebsgelände
(Foto Lindenberg)

Die Holzröhrenfabrik Stockelbusch, später Metallwerk Odertal (Foto Lindenberg)