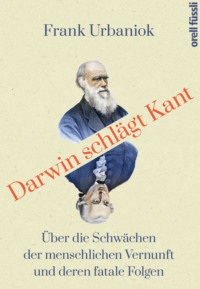Kitabı oku: «Darwin schlägt Kant», sayfa 9
5Das RSG-Modell
Wir haben verschiedene Mechanismen betrachtet, die dem Menschen im Wege stehen können, wenn es darum geht, die Wirklichkeit differenziert zu erfassen und darauf aufbauend vernünftig und human zu handeln. Basale erkenntnistheoretische Limitationen betreffen in gewisser Weise das Betriebssystem unserer Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit. Diese grundlegenden erkenntnistheoretischen Begrenzungen können in einer übergeordneten Perspektive als existenzielle metaphysische Aspekte eines im Universum existierenden Lebewesens aufgefasst werden. Auch auf dieser grundlegenden Ebene spielt bereits die Projektion von Strukturen und Mechanismen unseres Erkenntnisapparates in die Außenwelt eine Rolle. Damit ist die Gefahr verbunden, Ordnungsprinzipien, die wir in die für uns wahrnehmbaren Erscheinungen hineinprojizieren, als objektive Eigenschaften der Dinge zu interpretieren. Diese Dinge sind für uns aber nur durch ihre »Erscheinungen« wahrnehmbar, also durch die Art, in der sie uns »erscheinen«. Subjektiv determinierte Wahrnehmungs- und Erkenntnisstrukturen in die Außenwelt hineinzuprojizieren, ohne sie als fehleranfällige Projektion zu erkennen, ist auch auf den beiden nachfolgenden Ebenen ein zentrales Phänomen.
So findet sich auf der nächsten Ebene eine Vielzahl psychologischer Mechanismen, die als gravierende Schwachstellen unserer Erkenntnisfähigkeit anzusehen sind. Jedenfalls muss man es so sehen, wenn man das Ziel verfolgt, die Wirklichkeit differenziert zu erfassen und darauf aufbauend in humanistischer Tradition vernünftig zu handeln. Ist es nicht irritierend, dass unsere Vernunft so viele psychologische Konstruktionsmängel hat? Sind wir ein Montagsauto der Evolution, das man umtauschen sollte, wenn man es nur könnte? Nun haben wir aber bereits gesehen, dass es einen einfachen Grund für die scheinbaren Konstruktionsmängel gibt: Aus Sicht der Evolution geschah die Weiterentwicklung der Vernunft gar nicht mit dem Ziel, die Wirklichkeit differenziert abzubilden. Das Ziel der Evolution war beim Menschen wie auch bei allen anderen Organismen, Überlebens- und Reproduktionsvorteile für die gesamte Art zu schaffen. Vorangehend wurden viele Mechanismen im Detail dargestellt, die man unter dem Motto »Besser falsch, dafür schnell und/oder eindeutig« zusammenfassen kann. Dabei steht manchmal die Geschwindigkeit, manchmal die Eindeutigkeit und manchmal beides als Zielgröße im Vordergrund.
Auf der dritten Ebene ist schließlich auf Persönlichkeitsprofile zu verweisen, die über das übliche Maß hinaus in besonderer Weise zu problematischen Wahrnehmungs-, Erkenntnis-, aber auch Handlungsmustern disponieren. Denn Menschen sind nicht gleich, sondern unterscheiden sich in ihren Charaktermerkmalen. In einer erheblichen Spannbreite finden sich akzentuierte Persönlichkeiten, die in bestimmten Eigenschaften weit von der Mitte der menschlichen Population entfernt sind. Bei solchen Personen treten neben problematischen Verhaltensweisen meist auch die allgemeinen psychologischen Fehlerquellen in verschärfter Form auf.
Die hier angesprochenen Mechanismen bewegen sich zudem zwischen zwei Polen mit gegensätzlichem Charakter. Sie bestimmen die fundamentale Ausrichtung der menschlichen Natur. An dem einen Pol ist die egoistische Selbstbehauptung im Sinne des Willens zur Macht lokalisiert. An dem anderen Pol befinden sich die mit der Vernunft des Menschen neu geschaffenen und exorbitant gesteigerten Möglichkeiten zur Kooperation, die als das basale Kooperationspotenzial anzusprechen sind.
In Abhängigkeit von den erwähnten individuellen Persönlichkeitsprofilen finden sich bei einzelnen Menschen starke Betonungen des einen oder anderen Pols. Ansonsten schließen sich beide Prinzipien in der Praxis keineswegs aus. Im Gegenteil finden sich bei den meisten Menschen Meinungen und Handlungsweisen, die dem einen, und solche, die dem anderen Pol zuzuordnen sind, manchmal aber auch eine Mischung aus beiden Anteilen darstellen können. Welches der beiden basalen Potenziale jeweils im Vordergrund steht, ist stark von speziellen Eigenschaften einer Person, unterschiedlichen Situationen (zum Beispiel im Privaten oder im Beruf) oder als solchen wahrgenommenen Aufgaben und Problemen abhängig. Meist sind Betonungen des einen oder anderen Pols mit einer starken Emotionalität der jeweils nachdenkenden oder handelnden Person verbunden.
Die vielfältigen psychologischen Mechanismen lassen sich übergeordnet im nachfolgend beschriebenen RSG-Modell zusammenfassen. Es besteht aus drei Elementen:
1.Registrieren
2.Subjektivieren
3.Generalisieren
5.1Registrieren
Unser Wahrnehmungsapparat registriert permanent Informationen. Die meisten dieser Wahrnehmungen erfolgen unbewusst. Ich gehe hier von einem weit gefassten Wahrnehmungsbegriff aus. Er ist nicht auf die sinnliche Wahrnehmung beschränkt. Beim Wahrnehmungsbegriff in diesem Schema geht es weniger um die Quelle der Wahrnehmung, sondern um den Zeitpunkt, in dem eine Information bewusst als solche registriert wird, egal woher sie stammt. Das heißt, es geht um ein bewusstes Wahrnehmen als mögliche Vorstufe weiterer gedanklicher bzw. gedanklich-emotionaler Prozesse, die von dieser initialen Wahrnehmung ausgehen.
Wahrnehmungen betreffen in diesem Sinne Phänomene der Außenwelt, des eigenen Körpers oder der eigenen inneren gedanklichen und emotionalen Prozesse. Solche Wahrnehmungen können sich demnach auf konkrete Dinge (einen Hasen, ein Gewitter, einen Stuhl) oder aber abstrakte Phänomene (eine Erklärung, eine Frage, ein Problem) beziehen. Bei den konkreten Wahrnehmungen stehen zunächst meist die der Sinnesorgane (sehen, hören, riechen, schmecken, tasten) im Vordergrund. Sie werden aber rasch mit assoziativen Regionen des Gehirns abgeglichen. Die Wahrnehmung abstrakter Phänomene spielt sich in der Regel von Anfang an im »Innenbereich« ab, indem diese z. B. als Gedanke, als Ahnung, als Gefühl im Bewusstsein eine erste Gestalt annehmen.
Mit dem Begriff des »Registrierens« ist im RSG-Modell somit der hier beschriebene Vorgang einer initialen bewussten Wahrnehmung als möglicher Vorstufe weiterer psychischer Verarbeitungsprozesse gemeint.
5.2Subjektivieren
Subjektivieren bezeichnet den Vorgang, der nach der Registrierung einsetzen kann, um die registrierten Informationen zu verarbeiten. Die Grenze zwischen Registrieren und Subjektivieren ist in der Praxis selbstverständlich nicht so starr, wie sie im theoretischen RSG-Modell erscheint. Denn einerseits können während des Verarbeitungsprozesses permanent weiter Informationen aufgenommen oder verworfen werden. Wir haben auch gesehen, dass dies zum Teil unbewusst erfolgt und dann trotzdem einen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis des Verarbeitungsprozesses hat. Andererseits ist auch der Prozess der Registrierung, der einer sinnlichen (Außen-) Wahrnehmung oder einer innerlichen Wahrnehmung entspricht, aufs Engste durch Vorstrukturierungen geprägt. Diese Vorstrukturierungen reichen von kausalen Ordnungen über die sprachliche Grammatik oder erkenntnisleitende Interessen (vgl. Kap. 6.5) bis hin zu emotionalen Gestimmtheiten und selektiven Informationsfiltern, die zum Beispiel den Basalen Wahrnehmungsmustern (vgl. Kap. 3.3) entsprechen. Es gibt zudem Rückkopplungseffekte. Sie werden zum Beispiel durch das assoziative Gedächtnis vermittelt und prägen die Wahrnehmung schon im Moment des Registrierens sehr stark.
Gleichwohl ist es so, dass die Verarbeitungsmechanismen, die in der Phase der Subjektivierung ablaufen, viel ausgeprägter und vor allem in wesentlichen Teilen bewusstseinsnäher sind als in der Phase des Registrierens. Auch wenn es sich nur um eine Modellvorstellung handelt, macht es daher Sinn, das initiale Registrieren einer Information von der sich möglicherweise daran anschließenden Phase der Verarbeitung zu unterscheiden.
Der Begriff der Subjektivierung wurde deswegen gewählt, weil es sich immer um einen Prozess handelt, in dem Informationen geformt werden, um sie sich schließlich als kurzzeitigen oder nachhaltigen Bewusstseinsinhalt anzueignen. Die Aneignung geschieht durch einen Gedanken, ein Gefühl oder eine Erkenntnis im engeren Sinne. Dieser Bewusstseinsinhalt ist nicht selten eine Grundlage für eine darauf aufbauende und sie begründende Entscheidung – für oder gegen eine Handlung. Der Prozess der Formung und Aneignung kann auf all die einem Individuum zur Verfügung stehenden kognitiv-emotionalen und erkenntnisbildenden Mechanismen zurückgreifen. Sie sind zwangsläufig von den generellen und zusätzlich den individuell spezifischen Dispositionen durchsetzt. Daher wird der gesamte Formungs- und Aneignungsprozess stark an subjektiven Maßstäben und Gewohnheiten ausgerichtet. Wir sahen, dass es viele dieser subjektiv prägenden Mechanismen gibt, die zu verzerrten Bewertungen und in der Folge zu problematischen Handlungen führen können.
Es greift aber zu kurz, die Phase der Subjektivierung nur als etwas Problematisches zu verstehen. Es handelt sich ja um den individuellen Gebrauch der Vernunft mit all ihren Schwachstellen, aber auch all ihren großen Potenzialen. In der gesamten Menschheitsgeschichte und auch in der Gegenwart gab und gibt es viele Menschen, die durch das damit verbundene Potenzial bahnbrechende Erkenntnisse und großartige Leistungen hervorgebracht haben. Man kann hier an Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft und Politik denken, die geniale Kunstwerke geschaffen, große Erkenntnisse gewonnen oder den Lauf der Geschichte positiv geprägt haben. Großartige Dinge müssen aber nicht immer Dinge sein, von denen die Welt Kenntnis erhält. Großartige Dinge ereignen sich auch im Kleinen, in der Familie, der Kindererziehung, dem ehrenamtlichen Engagement, oder in alltäglichen Verhaltensweisen, die auf vernünftigen Erkenntnissen basieren und die Welt ein wenig besser machen. Dass es sich dabei stets auch um einen Vorgang der Subjektivierung von Informationen handelt, muss dem Ergebnis nicht von vornherein abträglich sein.
5.2.1Die große Backstube
Aber wir richten bei der Betrachtung in diesem Buch das Augenmerk primär auf die Risiken und Schwachstellen der entsprechenden Prozesse. Das geschieht mit dem aufklärerischen Ziel, damit die ein oder andere nützliche Erkenntnis vermitteln zu können. In diesem Sinne lässt sich die Subjektivierung wie folgt charakterisieren: Es handelt sich um einen Verarbeitungsprozess von Informationen, die auf der ersten Stufe registriert wurden. Sie werden dann zu einer Gestalt (z. B. Gedanke, Eindruck, Theorie, Erklärung, Lösung) geformt und somit subjektiv angeeignet.
Flüchtlingen, die in einem anderen Land integriert werden sollen, gelingt es im günstigen Fall, sich an der neuen Kultur auszurichten. Mit ähnlicher Zielsetzung durchlaufen auch die registrierten Informationen von Anfang an einen Prozess der Angleichung, der Ausrichtung an subjektiven Maßstäben und Gewohnheiten und der Umformung. Die Subjektivierung ist wie ein Backofen, in dem ständig kleine und große Kuchen, Kekse oder manchmal auch nur Krümel gebacken werden. Dafür wird so lange geschnitten, gemischt und gerührt, bis etwas herauskommt, das schmeckt oder zumindest vertraut ist.
So gilt zum Beispiel:
−In der Phase der Subjektivierung werden gerne kausale Zusammenhänge gesucht, gefunden und nicht selten erfunden.
−Das Produkt soll vertraut sein. Es wird bevorzugt, wenn es sich leicht und bequem in bereits vorhandene Vorstellungen und/oder Stimmungen integrieren lässt.
−Die Ergebnisse des Verarbeitungsprozesses werden mit der eigenen Emotionalität (fühlt sich gut, fühlt sich richtig, fühlt sich passend, fühlt sich vertraut an) und Basalen Wahrnehmungsmustern abgestimmt (wer die Welt prinzipiell als einen feindlichen Ort wahrnimmt, wird häufig feindliche Umstände oder Motive erkennen).
−Es besteht eine starke Tendenz, Komplexität zu reduzieren, indem viele Informationen nicht zur Kenntnis genommen, weggelassen oder selektiv ausgesucht werden.
−Subjektiv Widersprüchliches, Unbequemes, Erkenntnisse, die das eigene Leben auf den ersten Blick erschweren, die Glaubensvorstellungen, Überzeugungen oder gar die eigene Identität infrage stellen, finden nur schwer Eingang in die Verarbeitungsprozesse der Subjektivierung.
−Es besteht eine starke Tendenz zur Polarisierung, zum Beispiel: schwarz/ weiß, entweder/oder, Freund/Feind, alles oder nichts, immer oder nie, eine Erklärung für alles oder zumindest für vieles, Superlative (das Schönste, das Größte, das Spannendste, das Witzigste, mega-mega-mega-giga …)
−Es besteht eine Tendenz, sich auf das zu fokussieren, was man kennt, was man subjektiv glaubt, erklären zu können, aber nicht unbedingt auf das, was von der Sache her eigentlich wichtig wäre.
−Kleine und große Geschichten werden abgerundet und harmonisiert. Kanten und Unverträglichkeiten werden abgeschliffen. Denn wir lieben eindeutige Geschichten und Botschaften.
5.2.2Das Hirn kann alles erklären – auch ohne jedes Wissen
Dass wir die ausgeprägte Tendenz haben, Geschichten zu konstruieren, die sich an einer subjektiven Stimmigkeit und nicht an der Abbildung der äußeren Realität ausrichten, kommt beispielhaft in einem berühmten Experiment zum Ausdruck.
Ende der 60er-Jahre wurde bei Patienten mit einer bestimmten Form von Epilepsie durch operative Eingriffe die Verbindung zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns unterbrochen. Aufgrund dieser Operation war es bei den (ansonsten psychisch gesunden) Patienten möglich, die linke oder die rechte Hirnhälfte durch bestimmte Versuchsanordnungen gezielt anzusprechen, weil sie nicht mehr in einem ständigen Austausch miteinander standen.
In der Folge wurden verschiedene Untersuchungen an diesen sogenannten Split-Brain-Patienten durchgeführt. [15; 16; 17]
»Erstaunt nahm man zur Kenntnis, dass jede Hemisphäre über ein gewisses Eigenleben verfügte. Rechte und linke Hirnhälfte unterschieden sich in ihren Wahrnehmungen, Konzepten und Handlungsimpulsen […]. Beide Hemisphären haben unterschiedliche Stärken. So konnten beispielsweise Gegenstände, die in der rechten Gesichtsfeldhälfte gezeigt wurden, benannt werden und durch die rechte Hand aus einer Reihe anderer Gegenstände herausgefunden werden. Worte konnten gelesen oder notiert und mit der rechten Hand der zugehörige Gegenstand identifiziert werden. Rechte Hand und rechte Gesichtsfeldhälfte entsprechen dabei einer Verarbeitung in der linken Hirnhälfte, da die Verbindungswege auf ihrem Weg vom Gehirn zur Peripherie die Seite wechseln.
Gegenstände, die der rechten Hirnhälfte präsentiert wurden, konnten weder mündlich noch schriftlich wiedergegeben werden. Allerdings war es möglich, mit der Hand die entsprechenden Gegenstände herauszufinden, ohne daß sie sprachlich bezeichnet werden konnten. Worte konnten nicht gelesen werden.
Daraus ergaben sich folgende Schlußfolgerungen:
1.›Bezüglich Sprache und Bewußtsein ist die isolierte linke Hemisphäre weder aus der subjektiven Sicht des Patienten noch nach dem objektiv beobachtbaren Verhalten von den Leistungen des Gesamthirns zu unterscheiden. Die linke Hemisphäre kontrolliert beim Rechtshänder das Sprechen und das Schreiben.
2.Die isolierte rechte Hemisphäre kann sich weder schriftlich noch mündlich sprachlich äußern. Ihre integrativen sensomotorischen Prozesse werden dem Patienten nicht bewußt. Sie können nur vermittels der linken Hirnhälfte zum Bewußtsein gelangen. Sie erscheinen passiv der linken Hirnhälfte untergeordnet.
3.Weiterhin haben die Versuche gezeigt, daß nur die linke Hemisphäre rechnerische Operationen ausführen kann, die über das Addieren und Subtrahieren von einstelligen Zahlen hinausgehen. Sie ist zuständig für das Erfassen von Einzelheiten und für analytische Denkaufgaben, die offensichtlich an die sprachliche Kommunikation gebunden sind.‹ [18, S. 167–168]
Dennoch ist die rechte Hemisphäre durchaus zu eigener Erfassung und Wahrnehmung in der Lage. Ein Experiment mit den oben erwähnten sogenannten Split-Brain-Patienten verdeutlicht dies: Wurde der rechten Hemisphäre das Bild eines nackten jungen Mädchens dargeboten, so erklärten die Patienten, daß sie ein weißes Licht gesehen hatten, aber nichts erkannten. Das war eine typische Reaktion für Bilder, die der rechten Hemisphäre angeboten wurden, da sie nicht logisch zusammengesetzt werden konnten. Aber es ließ sich etwas anderes beobachten. Die Patienten lächelten, erröteten, kicherten oder veränderten den Tonfall ihrer Stimme. Befragte man die Patienten, so sagten sie zum Beispiel, daß sie über den Diaprojektor oder das Licht lachten. Die ›sprechende‹, linke Hemisphäre hatte keine Vorstellung, worum es sich handelte. Dennoch hatte die rechte Hirnhemisphäre, die sich nicht sprachlich artikulieren kann, eine deutliche Vorstellung von dem Bild entwickelt.« [15; 19, S. 235–236]
5.2.3Funktionen der Subjektivierung
Der Prozess der Subjektivierung hat wichtige Funktionen. Er reduziert die Komplexität einer unübersehbaren Vielzahl von Informationen und verdichtet sie in Geschichten, Erklärungen und überschaubaren Überzeugungen. Die Subjektivierung vermittelt vor allem aber das Gefühl, die Welt und sich selbst verstehen und dadurch kontrollieren zu können. Das heißt, der Gebrauch der Vernunft führt häufig zum Erleben von Kompetenz. Evolutionär wäre es ein Problem, wenn der Gebrauch der ausgeprägten menschlichen Vernunft zum Gegenteil führen würde. In der Tat gibt es ja die Meinung, dass der exzessive Gebrauch der Vernunft eher zum Unglücklichsein und zu Zweifeln disponiert, nicht zuletzt, weil viele Fragen unbeantwortet bleiben. Man kann viele der aufgezeigten Mechanismen so verstehen, dass sie das Individuum vor dieser Nebenwirkung der Vernunft schützen. Damit kommen wir wieder auf das schon zitierte evolutionäre Credo zurück:
Besser falsch, dafür aber schnell und/oder eindeutig. Es ist egal, wenn der Mensch einem Irrtum unterliegt, solange er nur selbst daran glaubt, Richtiges erkannt zu haben, und sich dadurch gut fühlt. Das stärkt das eigene Kompetenzerleben, den Selbstwert und ist ein Element der eigenen Identitätsbildung.
Es gibt Menschen, bei denen die Kompetenzüberzeugung in der Weise vorliegt, dass sie subjektiv davon überzeugt sind, in vielen Bereichen über mehr oder genaueres Wissen zu verfügen als andere Menschen. Nun ist diese Überzeugung offensichtlich einer subjektiven Verzerrung geschuldet. Denn es ist immer so, dass man nur in einigen wenigen Themen überdurchschnittliches Wissen haben kann, verglichen mit unendlich vielen Bereichen, in denen man nur grobe Kenntnisse hat oder überhaupt nichts weiß.
5.3Generalisieren
Die Generalisierung wurde bislang unzureichend berücksichtigt, obwohl auch sie weitreichende Konsequenzen hat. Sie findet nicht immer statt. Viele alltägliche Eindrücke, Gedanken, Erkenntnisse und Bewertungen sind flüchtiger Natur, sodass sie deswegen im Hintergrund bleiben und sich nicht für eine Generalisierung eignen. Aber mit den vorangehend zusammengefassten Mechanismen ist eine generelle Tendenz verbunden, Erkenntnisse zu generalisieren. So steckt die Generalisierungstendenz bereits in vielen Mechanismen der Subjektivierung. Sie wird schon durch die Tendenz zur Polarisierung (schwarz/weiß, entweder/oder etc.) nahegelegt. Denn etwas, das schwarz oder weiß ist, ist zu hundert Prozent schwarz oder zu hundert Prozent weiß. Auch der Halo-Effekt ist nichts anderes als die unkritische Generalisierung der Bewertung einer einzelnen Information auf viele weitere Aspekte, die mit der ursprünglichen Information gar nichts zu tun haben. Zahlreiche andere Mechanismen (z. B. Selektion von Informationen, Vermeidung widersprüchlicher Informationen, Ausrichtung der Informationen an einem eigenen, inneren Skript, das nicht infrage gestellt wird) sind ebenfalls sehr gut geeignet, Ideen oder Theorien auszuweiten, aufzupumpen und letztlich zu generalisieren.
Es kommt hinzu, dass die Generalisierung dem Pol der menschlichen Natur entspricht, der als egoistische Selbstbehauptung bzw. Wille zur Macht bezeichnet wurde. Die egoistische Selbstbehauptung als Wille zur Macht hat, wie bereits erwähnt, etwas Fortschreitendes und Grenzenloses. Sie ist mit einer Überbewertung der eigenen Perspektive und des eigenen unbedingten Wertes verbunden. Sie lebt vom Prinzip, die Umwelt und insbesondere andere Menschen zu kontrollieren, zu unterwerfen und zu beherrschen. Die mit der Generalisierung verbundene Ausweitung und Allgemeingültigkeit eigener Sichtweisen kommt all diesen Aspekten entgegen.
Die Generalisierungstendenz begegnet uns deshalb überall im Alltag. Aus einem punktuell richtigen Gedanken wird eine umfassende Theorie, aus einer Regel eine ausufernde Bürokratie, aus einer bequemen Sichtweise eine Ideologie oder Religion.