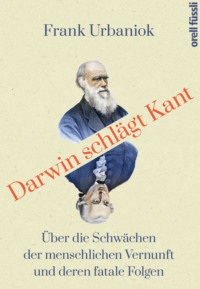Kitabı oku: «Darwin schlägt Kant», sayfa 8
4.4Individuelle Zuspitzungen der basalen Evolutionsprinzipien der menschlichen Natur
Generell sind in jedem Menschen beide Prinzipien angelegt. Aber individuell gibt es große Unterschiede. So verkörpert das oben beschriebene Persönlichkeitsprofil der Kaltblütig manipulativen Persönlichkeit (KmP) eine individuell extreme Ausprägung beider Prinzipien: eine sehr geringe Ausprägung des Kooperationspotenzials auf der einen und eine extrem starke Ausprägung der egoistischen Selbstbehauptung auf der anderen Seite. Es ist klar, dass die individuelle Akzentuierung der egoistischen Selbstbehauptung häufig mit negativen Folgen für andere Menschen verbunden ist.
Es gibt auch das genaue Gegenteil. Das sind Menschen, die in übertriebener Weise an das Gute aller anderen Menschen glauben. Dadurch verkennen sie Risiken und neigen auf unkritische Weise zu einer naiven Gutmütigkeit. Besonders deutlich wird eine individuelle Übersteigerung des Kooperationspotenzials der menschlichen Natur auf Kosten der egoistischen Selbstbehauptung bei Personen mit einer Dependenzproblematik. Sie haben die Tendenz, ganz und gar in der sozialen Beziehung aufzugehen und die eigene Identität übertrieben stark zu relativieren. Darum besteht bei ihnen die Gefahr, dass sie anderen Menschen zu viel Macht über die eigene Person geben.
Dazu habe ich an anderer Stelle ausgeführt: »Von anderen Menschen abhängig zu sein und sich ihnen unterzuordnen, kann ein angemessenes Verhalten sein. So ist Abhängigkeit in der kindlichen Entwicklung normal. Neben einer bestimmten Lebensphase kommen Abhängigkeiten und Unterordnung auch kontextbezogen vor. Im Militär, als Patient im Krankenhaus oder als Mitglied eines Arbeitsteams können mehr oder weniger stark ausgeprägte Aspekte von Abhängigkeit und Unterordnung ein adäquates Verhalten sein. Demgegenüber gibt es aber Situationen, in denen die Unterordnung eigener Interessen und Bedürfnisse unter diejenigen einer anderen Person […] ein auffälliges Verhalten sein kann. Die Unangemessenheit eines unterordnenden und abhängigen Verhaltens stellt somit ein wichtiges Kriterium der Dependenzproblematik dar.«
Für die Diagnose einer dependenten Persönlichkeitsstörung gibt es folgende Kriterien:
1.»Bei den meisten Lebensentscheidungen wird an die Hilfe anderer appelliert oder die Entscheidung wird anderen überlassen.
2.Unterordnung eigener Bedürfnisse unter die anderer Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht, und unverhältnismäßige Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen anderer.
3.Mangelnde Bereitschaft zur Äußerung angemessener Ansprüche gegenüber Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht.
4.Unbehagliches Gefühl beim Alleinsein aus übertriebener Angst, nicht für sich allein sorgen zu können.
5.Häufige Angst, von einer Person verlassen zu werden, zu der eine enge Beziehung besteht, und auf sich selbst angewiesen zu sein.
6.Eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen ohne ein hohes Maß an Ratschlägen und Bestätigungen von anderen.
7.Zusätzlich können sich die Betreffenden selbst hilflos, inkompetent und nicht leistungsfähig fühlen (Weltgesundheitsorganisation 1999).« [13] zitiert nach [11, S. 236–237]
Die Zuspitzungen der beiden zentralen evolutionären Prinzipien der menschlichen Natur in Form individuell problematischer Persönlichkeitsprofile verdeutlichen, welches die positiven Aspekte des jeweils entgegengesetzten Pols sind. Durch eine individuell überdurchschnittliche Ausprägung der egoistischen Selbstbehauptung werden die Umwelt und vor allem andere Menschen geschädigt. Durch eine individuell überdurchschnittliche Ausprägung des Kooperationspotenzials erfährt vor allem die betroffene Person selbst Nachteile.
4.5Abgrenzung schafft Identität
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Aktivierung des menschlichen Kooperationspotenzials häufig mit emotionalen Korrelaten einhergeht und dass dieser Prozess sehr rasch ausgelöst werden kann. Viele kennen das aus eigener Erfahrung. Wer schon einmal in einer Gruppe von Fußballfans marschiert ist, im Karneval oder bei Konzerten in emotional gelockerter Stimmung wildfremde Menschen umarmt hat, der bekommt ein Gefühl dafür, wie schnell sich dieser Schalter bei uns umlegen lässt. Ein anderes Beispiel sind politische Massenveranstaltungen – sei es bei den Nationalsozialisten oder aktuell in der Türkei, wenn dem »Messias« gehuldigt wird. Menschen haben in diesen Situationen die Tendenz, in der Masse aufzugehen und die Grenzen der eigenen Individualität zu lockern. Das kann in vielen unterschiedlichen Situationen geschehen und ist von einem Moment auf den anderen sogar mit wildfremden Menschen möglich. Dies und dass das Aufgehen in einer Gruppe von einem starken positiven Gefühl getragen wird, sind deutliche Indizien dafür, dass wir es hier mit einem Programm zu tun haben, das die Evolution in der menschlichen Natur angelegt und tief verankert hat.
Wenn Menschen eine Gruppenidentität annehmen und dabei ihre individuelle Identität relativieren, geschieht das durch eine starke Aktivierung des Kooperationspotenzials. Diese Aktivierung bleibt aber auf die jeweilige Gruppe beschränkt. So leben zum Beispiel politische oder religiöse Gruppen, Hooligans und andere Gangs davon, Gruppenidentitäten dadurch zu festigen, dass sie sich scharf von anderen Gruppen abgrenzen. Abgrenzung ist ein Element, das eng mit dem Identitätserleben am Pol egoistischer Selbstbehauptung verbunden ist: Hier bin ich und behaupte mich gegen den Rest der Welt!
Abgrenzung ist generell ein Mechanismus, um Identitäten zu schaffen oder Identitäten zu schärfen. Es ist nicht der einzige Mechanismus, aus dem sich Identitätserleben speist, aber es ist ein sehr mächtiger, archaischer, allgegenwärtiger und oft auch gefährlicher Mechanismus. Um die zentrale Bedeutung dieses Mechanismus zu verdeutlichen, könnten wir eine Ursprungsgeschichte erzählen, in der die Schaffung von Identität durch Abgrenzung zum zentralen Prinzip erklärt wird:
Nur durch Abgrenzung wird Identität geschaffen. Bereits der Beginn des Universums verdeutlicht dieses Prinzip. Denn am Anfang war das Nichts. Im Nichts gibt es keine Materie, kein Lebewesen, keinen Planeten, kein Atom, keine Zeit, keinen Raum … nichts, ganz und gar nichts. Vergegenwärtigt man sich diesen Zustand, dann ist die erste Materie, die das Nichts zerstört, nichts anderes als eine Abgrenzung vom Nichts. Die erste Materie ist eine Nicht-Nichts-Insel in einem Meer des Nichts. Die gesamte Weiterentwicklung kann man nun als eine Fortsetzung des Abgrenzungsprinzips verstehen. So ist das erste Atom eine Abgrenzung von diffuser Materie: eine Insel atomarer Materie in einer diffusen Materiesuppe. Der erste Planet ist eine Abgrenzung von atomaren Gaswolken (eine erste Planeteninsel im unendlichen Gasnebel). Das erste Sonnensystem ist eine Abgrenzung von einzelgängerischen Planeten (eine erste Sonnensysteminsel im Chaos umherfliegender Planeten) usw.
Machen wir einen großen Sprung hin zur Entstehung des Lebens. Wieder begegnet uns Abgrenzung als zentrales Prinzip. Der Beginn des Lebens besteht darin, dass sich DNA-Bruchstücke von einer molekularen Ursuppe abgrenzen. Nach diesem Startschuss geht ein nicht enden wollender Kampf los: jeder gegen jeden. Bakterien, Viren, Fische, Schlangen, Ameisen, Löwen, Tiger, Affen … Nein, es geht nicht um Kooperation, nicht um friedliche Koexistenz. Die Devise ist vielmehr: Abgrenzung, fressen und gefressen werden.
Auch in unserer eigenen Entwicklung ist dieses Prinzip feststellbar. Der Säugling erlebt sich noch zunächst als von seiner Umgebung unabgegrenzt. Seine Identitätsentwicklung besteht darin, dass er die Fähigkeit entwickelt, zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden.
Generell wissen wir aus der Wahrnehmungstheorie, dass Identität erst durch Verschiedenheit und durch Abgrenzung erkennbar wird. Eine weiße Schrift ist in einer weißen Umgebung nicht wahrnehmbar. Umso klarer sehen wir die weiße Schrift aber vor einem schwarzen Hintergrund. Abgrenzung begegnet uns überall und schafft permanent und flexibel auf unterschiedlichsten Ebenen Identität. Das persönliche Identitätserleben besteht darin, sich selbst als gegenüber allen anderen Menschen anders und abgegrenzt zu erleben (ich versus alle anderen Menschen).
Dekliniert man dieses Prinzip weiter, dann entsteht eine Familienidentität dadurch, dass sich Familienmitglieder als gegenüber Nicht-Familienmitgliedern abgegrenzt erleben (Familie versus Nicht-Familienmitglieder). Manchmal erleben sich die Bewohner eines Stadtviertels (Quartiers) als eine Gemeinschaft. Hier grenzen sich die Bewohner des eigenen Viertels gegenüber den Bewohnern anderer Viertel ab (Quartierbewohner versus Nicht-Quartierbewohner). Ein gängiges Phänomen ist es, dass sich vor allem Nachbarstädte gegeneinander abgrenzen. Diese Abgrenzung besteht häufig in einer zugespitzten Rivalität und wird auf verschiedenen Ebenen geradezu zelebriert (eigene Stadt versus fremde Stadt).
Familienmitglieder, Quartierbewohner und unzählige Bewohner aller möglichen Städte werden aber dann rasch unter einer anderen Perspektive zu einer homogenen Identität, wenn Inländer gegenüber Ausländern abgegrenzt werden. Hier entsteht eine Identität und Verbundenheit mit den Bewohnern des eigenen Landes gegenüber den Bewohnern aller anderen Länder (Inländer versus Ausländer). Die Konkurrenz, die vielleicht gerade noch bei einem Fußballspiel zwischen zwei Ländern sehr ausgeprägt war, kann in einer neuen Identität – theoretisch – aufgelöst werden, wenn ein Spiel zwischen verschiedenen Kontinenten angesetzt würde. Würden nun die Konkurrenten von eben zum Beispiel in einer Europaauswahl gegen eine Auswahl des amerikanischen Kontinents antreten, würden wir den noch kurz zuvor als feindlich erlebten Konkurrenten ob seiner großen Qualitäten freudig in unserer eigenen kontinentalen Mannschaft begrüßen. Wir könnten uns mit der neu geschaffenen Mannschaft in ähnlicher Weise identifizieren, wie wir es zuvor mit der Ländermannschaft getan haben. Wenn wir dieses Prinzip noch eine Stufe weitertreiben, dann könnte man theoretisch das Szenario eines Kampfes der Menschheit gegen Außerirdische konstruieren. In diesem Fall würden wir uns stark mit der gesamten irdischen Menschheit identifizieren, die zum Kampf gegen die Außerirdischen antritt. Alle Abgrenzungen und Unterschiede, die zuvor in allen möglichen Facetten dazu geführt haben, viele andere Menschen als fremd, anders und sicher nicht zu unserer Gemeinschaft gehörig anzusehen, wären mit einem Schlag verschwunden oder zumindest zeitweise erheblich relativiert.
Wir erkennen an diesen Beispielen, wie flexibel wir sind, die jeweiligen Abgrenzungen und Zugehörigkeiten anzupassen. Zentral bleibt aber immer ein Prinzip: Abgrenzung und das Erleben von Unterschiedlichkeit schaffen Identität. Wer zu einer eigenen Identität bzw. einer eigenen Gruppe gehört und wer nicht, hängt davon ab, unter welchen Kategorien wir die jeweiligen Personen subsumieren. Die Flexibilität besteht darin, dass wir problemlos sehr enge oder aber sehr weit gefasste Kategorien mit einem eigenen Identitätserleben und dem entsprechenden Gefühl von Verbundenheit koppeln können. Diese Fähigkeit ist Teil unseres Kooperationspotenzials, das uns die Evolution als ein Standardprogramm mitgegeben hat.
Ein häufig praktizierter Mechanismus, um sich positiv zu identifizieren, ist es übrigens, die anderen, von denen man sich abgrenzt, zu disqualifizieren. Es ist z. B. weit verbreitet, über andere (Mitglieder einer anderen Abteilung, einer anderen Berufsgruppe, einer anderen Firma, Angehörige einer anderen Rasse, Bewohner einer anderen Stadt, Vertreter einer anderen Überzeugung etc.) schlecht zu reden. Jeder kennt Alltagssituationen, in denen das zu beobachten ist. Gemeinsam über andere Personen schlecht zu reden, ist gut für das eigene Selbstwertgefühl. Weil die anderen Idioten sind, steht man selbst besser da – denn man ist ja anders. Gemeinsam über andere schlecht zu reden, erzeugt ein wohltuendes Gemeinschaftsgefühl. Es ist zudem eine gute Strategie, Konflikte in der eigenen Gruppe, in der eigenen Familie zu verdecken. Sie vermittelt bequeme Erfolgserlebnisse, ohne dass man eine eigene Leistung dafür erbringen muss. Andere Menschen zu diskreditieren, erzeugt in diesem Sinne Sicherheit: Wir sind auf der richtigen, der stärkeren Seite etc.
4.6Das Verhältnis Mensch – Tier: Ein Beispiel für die Aktivierung und Deaktivierung des Kooperationspotenzials
Wir haben gesehen, dass unsere Vernunft durch eine Reihe psychologischer Mechanismen verdünnt und zurechtgebogen wird, um aus evolutionärer Sicht nicht mehr zu schaden, als sie nutzt. Ihrem Prinzip »Besser falsch, dafür aber schnell und/oder eindeutig« kann man noch hinzufügen, dass die Aufrechterhaltung einer stimmigen Identität ebenfalls ein wichtiges Ziel darstellt. Da soll uns weder die Vernunft in die Quere kommen, noch sollen uns alltägliche Handlungen zu sehr erschwert werden. So ist auch die Aktivierung oder die Deaktivierung des Kooperationspotenzials in vertraute und bequeme Erklärungen eingebettet. Sie unterliegen den vielfältigen, vorangehend dargestellten psychologischen Mechanismen. Man kann einige dieser Mechanismen gut am Beispiel des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier demonstrieren.
Die meisten Menschen empfinden sich als tierlieb. Zwar steigt seit einigen Jahren die Zahl derjenigen, die aufgrund dieser Haltung auf Fleischkonsum verzichten. Die Mehrheit isst aber Fleisch, ohne das als einen scharfen Widerspruch zur eigenen Einstellung wahrzunehmen. In einer sehenswerten Fernsehdokumentation des Schweizer Fernsehens wurden einige Personen porträtiert, bei denen dieser Widerspruch besonders deutlich zum Vorschein kommt. [14]
Zu diesen Personen gehörte ein passionierter Jäger, der das Töten von Tieren offensiv als wichtigen Teil seiner Identität vertrat. Gleichzeitig hatte er eine sehr innige Beziehung zu seinem Jagdhund. Dem hatte er einen Namen gegeben und vergötterte ihn fast ein wenig. Ein anderes Beispiel ist, dass sich die meisten Menschen über Länder empören, in denen Hunde und Katzen gegessen werden. Aber worin genau soll der Unterschied zu der Gewohnheit bestehen, Kälber und Lämmer zu verspeisen?
Die Beispiele zeigen, wie flexibel wir darin sind, zu Lebewesen einen persönlichen Bezug zu entwickeln und gleichzeitig einer Vielzahl eben dergleichen Lebewesen jede Daseinsberechtigung abzusprechen. Ein gutes Stück Fleisch auf dem Teller, leckere Hähnchenschenkel im Supermarkt. So nehmen wir im Alltag das Fleisch von Tieren wahr, so kategorisieren wir die Wirklichkeit. Es ist theoretisch nicht schwierig, sich durch den Verstand bewusstzumachen, dass es sich um Leichenteile von Tieren handelt. Vielleicht haben wir auch schon manchmal darüber nachgedacht und den Widerspruch zu unserer ansonsten empfundenen Tierliebe erkannt. Solche Momente sind aber eher selten und haben keine zwingende Konsequenz. Die alltägliche Kategorisierung entspricht einer drastischen Selektion von Information. Sie funktioniert problemlos weiter, obwohl wir vielleicht schon einige Male über den Widerspruch nachgedacht haben. Die Kategorisierung ist bequem. Denn sie ermöglicht ein problemloses Handeln (problemloses Essen), weil sie im Alltag keinen Raum für Ambivalenz lässt.
Manch einer reagiert aggressiv, wenn er auf diesen Widerspruch hingewiesen wird. Man wehrt sich dagegen, sich von anderen ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen. Es geht mir bei diesem Beispiel nicht darum, eine richtige oder eine falsche Haltung zu vermitteln. Es geht mir um den Umgang mit dem logischen Widerspruch. Das Beispiel verdeutlicht, wie flexibel wir darin sind, durch entsprechende Kategorisierung (implizite Theorien, Ideologien, Betrachtungsweisen, Überzeugungen) homogene Bilder zu produzieren und damit logische Widersprüche wegzudefinieren.
Die innige Beziehung zum eigenen Haustier, das einen Namen trägt, zeigt, dass wir ein genauso homogenes Bild als Grundlage unseres Verhaltens in umgekehrter Richtung produzieren können. Wir kennen den Mechanismus bereits. Es handelt sich um die variable Grenze zwischen »eigene Gruppe/eigene Familie« und »fremde Gruppe/fremde Familie«. Der Hund, der einen Namen trägt, erhält dadurch ein Gesicht und eine Identität. Das ist eine gute Basis, das ganze Spektrum des evolutionär angelegten Kooperationspotenzials abzurufen, das auf eigene Familienmitglieder angewendet wird. Dass damit ein Heer namenloser anderer, gleichartiger Lebewesen ausgeschlossen wird, ist subjektiv kein Widerspruch. Im Gegenteil ist das sogar das Kennzeichen dieses Prinzips. Es gibt einige Individuen im eigenen Kreis und viele außerhalb dieses Kreises.
So dürfte es auch am Beginn der Menschheitsgeschichte gewesen sein. Die mit der Bindung einhergehenden Gefühle (Sympathie, Freundschaft, Verbundenheit, Liebe etc.) sind evolutionär der Leim, der die sozialen Beziehungen zur eigenen Gruppe tragfähig und damit zumindest potenziell dauerhaft werden lässt. In diese Werkzeugkiste hat die Evolution gegriffen, um dem Menschen eine besonders gute Grundlage für die Gruppenkooperation zu geben. Eine wichtige Komponente dieses Leims ist eine in aller Regel stark ausgeprägte Tötungshemmung, die mit der Bindung und ihren typischen emotionalen Korrelaten einhergeht.
Das Gegengewicht gegen diesen starken Leim ist die Flexibilität in seiner Anwendung. Ob der Leim wirksam wird oder nicht, hängt von der Kategorie ab, in der das Lebewesen subjektiv erfasst wird. Wir haben diesen Mechanismus bereits anhand identitätsbildender Konflikte zwischen Fans des eigenen Fußballvereins und Fans eines anderen Fußballvereins oder den Einwohnern der eigenen und den Einwohnern einer Nachbarstadt kennengelernt. In andere Dimensionen gesteigert wirkt derselbe Mechanismus bei Kriegen und bei fundamentalistischen Ideologien. Die »Anderen« sind hier oft eine Kategorie, deren Individuen nicht mehr als Menschen betrachtet werden. Es ist der namenlose Feind, es sind die Ungläubigen, die den Tod verdienen, Angehörige einer Rasse, die keine Lebensberechtigung haben, etc.
Konnten KZ-Aufseher treusorgende Familienväter sein? Ja, selbstverständlich. Denn das, was uns von außen als logischer Widerspruch erscheint, muss subjektiv keiner sein. Die Arbeit im KZ oder bei Erschießungskommandos im Feindesland wurde vielleicht sogar gerade aufgrund ihrer abstoßenden Qualität subjektiv als besonderer Dienst für das eigene Land kategorisiert. Sicher fehlen in der vorherrschenden Kategorisierung der Opfer aber die Aspekte, die das Kooperationsprogramm auslösen können (Bindung). Durch die Kategorisierung findet eine Entmenschlichung statt. Dadurch wird die mit dem Kooperationsprogramm einhergehende Tötungshemmung hinfällig. Das alles hat dann aber in der eigenen Wahrnehmung selbstverständlich nichts mit der eigenen Familie oder gar den eigenen Kindern zu tun. So wie das Stück Fleisch auf dem Teller nicht als ein verhaltensrelevanter Widerspruch zur eigenen Tierliebe empfunden wird oder der eigene Jagdhund vergöttert werden kann, ohne dass ein subjektiver Widerspruch zum Abschlachten vieler anderer Tiere in einem anderen Kontext entsteht.
Wir gehen Ambivalenzen nach Möglichkeit aus dem Weg und sind bestrebt, kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Besonders große Hemmungen, bequeme und vertraute Sichtweisen infrage zu stellen, bestehen, wenn sie eng mit dem eigenen Selbstbild verknüpft sind. Da leisten die dargestellten Mechanismen im Alltag gute Dienste. Sie ermöglichen eine Kontinuität in der Lebensführung, eine Stabilität des eigenen Selbstbildes und schaffen dadurch eine klare Handlungsgrundlage. Logische Widersprüche, die wir mit der Vernunft erkennen können, führen nicht auf direktem Weg zu Einstellungs- oder gar Verhaltensänderungen. Im Gegenteil. Denn das Credo lautet: besser falsch, dafür schnell und/oder eindeutig. Das heißt auch: Die gefühlte, bequeme Wahrheit schlägt oft die unbequeme, kognitive Wahrheit.