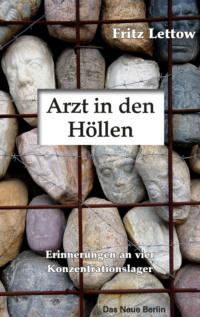Kitabı oku: «Arzt in den Höllen», sayfa 3
Während ich noch am Fenster stand und nach oben rief, ging plötzlich die Tür auf, und ein Beamter, der mich durch das kleine Sehloch in der Tür, den »Spion«, beim Sprechen beobachtet hatte, kam herein. Ich war bei einer verbotenen Handlung erwischt worden. Der Beamte drohte mir. Am selben Abend noch wurde ich zum Inspektor gerufen, der mich fragte, was ich da zu sprechen hatte. Ich konnte die Wahrheit natürlich nicht sagen und musste eine Ausflucht gebrauchen. Ich log und sprach von der Uhrzeit, nach der man mich gefragt hatte. Die Sache ging vorbei, aber die Kameraden da oben schienen verlegt worden zu sein. Jedenfalls hörten die abendlichen Unterhaltungen auf.
Aber meine eigenen Fesseln wurden jetzt besonders stramm angezogen, so wie in den ersten Tagen. Das sollte wohl eine Strafe sein. Ingrimmig musste ich lächeln. Wie einen kleinen Jungen behandelten sie mich.
Nach einigen Tagen legte sich das wieder. Die Zügel wurden wieder etwas lockerer. Ich konnte wieder aufatmen, ohne von dauernden Schmerzen gepeinigt zu sein.
Mein Aufzug war jetzt wirklich räubermäßig. Der struppige Bart wucherte mir über den Mund. Da ich keine Schere hatte, musste ich einzelne vorstehende Haare mit den Zähnen abbeißen, so gut es eben ging. Aß ich, so war mir der Bart hinderlich, besonders, wenn ich einen Hering bekam, was ziemlich oft geschah. Mit dem kleinen Holzmesser mühsam die Gräten heraushebelnd, musste ich abbeißen, und der Saft tropfte in meine Barthaare. Trotz allen Waschens war der penetrante Heringsgeruch für Tage nicht wegzubekommen. Aber das waren natürlich Bagatellen!
Ich lernte die früher so selbstverständlichen Dinge der Zivilisation in einem neuen Licht sehen. Und was mir einst nie begehrenswert schien, etwa ein Parfüm oder eine gute Seife, war nun zum Inbegriff einer höheren Kultur geworden. Viele meiner Anschauungen hatten sich gewandelt, was draußen oben war, war hier unten, was draußen gut war, war hier böse, was man draußen tun musste, musste man hier lassen. Es war eine Umwandlung aller Werte, und je länger meine Haft dauerte, desto mehr musste ich umlernen, neue Begriffe formen. Hier war ich außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, außerhalb jeder bürgerlichen Moral. Wie ein Tier musste ich darauf sinnen, meinen Peinigern mit Klugheit ein Schnippchen zu schlagen, sie zu überlisten. Ich gelangte langsam in eine Welt, die sich jenseits der überkommenen Begriffe von Gut und Böse befand. Und allmählich erst, nach Monaten und Jahren, würde ich lernen, dass auch sie ihre ungeschriebenen Regeln und Gesetze hatte. Später erst wurde mir klar, was mir viele Kameraden in der Haft immer wieder sagten: »Niemand kommt hier so heraus, wie er hereingekommen ist.«
Ob ich in den hölzernen Klapptisch ein Schachdiagramm einschnitt und mit Zeitungsfetzen als Figuren mit mir allein Schach spielte, ob ich Kreuzworträtsel selbst fabrizierte, ob ich später irgendwelche Zeitschriften von den Wachleuten erbettelte, ob ich durch Klingeln kurz vor den Essenszeiten versuchte, die Qualen der Fesselung abzukürzen, was mir oft gelang – es war das eigentlich verboten, aber immer war es ein Kampf um diese Kleinigkeiten, die den Geist wachhielten, dem Körper Erleichterung verschafften und das Dasein ein wenig erträglicher gestalten sollten.
Als genau zehn Wochen vergangen waren, wieder an einem Freitag, öffnete sich meine Zellentür. Ein Kommissar und ein Wachmann traten herein.
»Sie haben jetzt wohl keine Selbstmordabsichten?« Ich verneinte auf das Entschiedenste.
»Dann wollen wir Ihnen jetzt die Fesseln abnehmen.« Der Wachmann schloss die »Brezel« auf, nahm sie mir ab, und beide gingen wieder hinaus. Ich war allein. Ich wusste, ich hatte gesiegt, ich hatte meine Kameraden nicht verraten, die Qualen waren nicht umsonst gewesen; und das Gefühl der endlichen, so lange und so sehnlich erwarteten Befreiung von dieser Pein überwältigte mich derart, dass ich – zum ersten mal in meiner Haft – in einen Strom von Tränen ausbrach. Ich schämte mich dessen nicht.
Alle anderen Bedingungen blieben für mich die gleichen, aber meine Hoffnungen auf Besserung meiner Lage wuchsen. Noch zwei Wochen blieb ich in meiner dunklen Zelle, nun waren insgesamt zwölf Wochen vergangen.
Dann endlich holte man mich heraus. Gab mir eine helle Zelle, die einen kleinen Blick auf den blauen Himmel erlaubte, auf den ich mit heller Wonne schaute. Dann kamen all die anderen Dinge, die ich so lange entbehrt hatte. Ich erhielt meine eigene Kleidung wieder, der lange Bart fiel, meine wirren Haare wurden geschnitten, und endlich, endlich durfte ich in dem kleinen Hof wieder einmal die Sonne sehen. Ich schaute sie an, bis die Augen schmerzten: die Sonne, die Sonne! Es war wie ein Wunder! Ich bekam ein Buch, konnte lesen, und gierig verschlangen meine Augen die Zeilen.
Dann schaffte man mich in das Untersuchungsgefängnis derselben Stadt. Ich kam dort mit ein paar Kriminellen in einen Raum. Es war köstlich für mich, seit einem Vierteljahr wieder einmal mit Menschen reden zu dürfen, wieder mehr Bücher zu haben.
Ich lernte nun so mancherlei Dinge, die Kriminelle in den Gefängnissen seit je zu tun pflegen: Feuer mit einem Metallknopf machen, der in der Mitte eines Fadens hing und den sie gegen einen Steinkrug schnurren ließen. Seine Funken setzten geschabtes Zelluloid von einer Zahnbürste oder einem Kamm in Brand. Oder sie wurden mit einer »Lunte« aufgefangen, einem angesengten Stück Stoff, wo sie weiter glimmten, so dass man eine Zigarette daran anzünden konnte. Ich hörte sie von mancherlei Diebstählen sprechen, ich hörte sie sexuelle Perversionen ausmalen, wovon sie ein ganzes Arsenal voll zur Verfügung hatten. Wenn ich später mit politischen Kameraden über die Zeit bei den Kriminellen sprach, so hatten sie alle ziemlich die gleichen Erfahrungen gemacht: Es waren immer die gleichen arbeitsscheuen Elemente, die durch allerhand feine und grobe Gewitztheiten versuchten, sich auf bequeme Art Vorteile zu verschaffen. Klug waren sie nur bis zu einem gewissen Grade, denn ihre Klugheit reichte nie aus, um zu erkennen, dass sie früher oder später doch alle »gingen«, wie ihr Fachausdruck hieß. Sie waren alle geborene Individualisten, wie sie auch fast immer Egoisten waren. Für politische Gespräche waren sie nicht zu haben. Ihrem Individualismus widerstrebte ein politisches, für eine Gemeinschaft getragenes Ziel. Auch fehlte ihnen das Verständnis, für eine Idee zu kämpfen oder gar zu leiden. Sie hielten die Politischen entweder für dumm oder für unbelehrbare Fanatiker oder gar für Berechnende, die in späteren Zeiten auf einen guten Posten rechneten.
Je länger ich mit dieser Art von Menschen zusammen war, desto unangenehmer wurden sie mir. Viele warteten ja nicht auf die Verurteilung ihrer ersten Straftat, sondern es ging um das letzte Glied in einer langen Kette von »einschlägigen« Delikten. Sie blieben meist bei ihrem Fach. Der Betrüger beim Betrug, der Falschspieler beim Falschspiel, der Dieb beim Diebstahl usw.
In dieser Zeit fand auch die gerichtliche Untersuchung meines »Falles« statt. Der Untersuchungsrichter fragte mich korrekt. Schließlich ging es nur um eine Zusammenfassung dessen, was die Gestapo-Beamten notiert hatten.
Ich war froh, als ich das sechsstöckige Haus am Münchner Platz endlich verlassen konnte.
Nun transportierten sie mich in ein Gefängnis für Politische, in die sogenannte »Mathilde«. Glücklicherweise war ich dort auch mit politischen Gefangenen zusammen, deren mehrere hundert die Zellen füllten. Zu zweit in einer kleinen Zelle, den Schikanen der dortigen Wachtmeister nur ab und an ausgesetzt, war es im ganzen erträglich. Was bedeuteten schon ein paar hundert Wanzen in der Zelle? Wir machten uns einen Spaß daraus, sie in den Mauerritzen zu jagen. Wenigstens hatten wir Bücher, und wenn ich in Freiheitstagen wenig Zeit zum Lesen gehabt hatte, so hatte ich nun Gelegenheit, manches zu lesen, wozu ich sonst nie gekommen war.
War ich mit einem einfachen Menschen zusammen, so gehörte es zur Regel, dass wir uns in den ersten ein bis zwei Wochen viel zu erzählen hatten. Dann aber versagte der Gesprächsstoff. Das Thema Familie, Stadt, Politik war allmählich erschöpft, und wir wurden uns langweilig. War es ein guter Kamerad, so war es erträglich, war es ein schlechterer, so wurde es mit der Zeit fast unerträglich in der Zelle. Es begann das, was die Polarforscher die »Polarkrankheit« nennen: Man konnte sich in den engen Polarzelten nicht mehr sehen und explodierte bei der geringsten Gelegenheit. Ähnliches, wenn vielleicht auch nicht so krass, ergab sich mit der Zeit in der Enge der Zelle.
Täglich gingen wir für eine halbe Stunde in dem kleinen Hof herum: Einzeln, je drei Meter Abstand haltend, das Sprechen war streng verboten. Trotzdem war es kein stumpfsinniges Umhertrotten, wir sahen bekannte Gesichter, gute Kameraden, Junge und Alte, wir konnten uns zunicken, und wir lernten es, uns in manchen Momenten trotz der scharfen Aufsicht der Wachtmeister einiges zuzuflüstern. Wir lernten sprechen, ohne dass man die Bewegungen unseres Mundes sah. Mit leicht seitwärts geöffneten Lippen, wenige leise Stichworte, die der andere doch verstand. So trugen wir einander Nachrichten zu. Wir lernten, uns durch Klopfzeichen an die Wände zu verständigen und uns durch die Abortanlagen in den Zellen etwas zuzurufen. Wir hatten eine Art Alphabet ausgearbeitet, wodurch das »Morsen« schneller ging. Wir hatten Klopfzeichen, die für jede unserer Heimatstädte charakteristisch waren, so dass man in den Zellen gleich wusste, aus welcher Stadt der Nebenmann stammte. So wussten alle gut übereinander Bescheid.
Die große Frage für jeden war der Prozess. Hast du schon die Anklage? Wie viel Jahre erwartest du? Wann ist dein Prozess? Wie viel hat der und der bekommen? Das waren die täglichen Fragen, die wir, alle miteinander verbunden, uns nun stellten.
Ich war über die Höhe der Urteile erstaunt. Zu unter zwei Jahren wurde niemand verurteilt, aber die Strafen für die meisten bemaßen sich weit, weit höher. Aber man gewöhnte sich auch daran. Wir wussten nun ungefähr, was jeder von uns zu erwarten hatte, und wir trugen es alle mit dem gleichen guten Mut. Nie hatte ich einen trauern oder weinen gesehen, freilich, lachende Gesichter hatten wir kaum. Die Alten waren schlechter daran als die Jungen, die sich schneller über alles hinwegsetzten und sich an vieles gewöhnten. Die meisten unter uns waren einfache Menschen aus dem Volk. Deren Moral war gut, der Mut ungebrochen, und das, obwohl die meisten Frauen und Kinder hatten, denen jetzt der Ernährer fehlte und die sich oft in verzweifelter Lage befanden. Manche erhielten Briefe, die ihnen von der Exmittierung ihrer Familien aus den Wohnungen Nachricht gaben. Manche Frauen ließen sich sogar unter dem Druck der Wohlfahrtsämter, die das wünschten, oder unter den Einfluss anderer Leute scheiden. Manchem wurden die Rechte über die Kinder entzogen.
So erfüllte viele von ihnen Bitterkeit, nie aber Verzweiflung. Sie erwiesen sich des politischen Kampfes, den sie geführt hatten, würdig. Mochten auch gelegentliche Ausnahmen unter ihnen sein, mochte hie und da ein Verräter auftauchen, dem viele, manchmal sehr viele zum Opfer fielen, im allgemeinen waren die Menschen gut. Politische Köpfe waren dabei, die in harter Schule und Selbstdisziplin für eine spätere Aufgabe heranreiften. Und wir erfuhren voneinander, dass wir fast alle in den ersten Tagen und Wochen von der Gestapo wüst geschlagen worden waren, um Aussagen zu erpressen. Viele waren mehrmals bis zur Besinnungslosigkeit geprügelt worden. Viele waren lange gefesselt gewesen, und alle hatten die ganze Stufenreihe der Schikanen durchmachen müssen.
Von manchen hörte ich auch, die so tapfer gewesen waren, dass sie sich lieber totschlagen ließen, als ihre Kameraden zu verraten. Kasparcyk hieß einer der Heldenmütigen, ein unbekannter Mensch, aber ein leuchtendes Fanal.
Nach vierzehn Monaten Untersuchungshaft war mir endlich eine Anklageschrift ausgehändigt worden. Der Prozess führte mich nun zum ersten mal mit Peschel und vier anderen, die ich früher nicht gekannt hatte, zusammen. Aber aus der Anklageschrift und aus vielerlei kleinen Begegnungen wusste ich um sie.
Es ist müßig, die wenig nützlichen Vorbereitungen des Pflichtverteidigers auf die Verhandlung zu erörtern und den Prozess selbst zu schildern, der drei Tage dauerte. Es genügt zu sagen, dass er – wie alle politischen Prozesse – geheim war und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Dies hatte seinen Grund darin, dass das ganze Gewebe politischer Naziwillkür, aber auch der Kampf der Illegalen der Allgemeinheit nicht bekannt werden sollte. Auch sollte um die Spitzel der Gestapo Stillschweigen verbreitet werden.
So wurde der Prozess hinter verschlossenen Türen geführt. Scheinbar verlief er einigermaßen korrekt. Der formale Prozessverlauf wurde eingehalten, die Zeugenvernehmungen, die Vernehmungen der Angeklagten verliefen im wesentlichen gemäß den Regeln. Die Anklagerede des Staatsanwalts und die letzten Verteidigungsreden der Angeklagten, auch das war im Rahmen des Üblichen.
Gedankenschärfe und Geistesgegenwart waren nötig, denn während des Prozesses ergaben sich fortwährend neue Situationen, neue Vermutungen, neue Anklagen, die es zu entkräften galt. Die Offizialverteidiger, die man uns Angeklagten gegeben hatte, waren so alt und so unbeholfen, dass man sich als juristischer Laie selbst wesentlich geschickter verteidigte, als der Verteidiger es vermochte.
Immerhin rann es uns Angeklagten doch kalt den Rücken hinunter, als der Staatsanwalt drei bis fünf Jahre Zuchthaus für die meisten beantragte, für mich selbst fünf.
Das Gericht zog sich zu einer kurzen Beratung zurück, und nach einigen Minuten erschien es wieder. Bei der Urteilsverkündung wurde Publikum zugelassen. Stehend mussten wir sechs Angeklagten unser Urteil anhören. Die Urteile lauteten zwischen zwei und vier Jahren Zuchthaus, ich erhielt drei Jahre. Die Untersuchungshaft wurde uns fast ganz angerechnet.
Wir konnten in die Zellen zurückkehren, die Spannung hatte sich gelöst: Wir waren nicht niedergeschmettert, wir beglückwünschten uns sogar, dass es weniger war, als der Staatsanwalt beantragt hatte. Nun hatten wir bis zum Abtransport in die Strafanstalt nur noch wenige Wochen zu warten.
Als wir dort eintrafen, lasen wir hinter dem großen Tor die Tafel mit der Inschrift:
Wer Freiheit nicht zu schätzen weiß,
muss dieses Haus betreten.
Dort lernet er zu jeder Zeit
Für seine Freiheit beten.
Und als wir in das gelbliche hässliche Drillich der Sträflinge eingekleidet waren, standen wir entrechtet, entehrt von einer Gesellschaft, die wir hassten und die wir nie anerkannten.
Weit davon entfernt, diese neuen Beamten etwa als Vorgesetzte anzuerkennen, verglich ich meine Situation stets mit dem Bibelwort: »So fiel ein Mann unter die Räuber, und sie taten mit ihm, was sie wollten«. So kam ich mir vor, und die kleinlichen, schikanösen Subjekte von Bewachern nötigten mir innerlich keinerlei Respekt ab.
Fast zwei Jahre brachte ich in der Anstalt Zwickau zu. Vierzehn Monate davon war ich in Zellenhaft, teils allein, teils mit ein oder zwei anderen zusammen. Dreckige Arbeit, Wolle zupfen, Lumpen zerreißen, teerige Taue entwirren, Staub, Dreck, Lumpen, das füllte meine Tage aus. Der Lohn betrug vier Pfennige am Tage, nach acht Monaten, wenn man bei guter Führung in die »Mittelstufe« kam, stieg der Lohn auf acht Pfennige. Dafür konnte man ein mal in der Woche einige wenige Kärglichkeiten kaufen.
Mitunter, wenn einem primitiven Menschen in der Zelle der Gesprächsstoff ausging, wurde es eintönig und langweilig. Dann hatte ich das Glück, mit Sprachkundigen zusammenzukommen. Während der Dreckarbeit unterhielt ich mich auf englisch mit einem Deutschamerikaner, lernte von einem Brasilianer portugiesisch. Der war ein guter Lehrer, er unterrichtete nach der Methode der Berlitzschulen, bei der im Unterricht kein deutsches Wort fiel. Ich lernte spielend die Anfangsgründe einer klangvollen Sprache. Freilich, Notizen zu machen war während der Wochen Tagesarbeit streng verboten. So mussten wir das heimlich tun. Kleine, zwei Zentimeter lange Bleistiftstückchen hatten wir in unsere Kleidung eingenäht. Einen kleinen Zettel mit Notizen und Vokabeln verbargen wir unter den Haufen von Lumpen, setzten uns mit dem Rücken gegen die Tür, so dass wir durch den Spion von außen nicht beobachtet werden konnten, und lernten. Stundenlang oft. War der Abend gekommen, durften wir zur Lektüre greifen, die uns dosiert und zensuriert zugemessen wurde. Aber es war ein weiter und demütigender Weg, bis es gelang, Lektüre oder Schreibzeug zu erhalten. Beim Morgenaufschließen mussten wir uns einmal in der Woche zum Oberamtmann vormelden. Schloss der Beamte schnell auf und verschwand sofort, war das Vormelden für diese Woche nicht mehr möglich. Dann geruhte der Oberamtmann, bittende Sträflinge einige Tage später zu empfangen. Wir wurden aufgerufen, mussten an dem eisernen Rundgangstieg eine Etage höher mit dem Gesicht zur Wand stillstehen und, je zwei Meter Abstand haltend, schweigend warten, bis die Reihe an uns kam. Auf ein Klingelzeichen betraten wir den Raum des Oberamtmanns, nannten unsere Nummer und Namen und warteten. Dann brachten wir unsere Bitte vor, die er je nach Sachlage und Laune ablehnte oder annahm. Es musste zum Beispiel um die Erlaubnis gebeten werden, sich ein Schreibheft anzulegen. Dieses dicke Heft wurde uns nur am Wochenende ausgehändigt, um für die Arbeitswoche wieder weggeschlossen zu werden. Da konnten wir hineinschreiben, was wir wollten, Auszüge aus Büchern, Übersetzungen, Noten, Lieder, eigene Ideen und sonst noch allerlei. Das war doch etwas Köstliches, sich etwas notieren zu können, seinen Gedanken Ausdruck geben zu können. Aber in gewissen Abständen wurden diese Hefte vom Oberlehrer der Anstalt kontrolliert, ob sich nicht verbotene Dinge darin befänden, und er malte sein Signum mit Datum stets dazu. Mitunter, wenn er glaubte, etwas Verbotenes oder Anrüchiges gefunden zu haben, ließ er von dem Betreffenden eine Abschrift dieser Stelle machen. Es hieß, das könne üble Folgen, etwa für die Entlassung haben.
An das Stehen und Warten, schweigend und im Zweimeterabstand, hatten wir uns allmählich so gewöhnt, dass wir uns gewundert hätten, wäre es plötzlich anders gewesen. Der Stolz und die Selbstachtung wurden allmählich in uns abgetötet. Wir wurden wie dressierte Hunde, die die Befehle ihrer Herren entgegenzunehmen hatten. Aber das war nur äußerlich. Innerlich war unser Geist wach und rege.
Wir taten mit Vorliebe verbotene Sachen: Wir schauten aus den Fenstern, die hoch oben in den Zellen angebracht waren und zu denen man hinaufklettern musste. Wir flüsterten auf den täglichen Rundgängen miteinander, fertigten uns verbotene Bleistifte und Notizzettel an. Aus Lumpen machten wir Decken, um gegen die Kälte geschützt zu sein. Wenn wir auch äußerlich die Dressierten mimten, so taten wir doch alles, um noch etwas Individualität zu pflegen und den Geist wach zu halten.
Viele, besonders die schwerer belasteten Politischen, steckte man in Einzelhaft. Aber auch sie benutzten die Gelegenheit des täglichen Rundganges oder Exerzierens zu Mitteilungen. Sie waren genau so rege. Sie turnten allein in ihren Zellen, sie lasen und beschäftigten sich, so gut sie konnten. Keiner wurde stumpf, und nur von einem unter den vielen Hunderten war bekannt geworden, dass er während der langen Zellenhaft innerlich zusammenbrach und – um seine Leiden abzukürzen – zum Verräter wurde.
Nach der Zellenhaft folgte die Gemeinschaftshaft. Ein riesiger Schlafsaal, ein großer Arbeitsraum für Hunderte schweigende, nur gelegentlich flüsternde Gestalten, die alle mit der gleichen dreckigen Lumpenarbeit beschäftigt waren. Abends, wenn der verhasste Zwang der Wachtmeister im Schlafsaal aufgehört hatte, begann das Raunen und Wispern, das Erzählen und Berichten. Freundschaften wurden geschlossen, und die kargen Minuten des Sich-selbst-überlassen-Seins, fern dem Zwang, waren wie eine neue Welt.
Eines Abends, es war im Juni 1938, las ich den Kameraden im Schlafsaal leise ein Gedicht vor, das mir angesichts der vielen jungen und älteren politischen Gefangenen gekommen war. Nach einem Ausspruch von Liebknecht, der den politischen Kämpfer so charakterisiert hatte, hieß es:
Tote auf Urlaub
Viel blanke Jungen in einer Reih’,
sind auch paar Ältere mit dabei;
blitzen die Augen und weht weich das Haar,
ernster die anderen, träumerisch gar,
lachen die Lippen und sprüht das Leben,
will einer Zukunft Inhalt geben.
Sahst du sie nicht?
Sahst du die Sonne nicht spielen
auf blondem und dunklem Haar?
Doch als die Blätter fielen,
sahst du sie wieder – zwar
waren’s dieselben und waren’s doch nicht:
wächsern die Lippen und still das Gesicht,
lagen sie Reihe an Reihe, verreckt,
dort auf dem Sand,
kugeldurchbohrt und hingestreckt,
wo man sie fand,
lagen nun stumm in der Blüte des Lebens.
War denn ihr Ringen und Kämpfen vergebens?
Blieb denn nicht mehr als die wilde Anklage
und der Schrei bis ans Ende der Tage
und die zermarternde Pein,
Zeuge von der Vernichtung
soviel blühenden Lebens zu sein? –
Das waren die Toten auf Urlaub.
Die in den Betten Liegenden hörten und nickten und dachten nach und verstanden.
Doch bald wurde die Belegschaft aufgelöst, ein Teil von uns wanderte in die »Hofkolonne«. Da gab es tagsüber die großen Fäkalienfässer zu fahren, deren Inhalt uns oft über die Finger spritzte. Es mussten Kohlen geholt werden – menschliche Gespanne wurden gebildet. Dreck gab es viel, aber wir kamen ein wenig herum, gelegentlich sogar in die Stadt, wo unsere Sträflingskleidung schon kein Aufsehen mehr erregte.
Und wieder wanderte ich in eine andere Belegschaft, wo ich meinen Geist mit dem Sortieren von Schweineborsten zu beschäftigen hatte. Die weißen, die schwarzen und die grauen zu trennen, was war das für eine interessante Arbeit! Ich war froh, wenn ich mit anderen zum Kartoffelschälen und Gemüseputzen gerufen wurde. In der Küche saßen wir freier, konnten ungehinderter miteinander sprechen, ohne die hämischen Blicke der aufsichtführenden Wachtmeister unablässig über unseren Köpfen zu fühlen, hatten etwas mehr zu essen als die knappe Kost der anderen, und wenn auch die Arbeit dreckig war, so kam sie mir doch abwechslungsreicher vor als die frühere. Ich war deshalb ganz froh, als ich die Ehre hatte, zu den ständigen Kartoffelschälern ernannt zu werden. Acht Monate lang habe ich diese Arbeit dann getan und darin eine beträchtliche Fertigkeit erlangt, musste ich doch ein tägliches Mindestpensum von sechs Eimern schälen.
Mitunter fragten mich die Kameraden von der Belegschaft, ob wir wohl Natron oder ein anderes, die Triebe »dämpfendes« Mittel dem Essen beimischten. Denn das sexuelle Verlangen sei bei ihnen ja wie abgestorben. Aber wir wussten, es kam nichts in das Essen hinein. Das Ausbleiben aller sexuellen Gefühle hatte andere Ursachen: die magere Kost, der ungeheure seelische Druck, der auf allen lastete, die klösterliche Abgeschiedenheit, das Fernsein von Frauen, auch von Bildern. Es war ein ganz natürlicher Vorgang.
Gelegentlich mussten wir in den riesigen Kellergewölben Kartoffeln sortieren. Dort waren wir ganz unter uns, keine Aufsicht ließ sich blicken und dort summten wir halblaut unsere Lieder, die alten Lieder, die wir so lange nicht mehr gehört hatten. Ich lernte dort das Lied von Tjor Folesohn – heute heißt es »Unsterbliche Opfer« –, das in den Gewölben wie eine zauberhafte Melodie widerhallte.
Wir waren zu dieser Zeit schon recht gut orientiert. Wir hatten nicht nur Tageszeitungen, wir hörten von Zugängen auch manches, was nicht in den Zeitungen stand. Wir wussten genaues über den Bau des Westwalls, was damals noch geheimgehalten wurde. Wir wussten von Truppenverschiebungen von hier nach dort. Ja, ein Besucher berichtete uns einmal von der Explosion eines deutschen Luftschiffes in Brasilien, was im Nu die Runde machte. Und als ein Wachtmeister der Belegschaft nach einigen Stunden von dem Neuesten erzählen wollte, meinten die Sträflinge: »Ach, das mit dem Zeppelin, das ist ja schon uralt«. Der Wachtmeister war platt.
In den letzten drei Monaten der Strafhaft kam ich in die Gärtnerei, zu einer besonders begehrten Arbeit. Gewiss, sie war nicht immer leicht. Aber sie fand im Freien statt; im Gewächshaus standen herrliche Blumen, lang entbehrte Anblicke!
Man hatte dort viel mehr Freiheit, zu gehen und zu reden. Außerdem war die Belegschaft, zu der die Gärtnerei gehörte, eine besonders berühmte. Waren dort doch ausschließlich Politische. Manche Freunde traf ich wieder, viele Jugendliche mit besonders regem Geist und Sinn. Da waren einige aus einfachem Stand unter ihnen, die Gedichte schrieben, gute sogar, die philosophische Werke lasen: Es war eine politische Elite, die dort dem trostlosen Dasein Trotz zu bieten suchte. Und dies war um so mehr nötig, als einige der dort stationierten Beamten besonders kleinlich waren und alle schikanierten. Für des Beim-Sprechen-Ertapptwerden verhängten sie Strafversetzungen an einen anderen Platz, sie machten pedantische und peinliche Kontrollen der Kleidungsstücke. Alles musste genau nach einem Schema gefaltet und platziert sein, sie verlangten ein zackiges Grüßen, eine stramme Haltung, einen äußerlichen, mehr als preußischen Drill – obwohl sie Sachsen waren.
Kleine Unterbrechungen gab es an dem einen oder anderen Sonntag, eine sogenannte »Singestunde«. In der »Kirche«, einem großen holzgetäfelten Saal, spielten die Orgel oder ein Klavier, und Volkslieder wurden gesungen. Wir sangen alle eifrig mit, die verrosteten, des lauten Sprechens entwöhnten Kehlen tauten auf, der Klang der altgewohnten Lieder entlockte vielen wetterharten Gestalten Tränen. Besonders bei den Kriminellen sah man viele weinen. Wohl mit Absicht wählte der Lehrer, der diese Singestunden leitete, solche sentimentalen Lieder wie »Aus der Jugendzeit« oder »In einem kühlen Grunde«. Es war ein billiges Mittel, Rührung zu erzeugen; anscheinend versprach sich die Anstaltsleitung Besserung davon.
Einige Male hielt der »Oberlehrer« der Anstalt einen Lichtbildervortrag. Seine Themen waren »Eine Rheinreise« oder er berichtete von Reisen durch fremde Länder, wozu er Lichtbilder projizierte und dazu sprach. Seine Vortragsweise war so, wie er es gewohnt war, wenn er zu achtjährigen Buben sprach. Viele Gefangene empörten sich innerlich, diese Salbadereien anhören zu müssen. Aber man zwang uns, und schließlich war es eine Unterbrechung des altgewohnten Trottes.
Ein- bis zweimal im Monat war es uns Gefangenen erlaubt, nach Hause zu schreiben oder Briefe zu empfangen. So eintönig die Haft war, in allen lebte der Wille, mit den Angehörigen in Verbindung zu bleiben. Briefe waren das einzige Fenster, durch das wir in die Freiheit schauen konnten. Viele, die früher draußen nie oder selten schrieben, schrieben jetzt gern. Auch ich, dem Schreiben früher nur eine lästige Angelegenheit gewesen war, hätte jetzt mühelos viele Seiten schreiben können, wenn es erlaubt gewesen wäre. An dem Ausmalen der kleinsten Dinge fand ich eine früher ungeahnte Freude.
Schließlich nahte der Tag, an dem ich aus der Strafhaft entlassen werden sollte. An meinem Kalender, den ich mir in einem Heft selbst gemacht hatte, waren die Tage, die noch nicht durchgestrichen waren, weniger und weniger geworden. Zweifel und bange Ungewissheit drückten sich in unserer Stimmung aus, wie ich sie damals beschrieb:
Schlussworte
Dieser langen Jahre
Qual ist nun vorbei,
wie ein Schatten huschte
der Tage Einerlei;
schleppenden Schritten nahte
das Ende dieser Zeit.
Soll sich jetzt alles wenden,
wirst du jetzt befreit?
War denn nun alles sinnlos
und vergeblich, was du littest?
Ist denn nun alles verfallen
und vergessen, wofür du strittest?
Siehst du denn keine Werte,
die die Bitternis in dir hob?
Merkst du nicht die Wandlung,
die sich in dir vollzog?
Bist du nicht anders geworden
in dieser harten Zeit?
Klingt nicht ein neues Lied in dir
trotz aller Bitterkeit?
Vielleicht musst du dir einmal
die Rechenschaft abgeben:
Möchtest die Zeit nicht missen,
du lerntest hier erst leben.
Die rührende Selbsttröstung, die in diesen Versen enthalten ist, kann man erst nach Jahren ganz und gar ermessen.
Am letzten Tag kam ich in die sogenannte »Abgangszelle«. Ich vertauschte das dünne, hässliche Drillich mit meinen Zivilsachen, und ich wartete. Hoffen und Bangen erfüllten mich. War die Freiheit jetzt wirklich nahe?
Stunden um Stunden vergingen, dann rief man mich zum Oberamtmann. Der eröffnete mir, dass ich auf Grund eines Gestapo-Beschlusses nicht in die Freiheit, sondern auf unbestimmte Zeit in ein Konzentrationslager gebracht würde.
So waren nun die Würfel gefallen. Während die Kriminellen mit ihrer Entlassung ohne Ausnahme nach Hause gingen, schwebte über uns Politischen vom Anfang der Haft an das Damoklesschwert des »Was nachher?« Jahrelang schleppten wir diese Ungewissheit mit uns herum, um schließlich wieder hinter die Stacheldrähte verbannt zu werden. Die Qual der Ungewissheit, der unbestimmten Zeit, die diese Haft im Konzentrationslager dauern würde, erlitten wir reichlich. Kein Wunder, dass die Nerven vieler Kameraden dabei in die Brüche gingen. Ein raffiniertes System, den Menschen bis zum letzten Tag seiner Strafhaft darüber im Unklaren zu lassen, ob er die Freiheit wieder sehen würde oder nicht!
Es folgten weitere sechs Wochen in Schutzhaft und im gleichen Zuchthaus: Ich wartete auf den Abtransport. Wieder zwang man uns zur Arbeit mit dreckigen, stinkigen Lumpen, wieder mussten wir für diese Arbeit das hässliche Drillich anziehen. Es war alles genauso, als ob wir noch immer Sträflinge wären.
Dann kam der Abtransport im engen Zellenwagen. Buchenwald sollte der Bestimmungsort heißen. Wie mochte es dort sein? In unserem Wagen war einer, der ein wenig Bescheid wusste. Er zeigte nur seine schwieligen, aufgerissenen Hände. »Mehr will ich euch nicht sagen.« In Halle machten wir Zwischenstation und wurden im dortigen Gefängnis zu dreißig in eine enge Zelle gepfercht, die vielleicht für vier bis fünf Menschen Platz geboten hätte. Es war heiß und stickig. Ein paar Kriminelle erzählten ihre lauten Geschichten von Heiratsschwindeleien und dergleichen. Täglich der monotone, schweigende Rundgang in winzigem Hof, eine halbe Stunde lang.