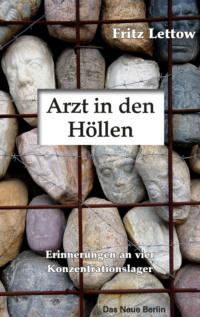Kitabı oku: «Arzt in den Höllen», sayfa 4
Weitertransport, diesmal bis Weimar. Dort holte ein großes Polizeiaufgebot uns Gefangene vom Bahnhof ab. Unsere Gruppe war inzwischen bis auf fünfzig Mann angewachsen, alle sollten nach Buchenwald. Wir wurden auf Wagen verladen.
»Bei Fluchtversuch wird jeder erschossen«, rief uns ein Polizist zu.
Es war August 1938.
Buchenwald
Niedrige Gebäude, vor dem Lager eine gut asphaltierte Straße. Viele bunte Blumenbeete vor den Baracken, seltsamer Kontrast zwischen der schreienden SS und den blühenden Blumen! Wir müssen in der Baracke der politischen Abteilung auf dem Korridor in zwei Gliedern antreten, mit dem Gesicht zur Wand, schweigend. Wehe, wenn einer sich muckst! SS-Männer gehen vorbei und sparen nicht mit Ohrfeigen. Personenaufnahme, barsch, von Schimpfworten begleitet. Dann durch ein großes Tor ins Lager.
Am Torgitter stehen die Worte: »Jedem das Seine«.
Innerhalb des Lagers müssen wir fünfzig »Neuen« stehenbleiben. Mit dem Gesicht zum Tor. Wir sehen nicht, was hinter uns vorgeht. Dann schleppt man an unserer Seite ein Holzgestell herbei (später erfuhren wir, dass es der berüchtigte »Bock« war), schnallt dort einen Menschen auf und peitscht ihn aus. Fünfundzwanzig Hiebe zählen wir. Und dann peitscht man den nächsten aus und den dritten. Das wimmernde Geschrei hallt über den Platz, und ein Schauer durchfährt uns. Das ist also die Begrüßung in Buchenwald!
Später erfahren wir, dass man die Auspeitschungen absichtlich an den Tagen vornimmt, an denen »Zugänge« ins Lager kommen, um ihnen gleich den richtigen Eindruck zu vermitteln.
Dann zum Bad. Ein großer Raum mit vielen Duschen. Danach werden wir geschoren. Radikal. Jedes Härchen wird entfernt. Wir müssen unsere Zivilsachen abgeben und empfangen hässliches, blauweiß gestreiftes Zebra-Drillich. Wir erkennen uns gegenseitig nicht mehr wieder. Wie Harlekine sehen wir jetzt aus, in der Zebrakluft und mit unseren geschorenen Köpfen. Aber da es uns alle betrifft, machen wir uns nicht groß Gedanken darüber. Wir empfangen einen kleinen Stoffstreifen, auf dem unsere Nummer gedruckt steht, und ein Stoffdreieck, den sogenannten »Winkel«. Jede Kategorie von Häftlingen hat einen anderen Winkel: rot die Politischen, schwarz die Asozialen, grün die Kriminellen, lila die Bibelforscher, rosa die Homosexuellen usw. Es gibt einen richtigen Kodex, den man lernen musste, um sich zwischen all den Farben, Punkten, Streifen und Sternen zurechtzufinden, die jeder von uns auf der linken Brustseite und rechts am Hosenbein noch einmal tragen muss.
Wir werden in den sogenannten »Zugangsblock« gebracht. Eine Baracke, rechts und links je ein Schlafraum mit dreistöckigen Eisenbetten und ein Tagesraum mit Bänken und Tischen. In der Mitte Waschraum und Abort. Uns Politische setzt man an besondere Tische, auch die Asozialen für sich. Wir halten gute Kameradschaft, hören, dass man des Abends, nach dem »Abpfeifen« die Baracken nicht mehr verlassen darf, sonst wird man erschossen. Das ist zwar nicht wahr, aber Neulinge kann man doch damit schrecken. Wir durchlaufen die verschiedenen Instanzen. Wir werden fotografiert, registriert, untersucht, noch einmal registriert und befragt. Und wir haben die ersten Eindrücke vom KZ.
Eines Abends hat ein »Schwarzer«, ein Asozialer, ein Messer entwendet und will es dem Blockältesten auf dessen Geheiß nicht gleich geben. Da packt dieser einen Knüppel und schlägt wie ein Rasender auf den »Schwarzen« ein, der blutüberströmt zu Boden sinkt. Keuchend lässt der Blockälteste von seinem Opfer ab. »Und so geht es allen, die hier nicht Disziplin halten!« schreit er. Wir sind starr vor Schreck. So geht es hier zu. Faustrecht. Der Knüppel regiert.
Das Wasser ist knapp, zeitweise wird es abgestellt. Handtücher gibt es in den ersten Wochen nicht. Dreißig Mann trocknen sich gemeinsam an einem Laken ab. Aber in den Bassins im Waschraum ist viel Wasser. Ich hole mir – was verboten ist – eine Tasse voll heraus. Hinter mir hat das ein Stubenältester gesehen, ein großer, grober Krimineller. Und schon habe ich zwei klatschende Ohrfeigen erwischt, und der Hüne zieht ab. Wir merken: Wer hier eine Funktion hat, kann die anderen niederknüppeln, kann sie schlagen. Und zwar Häftlinge die Häftlinge, die SS hält sich heraus. Wir sehen die groteskesten Bilder im Lager. Sogenannte »Kapos« – eine Art Vorarbeiter – schlagen auf die Häftlinge ein, die ihre Arbeit nicht bewältigen können, manchmal vielleicht auch nicht recht wollen.
Aber es gibt ja schließlich niemals einen Pfennig Bezahlung. Hatte man im Zuchthaus noch vier bis acht Pfennige am Tage bekommen, hier erhält man überhaupt nichts. Darum also die Antreiberei! Blutende Köpfe, schmerzende Rücken sind besonders in manchen schlechten »Kommandos« an der Tagesordnung. Ja, in dem berüchtigten Steinbruch haust ein Kapo, dem es Vergnügen bereitet, die Leute mit Schlägen über die Postenkette zu jagen oder sie so zu prügeln, dass sie freiwillig über die Postenkette gehen und dann erschossen werden.
Die Kapos sind zumeist Kriminelle, vielfach vorbestrafte, üble Elemente, denen die SS, da sie brutal genug waren, die Rollen von Vorarbeitern gegeben hat – und dazu asoziale Elemente, die froh sind, andere für sich arbeiten lassen zu können. Auch Politische sind unter den schlechten Kapos, frühere Fremdenlegionäre, die die ganze Wildheit und Erbarmungslosigkeit einer exotischen Gegend mitgebracht haben, Abenteurer, Leute, die von der SS den politischen Winkel bekamen und den Ruf wirklicher Kämpfer diskreditieren.
So sehen wir Neuen im Lager sehr bald den Kampf zwischen den verschiedenen Farben, den Machtkampf, besonders zwischen Grün und Rot. In ihrer Brutalität sind die Grünen, die »BVer« (Berufsverbrecher), den Roten überlegen; Intelligenz, Zusammenhalt und moralische Qualität sind die Vorteile der Roten. Und es ist gut, dass wir Politischen unter den Neuen schnell Anschluss an die alten Politischen finden. So wird uns in vielen Dingen geholfen, wir werden beraten, insbesondere bei der Wahl oder Einteilung in die Arbeitskommandos.
Diese Zuordnung geschieht wenige Tage nach unserer Ankunft. Der Lagerführer, SS-Obersturmbannführer Rödl, ein dicker, breiter Bayer, teilt uns zur Arbeit ein. Gleich welchen Beruf man angibt, sei es Bäcker, Fleischer, Kaufmann, Intellektueller, man kommt zumeist in den Steinbruch oder in ein Schachtkommando. Andere Handwerker verrichten allerdings mitunter auch ihre Facharbeit. Da ich als Werkstudent an mehreren Häusern mitgebaut hatte und mich jetzt als Bauarbeiter ausgeben kann, werde ich dem Baukommando für eine neue Ziegelei zugeteilt.
Jeden Morgen um dreiviertel vier stehen wir nun auf. Um fünf Uhr rücken wir zum Appell, eifrig Gleichschritt haltend. Dann steht der ganze Haufen von ungefähr zweihundert Zugängen, dann steht das ganze Lager, damals an die sechstausend Mann, bis sie alle gezählt sind und der Befehl gegeben wird: »Arbeitskommandos antreten«. Und im Nu sind die in schnurgeraden Kolonnen ausgerichteten Häftlinge eine einzige durcheinanderquirlende und sich drängende Masse. Jeder versucht, den Standplatz für sein Arbeitskommando zu erreichen. Nach kurzer Zeit stehen die Kommandos, und der Abmarsch beginnt. Vor dem Tor steht ein glasverdecktes Pult, an dem der Arbeitsdienstführer seinen Posten bezogen hat. Jeder Anführer eines Kommandos, der Kapo, meldet die Stärke seiner Häftlingsgruppe, und in ausgerichteten Fünferkolonnen geht der Marsch durch das Tor. Dröhnend hallen jeden Morgen die Torwände vom Tritt dieser Tausende, und wer etwa am Tor steht und diesen Vorbeimarsch am Morgen miterlebt, dem bietet sich ein unvergessliches Bild dieser zusammengepressten, in Uniformität und Drill gezwungenen und doch mit stolzer Kraft herausmarschierenden Kolonnen.
Was ich damals empfand, habe ich niedergeschrieben:
Die Kolonne
Wir haben dem Grauen ins Auge gesehn
und das Entsetzen erblickt;
mag nun das Leben weitergehen,
mag die Welt sich immer weiterdrehn,
wir sind dem weit entrückt.
Wir leben in einer andern Welt,
die ihr nie und nimmer versteht.
Und wenn von uns auch mancher fällt,
und wenn auch manch ein Aufschrei gellt,
Voran der Marschtritt geht.
Weiß die Kolonne, wie lang der Weg?
Endlos die Straße weit;
Marschieren ohne Pfad und Steg,
marschieren ohne Pfad und Steg,
durch die ausweglose Zeit.
Die Kolonne geht, sie wird nicht müd,
der Schritte Takt schallt laut;
durch Tag und Nacht sie weiter zieht,
bis die Dunkelheit nach Westen flieht
und der Morgen wieder graut.
Manchmal fühlte sich einer zu schwach oder krank, an diesem Tag zur Arbeit hinauszumarschieren. War er aber erst einmal in seinem Kommando angetreten, so riss ihn der Strom der Hinausmarschierenden unaufhaltsam mit.
Für manche Arbeitsunfähige gab es dann nur ein Mittel: Sie ließen sich vor dem Tor hinfallen und wurden auf Befehl des Lagerführers ins Revier geschafft. In dem Jahr zuvor, so wurde uns Neuen erzählt, war es oft nicht so glatt abgegangen. Da war ein Lagerführer namens Weißenborn gewesen, der hatte morgens die Krankmeldungen entgegengenommen und die Kranken mit Ohrfeigen und Stößen zur Arbeit getrieben. Nur die Halbtoten waren damals ins Revier geschafft worden.
Den anderthalbstündigen Marsch vorbei an wogenden Kornfeldern hin zur Baustelle der Ziegelei empfand ich nach der ewigen Eintönigkeit des Lagers als schön. Freilich war die Arbeit schwer und der Hunger groß. In wilder, heißhungriger Gier hatten wir morgens um sieben schon das kleine Stück Brot, unsere Zuteilung, aufgegessen und arbeiteten nun mit knurrendem Magen weiter.
Manchmal schikanierten uns die Posten. Sie riefen einen schwer mit Ziegeln beladenen Häftling wohl ein Dutzend Mal zu sich hin und ließen ihn wieder gehen, bis ein Baupolier, der Zivilist war, den ob dieser Niedertracht Weinenden sah und dem Posten das verbot. Waren wir am Nachmittag müde und hungrig von der Arbeit eingerückt, so hieß es, schwere, zirka fünfzehn Meter lange Bäume ins Lager zu schleppen, immer zwei oder drei Mann einen Baum. Schwitzend und unter unserer Last keuchend langten wir dann im Lager an, gerade zur Zeit des Abendappells.
Das war der kritische Moment. Ging alles glatt, so war der Appell in einer guten halben Stunde abgenommen, und alles konnte zum Essen in die Blocks gehen. Aber wehe, wenn auch nur ein Mann fehlte, sei es durch einen Rechenfehler beim Zählen, sei es, dass er von der Arbeit ermüdet, irgendwo eingeschlafen war und das Zum-Lager-Gehen verpasst hatte. Dann wurden Suchkolonnen ausgeschickt.
»Stubendienst in den Wald, den Vogel suchen«, hieß das Kommando, und oft wurde im Wald oder in den Blocks ein Vergessener entdeckt. Manchmal mussten die weit abliegenden Arbeitsstellen durchgekämmt werden. Stundenlang dauerten dann die Appelle, und wehe, wenn wirklich einer einen Fluchtversuch gemacht hatte und sich deshalb irgendwo an seiner Arbeitsstelle versteckt hatte. Man konnte dann damit rechnen, acht Stunden zu stehen. Und es war gleich, welches Wetter herrschte, das ganze Lager stand bei glühender Sonne, im Regen, bei Kälte und bei Schneegestöber.
Diese Appelle forderten viele Opfer. In der Hitze und vor Kälte sanken viele um. Bei manchen Appellen waren es Hunderte, die stürzten. Und viele standen nie wieder auf. Ausgemergelt und schwach, wie ein großer Teil der Häftlinge war, konnten sie stehend die Wetterunbilden so viele Stunden lang nicht ertragen. Wohl nahm das Revier sich ihrer an. An manchen solcher Tage schleppten die Revierträger viele Dutzende auf Tragen in irgend eine Baracke, wo sie auf die Erde gelegt und mit Wasser und einigen Medikamenten versorgt wurden. Doch bei vielen war das umsonst. Wenn die Reserven des Körpers erschöpft waren, halfen alle Medikamente nicht mehr.
Beim Abendappell wurde auch die Post verteilt. Zweimal im Monat durften wir Häftlinge Post aus dem Inland empfangen, zweimal im Monat durften wir einen Fünfzehn-Zeilen-Brief schreiben. Natürlich wurde peinlich zensiert. Konnte der Zensor, häufig ein blutjunger, ganz ungebildeter SS-Scharführer, die Schrift nicht gut lesen, so hagelte es Ohrfeigen.
Abends beim Appell mussten die Leute auf seinen Ruf hin aus dem Glied vortreten, und er verabreichte ihnen die Backpfeifen. Auch ältere Leute wurden davon nicht verschont. Auch mich erwischte es einmal. Ich musste vortreten. Er fragte nach meinem Beruf. Ich hütete mich, einen studierten Beruf anzugeben, denn ich wusste, auf Studierte hatte die SS ihre besondere Wut. So sagte ich »Angestellter«, was ja den Tatsachen einigermaßen entsprach. Schon hatte ich meine Ohrfeige weg und durfte ins Glied zurücktreten. Nun musste ich meine Briefe immer sehr sorgfältig malen, damit mir so etwas nicht wieder passierte. War der SS-Scharführer schlecht gelaunt, so zerriss er die Briefe immer wieder, so dass es den Häftlingen oft wochenlang unmöglich war, Post nach Hause abzusenden.
Ich hatte mich nun im Lager akklimatisiert, ich kannte das Gelände. Hinter den drei Holzbaracken war eine Reihe doppelstöckiger, steinerner Baracken im Bau, und hinter denen begann der Buchenwald, von dem das Lager seinen Namen hatte. Das war eine riesige Fläche, vielleicht einen Quadratkilometer groß, mit herrlichen alten Bäumen bestanden. Nach der Enge der Gefängnis- und Zuchthausmauern war es ein Labsal, Sträucher, Bäume, Wald zu sehen. Sowohl im Sommer als auch im Winter sah man nach der Arbeitszeit dort immer einige, die die Natur liebten, die sich sonnten oder durch den Schnee stapften.
An der einen Seite des Waldes standen die zwei Revierbaracken, dahinter war ein großer Schweinestall, in dem die SS ihre Schweine mästete. Dazu brauchten sie ein großes Kommando von Häftlingen, die zwar eine sehr dreckige Arbeit hatten, aber etwas vom Schweinefraß fiel immer für sie ab. So war das Kommando sehr begehrt und für manchen ausgehungerten Kumpel eine Zufluchtsstätte.
In eintönigem Trott verstrichen die Tage. Sommer um Sommer, Winter um Winter, jahrelang. Im April wurde die dünne Sommerkleidung gefasst, Drillichzebrastoff, und im Oktober der dickere Winterzebrastoff. Oft gab es auch ausrangierte alte blaue oder grüne Polizeijacken, geflickt, oft zerrissen. Die musste jeder sich herrichten, so gut er konnte, musste Nummer und Winkel annähen. Und in jedem Frühjahr wieder der Kleiderwechsel und in jedem Herbst. Im stillen hofften wir, dass es diesmal das letzte Mal sein sollte. Aber immer und immer wieder kamen die ewigen Zebrasachen.
Wohl waren ab und zu einige aus der Haft entlassen worden. Sie wurden morgens beim Appell durch die großen Lautsprecher aufgerufen. Meist waren es Asoziale, selten ein Politischer, und dann auch meist nur ein kleiner Meckerer. Von den alten Politischen kam kaum einer nach Haus. Nur einmal, das war 1939, am 18., 19. und 20. April, setzten größere Entlassungen ein.
An den ersten beiden Tagen kamen je vierhundert Politische und nachher auch noch einige zur Entlassung. Damals schwamm das ganze Lager in einem Meer von Parolen. Alles glaubte, nun würden auch sie bald drankommen, ja man sprach von der Auflösung aller Lager, von der Freilassung aller Politischen. Und als dann die Entlassungen plötzlich wieder stoppten, verstummte das Geraune nach und nach.
Überhaupt war das Lager oft mit Parolen angefüllt. Genau wie schon die Kriminellen im Gefängnis dauernd von einer Amnestie gefaselt hatten, die kommen sollte oder schon in Vorbereitung oder gar fertig sei, so wurden über das Schicksal der verschiedenen Häftlingskategorien zu allen Zeiten die merkwürdigsten Gerüchte verbreitet. Bald sollten die Politischen woanders hinkommen, bald die Asozialen, bald sollten alle Kriminellen wegkommen. Und immer neue Orte tauchten auf, wohin die Häftlinge angeblich versetzt werden sollten. So gut wie nie war an diesen Parolen etwas Wahres dran, und nur die Neulinge glaubten an sie. Die Alten warteten ab. Sie ließen die Dinge an sich herankommen und winkten verächtlich mit der Hand ab.
Der Tischälteste in dem Steinblock, in den ich nach einigen Wochen übersiedelte, hieß Rudi Renner, Lithographenarbeiter seines Zeichens und früherer Redakteur einer sächsischen Zeitung. Er war in den Fünfzigern. Jetzt arbeitete er in der Buchbinderei, in der allerhand Bücher gebunden und Kleinigkeiten gedruckt wurden. Da waren Glückwunschkarten für die SS, die die Zeichner zeichnen mussten, da waren Stammbäume für die SS anzufertigen und zu drucken, Einladungskarten zu den Kameradschaftsabenden der SS und ähnliches.
Rudi war stets eifrig bei der Arbeit. Aber nur seine Hände mussten für die SS fronen, sein Geist war bei seinen Kameraden. Oft fragten wir einander: »Nun, was gibt es Neues?« Und ich kam mit ein paar Neuigkeiten und Parolen heraus. Rudi hörte mich schweigend an und sagte zum Schluss, er habe diese oder jene Parole auch gehört. »Sie kann aber nicht wahr sein, man hat vor einem Jahr schon dasselbe erzählt.« Und er analysierte die Parolen und die Neuigkeiten. Dabei war er vorsichtig. Er sagte nicht, so muss es werden, sondern er sagte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die so und so und so sind. Er lehrte mich, die Dinge von den verschiedensten Gesichtspunkten her zu sehen und vorsichtig zu sein mit dem Urteil. Die Gespräche mit ihm waren wie die eines Philosophen mit seinem Schüler. Sein Gedächtnis war ausgezeichnet. Nur liebte er es nicht, im KZ vor vielen zu sprechen. Eigene Krankheit und schlimme Erlebnisse während der Gefangenschaft hatten ihn vorsichtig und scheu gemacht. Aber im persönlichen Gespräch verfügte er über eine beißende Schärfe und eine unbestechliche Gedankenklarheit. Wie hätte ich gewünscht, dass Rudi den Tag der Befreiung miterlebte!
Da gab es noch andere, früher bedeutende Linkspolitiker im Lager. Sie waren nicht gebrochen, nicht zermürbt oder entmutigt. Die kleinen Dinge des Alltags, die im KZ-Leben so wichtig waren, nahmen sie genauso ernst wie die großen Angelegenheiten der Politik. Freilich war es streng verboten und deshalb gefährlich, im Lager irgendwelchen organisierten Zusammenhang zu pflegen. Also taten sie es heimlich. Täglich trafen sie einander zu einer bestimmten Zeit und sprachen über Wichtiges. Renner war immer dabei. Es galt, Kameraden in bessere Kommandos zu vermitteln, es waren Informationen über bestimmte Leute einzuziehen, man musste über die Neuangekommenen informiert sein und die mussten unter Umständen unterstützt werden. Ein regelrechter Dienst für die Zugänge war eingerichtet worden. So lag ein Netz scheinbar persönlicher Bekanntschaften, in Wirklichkeit aber organisierter und gepflegter Beziehungen über dem Lager. Man musste allerdings schon lange Zeit im Lager sein, ehe man darüber Genaueres wusste. Das war die Stärke der Roten den Grünen, den Kriminellen, gegenüber, die solche Dinge nicht kannten.
So geschah es, dass die Roten das anfängliche Übergewicht der Grünen langsam, aber sicher beseitigten. Waren doch am Anfang auf den meisten und wichtigsten Posten in Lager Grüne gewesen.
Einer ihrer übelsten Vertreter war Richter. Ein ehemaliger SA-Hauptsturmführer aus Braunschweig, später wegen krimineller Verfehlungen ins KZ gekommen. Dort war er Lagerältester geworden, eine Funktion mit damals unerhörter Gewalt. Es machte ihm gar nichts aus, Dutzende totzuschlagen. Er organisierte für sich selbst, was er nur konnte, sogar den im Lager streng verbotenen Alkohol. Er lebte für damalige Begriffe in Saus und Braus, hielt sich einen Kalfaktor, der ihn bediente, ließ sich in den Schneiderwerkstätten elegante Maßkleidung anfertigen, ein Kostüm, eine Art Räuberzivil aus schwarzen Breeches-Hosen und einer dunkelgrünen Jacke, seine hohen Offiziersstiefel waren stets elegant gewienert. Dieser Teufel schrie, dass man seine heisere Stimme über den weiten Appellplatz hören konnte. Besonders gegen ihn richteten sich die Angriffe der Roten.
Andere Kriminelle hatten sich im Revier eingenistet, begehrte Posten, denn das Revier brauchte den Appell nicht mitzumachen; sie hatten dort neben der üblichen Kost auch Diätessen und mancherlei kleine und große Annehmlichkeiten. In der Diätküche saßen einige Kriminelle und trieben nebenbei einen schwunghaften Handel mit Uhren, Ringen, Goldsachen, die sie irgendwelchen Zugängen abgegaunert hatten. Allerdings gab es im Revier auch einige wenige Kriminelle, die gute Kameraden waren. Fleißig, sogar sehr fleißig bei der Arbeit, hatten sie sich die Achtung der Roten errungen. Sie waren von den Angriffen natürlich ausgenommen. Da war der emsige Henrich in der Ambulanz, der den ganzen Tag vom frühen Morgen bis tief in die Nacht am Putzen und Säubern war. Er war unentbehrlich. Kein Politischer hätte das je so sauber und akkurat gemacht. Für diese grobe Arbeit eigneten sich die Politischen zumeist nicht. Ihr Geist war zu rege, als dass sie in solcher Arbeit hätten Befriedigung finden können. Darum hat Henrich auch alle Stürme gegen die Grünen überstanden.
Viele Juden gab es im Lager, anfangs vorwiegend Deutsche, dann auch aus anderen Nationen. Ihnen ging es im Lager schlechter als den übrigen. Schon bei der Ankunft wurden sie besonders heftig geschlagen, bekamen die schlechtesten Lumpen anzuziehen. Sie durften in kein gutes Kommando, also in keine Kammer, nicht in die Schreibstuben, nicht ins Revier. Sie mussten automatisch in den Steinbruch, in die Schachtkommandos. Jahrelang schufteten sie dort, ausgemergelt, verbissen, oft verzweifelt. Sie waren die Prügelknaben der SS und auch mancher wilder Kapos. Waren sie alt und schwach, so bekamen manche im »Holzhof« etwas leichtere Arbeit; mitunter hatte einer oder der andere von ihnen dort sogar das Glück, in einer der kleine Buden im Trockenen sitzen zu können. Das war dann aber ein besonders Beneidenswerter. Viele von ihnen waren Intellektuelle, Künstler, Ärzte, Juristen. Einige sah man mit kleinen Eimerchen altes Papier einsammeln oder Steine wegtransportieren.
Dann gab es die berühmte Kolonne »4711«. Sie musste mit Eimern die Kloaken entleeren. Mit ihren Eimern oder einem Kübelwagen zogen sie langsamen Schrittes von Abort zu Abort und taten dort ihre dreckige Arbeit. Später wurden sie sogar mit Extra-Arbeitsanzügen ausgerüstet. Sie hatten eine ruhige Arbeit, sie wurden nicht getrieben, nicht geschlagen. Es waren viele intelligente Köpfe bei dieser »Scheißkolonne«: Kaufleute, Gelehrte, Künstler. Tagaus, tagein, jahrelang sah man sie so ziehen.
Ein begehrtes Kommando waren die drei Rollwagen. Fünfzehn bis zwanzig Menschen waren davor gespannt, und dieses menschliche Fuhrwerk zog den oft schwer beladenen Wagen überall hin. Dabei wurden sie im allgemeinen in Ruhe gelassen. Sie regelten ihr Arbeitstempo selbst, es gab keine Schläge. Darum war es für die Juden ein ungewöhnliches Glück oder die Folge besonderer Protektion, dem Rollwagen zugeteilt zu werden.
Im Herbst 1938 kamen aus dem Lager Dachau zweitausend Wiener Juden an. Sie waren etwas anders als die deutschen Glaubensgenossen. Sie hatten ihre Wiener Liebenswürdigkeit noch nicht ganz verloren. Sie sagten stets »Bitte schön«, wenn sie etwas fragten, und es wurde im Lager zum geflügelten Wort: »Bitteschön, Herr Kapo, ein leichtes Tragerl!« das heißt eine nicht so schwere Trage zum Erde- oder Steineschleppen, die immer zwei fassen mussten. Erstaunlicherweise sah ungefähr die Hälfte von ihnen absolut nicht jüdisch aus.
Wochen und Monate hörte man diese Juden nur von Dachau schwärmen. Alles war dort besser gewesen, sie lobten die dortige Kantine und den guten Kaffee, sie priesen die bessere Arbeit. Kurz, sie sahen alles, wie es dort gewesen war, in einem rosigeren Licht. Und sie hatten recht. Denn sie waren in ganz leidlichem Zustand in Buchenwald angekommen und in wenigen Wochen zu Skeletten abgemagert. Dazu bekamen sie Sonnenbrand im Gesicht, an Nase und Ohren, denn sie hatten keine Kopfbedeckung. Einige von den ausgemergelten Gestalten sah man mit von der Sonne riesig aufgedunsenem Kopf einhergehen, die Lider waren so geschwollen, dass sie die Augen völlig verdeckten, und die Leute wie Blinde umhertappten. Andere wieder hatten die Sonnenbrandwunden an den Ohren, das war so häufig und den Leuten nicht recht erklärlich, dass sich die mannigfachsten Gerüchte über diese »Ohrenkrätze« im Lager verbreiteten. Einige wollten wissen, dass das aus den Decken käme, andere vermuteten eine geheimnisvolle Infektionskrankheit. Auf das Nächstliegende kamen sie zuerst nicht.
Aber so geplagt sie auch waren, die Wiener Juden hatten den meisten anderen Häftlingen etwas voraus: Sie besaßen Geld. Das wurde ihnen freilich nicht ausgezahlt, aber sie verfügten über große Konten und durften monatlich dreißig Mark davon abheben. Und da viele Kapos ohne Geld waren, schmierten diese Juden sie fleißig. Sie schmierten sie, um nicht geschlagen zu werden, sie schmierten sie, um leichtere, bessere Arbeit zu bekommen, sie schmierten mit Geld, sie schmierten mit Zigaretten. Die meisten Kapos waren bestechlich. Ja, es gab Kapos, die entwickelten geradezu eine Virtuosität, solche Gelder in Empfang zu nehmen.
Da war einer, der hing während der Arbeit seine Jacke an einen Baum und rief zu seiner Kolonne: »Dass mir aber keiner wagt, hier etwa Geld hineinzustecken!« Und ging dann weg. Natürlich hatte er, als er wiederkam, reichlich Fünfmarkstücke in den Jackentaschen. Er war zufrieden und ging gut mit den Leuten um. Sie wussten, hätten sie kein Geld hineingetan, so hätte er mit ihnen wegen der Arbeit geschrien, getobt und sie vielleicht auch geschlagen.
Einige Kapos, und das war schon die bessere Sorte, machten es ganz geschickt: War die Kolonne für sich allein, so waren sie ruhig und anständig; war aber ein SS-Mann oder gar ein SS-Offizier in der Nähe, so fingen sie an zu schreien, zu schimpfen, anzutreiben, allerdings nur solange, bis der SS-Mann weggegangen war. So fielen sie nie auf, kein SS-Mann konnte sie wegen Faulheit aufschreiben oder bestrafen.
Natürlich mussten sie an den Ecken ihrer Arbeitsstellen Lauschposten aufstellen, und es gab Häftlinge, die lange, lange Monate nichts weiter taten, als solche Postendienste zu verrichten.
Unten am Waldrand war ein Kommando, in das Ältere, Schwächere, vornehmlich Juden, kamen: die Steineklopfer. Hinter dem Revier hatten sie ihren Bereich, saßen auf zusammengeschichteten Ziegelsteinen und klopften mit einem Hammer die großen Steine entzwei. Vor jedem lagen die Haufen. Schutzbrillen gab es natürlich nicht, und wenn einem einmal ein Steinsplitter ins Auge drang, so musste er ihn eben im Revier entfernen lassen.
War nasses Wetter, so war das Sitzen auf den Steinen eine schlechte Sache. Mit Holzwänden und ein wenig Dachpappe suchten sich die Steineklopfer zu schützen. Nach und nach hatten sie so einen großen Schuppen erbaut, in dem sie arbeiteten. In der Mitte des Raumes hatte der Kapo, der ein Grüner – ein Krimineller – war, ein Feuerchen gemacht, und die dort Sitzenden konnten sich wärmen. Aber der Kapo ließ sich gut bezahlen. Wer direkt am Feuerchen sitzen wollte, zahlte drei Mark pro Woche, die weiter hinten Sitzenden eine Mark, je nach Lage des Platzes. Und da auch andere Kriminelle herausgefunden hatten, dass diese Juden dort reichlich mit Geld versehen waren, so kamen sie und boten an, was sie in der damaligen Friedenszeit organisiert hatten: Belegte Semmeln, Kaffee, ein Ei, und sie ließen es sich reichlich bezahlen.
Die Wiener Juden waren zum Teil streng rituell, und während der Arbeit fingen sie mitunter zu singen an, ihre Synagogengesänge tönten durch den Raum.
Anders waren die jüdischen Steineträger. Kopfgroße und noch größere Steine nahmen sie auf die Achsel und zogen damit durch das Lager, von einem Bauplatz zum anderen. Es waren meist ältere Leute, unter ihnen viele Ärzte und Intellektuelle. Sie hatten Ruhe bei der Arbeit. Mitunter konnten sie unbeladen ziehen, sie konnten lange Ruhepausen machen, man trieb sie nicht. Wind und Wetter freilich und der Hunger machten ihre Gestalten ausgemergelt, hager, zerknittert, aber in ihren geistvollen Gesprächen waren sie manchmal noch die alten. Öfter freilich war ihr Gemüt verdüstert und verbittert, Zank und Streit über geringste Kleinigkeiten brach aus. »Geh doch schon geradeaus, du Narr! – du bist ja selber der Trottel!« So hörte man sie einander oft zurufen. Sie waren, wie alle diese Kolonnen, die Parias im Lager.
Die Juden, die in den Außenkommandos arbeiteten, hatten nichts zu lachen. Sie bekamen die schwerste Arbeit zugeteilt. Schippen, Graben, Steinebrechen, dazu Beschimpfungen und Prügel.
Eine Kolonne von dreißig Mann hatte Arbeit an einem Wasserloch. Ihr Aufsichtsführer war der berüchtigte SS-Scharführer Abraham, ein großer, blonder Hüne, der Prototyp eines »Germanen«. Er war an diesem Tage besonders schlecht aufgelegt, und als ihm einer der Juden, der am Wasserloch arbeitete, nicht gefiel, trat er ihn kurzerhand mit dem Stiefel, so dass er in das Wasserloch fiel. Triefend kam er wieder heraus. Abraham trat ihn ein zweites Mal, so dass er wieder in das Wasserloch hineinfiel. Wieder kroch er heraus, und wieder trat ihn Abraham hinein, ein halbdutzend mal wohl so, bis der Jude vor Erschöpfung im Wasser versackte und ertrank.
Entsetzt hatten die übrigen neunundzwanzig diesem Schauspiel zugeschaut. Abraham schrieb nun die Nummern dieser neunundzwanzig Häftlinge in sein Notizbuch. Sie rückten abends zur Arbeit ein. Am folgenden Tage wurde einer von ihnen morgens zum Tor hinaufgerufen. Er wurde in den Bunker gesperrt, aus dem er nie wieder zum Vorschein kam. An den folgenden Tagen wurden wieder einige von diesen Neunundzwanzig in den Bunker gebracht. Angstvoll warteten die anderen, bis sie an die Reihe kämen. Und wirklich, in Abständen von drei bis vier Tagen, manchmal auch mehr, wurden sie alle zum Tor befohlen, alle neunundzwanzig verschwanden im Bunker und wurden dort umgebracht.
Der Bunker hatte seinen besonderen Ruf. Dort amtierte der SS-Scharführer Sommer. Alle, die im Lager geringe oder schwerere »Delikte« begangen hatten, kamen da hinein.
Einer der aufsehenerregendsten Fälle, von denen ich erfuhr, war der des Pfarrers Schneider. Er war ein Mann, der den Hitlergruß verweigert hatte und auch sonst diese neue Gewalt nicht anerkannte. Man hatte ihn zunächst ins Lager gebracht. Bei einem Appell und dem Kommandoruf »Mützen ab«, bei dem das Rauschen der zehntausend abgezogenen Mützen über den weiten Appellplatz klang wie das Schwirren eines riesigen aufsteigenden Vogelschwarms, hatte er als einziger nicht mitgemacht. Er verweigerte das Hutabnehmen vor dieser weltlichen Obrigkeit. Klar, dass er in den Augen der Häftlinge als Phantast galt. Denn nur ein solcher konnte sich derart gegen die reale Macht sträuben. Natürlich bekam er zunächst die üblichen »fünfundzwanzig« auf dem Bock. Die Füße standen dabei in einem schiebbaren Holzkasten, damit sie sich nicht rühren konnten, die Schenkel wurden angeschnallt, zwei Scharführer hielten den gekrümmten Oberkörper, und zwei schlugen mit den langen Peitschen auf den Unglücklichen, erst der eine SS-Mann, später der andere. Pfarrer Schneider kam in den Bunker, wo Sommer sein übliches Spiel mit ihm trieb. Er hing ihn an seinen auf den Rücken gedrehten Händen auf. Haken waren ja an der Wand. Dann begann er ihn zu treten und zu schaukeln. Später musste Pfarrer Schneider gefesselt stehen. Er stand tagelang, nächtelang. Seine Beine schwollen unförmig an, rot unterlaufen. Aber er gab nicht nach. Er verweigerte noch immer das »Mützen ab«. Ja, während des Appells schrie er mitunter aus seiner Zelle wilde, religiöse Worte heraus, die bis auf den Appellplatz drangen. Zweifellos hatte ihn so etwas überfallen wie der Fanatismus religiöser Märtyrer. Aber man wollte ihn noch nicht sterben lassen. Man ließ ihn sich wieder hinlegen, man gab ihm zu essen. Dann wiederholte man die Torturen. Aber Schneider blieb hartnäckig. Aufs Neue ließ man ihn die Stehtour machen. Sommer schlug ihn, sein Rücken war von blauen, roten und grünen Striemen bedeckt. Seine geschwollenen Füße brachen auf. Wasser tropfte daraus hervor. Dann führte man ihn ins Revier. Seit Monaten sah er zum ersten mal jemand anderen als seine Peiniger und Kerkermeister. Man badete seine Füße sorgfältig.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.