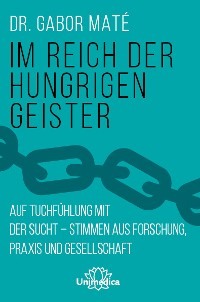Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 8
„Nein, er hat all seine Sachen zusammengepackt und hatte nicht mal das Herz, mir zu sagen, was los war, wo er war oder sonst was. Ich bin ihm heute Morgen auf der Straße begegnet und er beschimpfte mich mit einem Haufen Blödsinn, dass ich ihn betrogen hätte, was völliger Quatsch ist. Ich habe ihn nie betrogen. Aber er ist abgehauen. Also, so sieht’s jetzt bei mir aus.“
„Sie sind verletzt.“
„Ich bin am Boden zerstört. Ich habe mich in meinem ganzen verdammten Leben noch nie so unerwünscht gefühlt.“
Doch, hast du, denke ich mir im Stillen. Du hast dich immer ungewollt gefühlt. Und so verzweifelt du auch versuchst, deinem Baby das zu bieten, was du selbst nie erlebt hast – ein liebevolles Willkommen auf dieser Welt – am Ende wirst du ihm die gleiche Botschaft der Ablehnung übermitteln.
Es ist, als ob Celia meine Gedanken liest. „Ich ziehe die Schwangerschaft trotzdem durch“, sagt sie mit gespitzten Lippen. „Ich könnte eine Abtreibung machen, aber nein. Das ist mein Kind, es ist ein Teil von mir. Es ist mir egal, ob ich allein dastehe oder nicht. Diese Dinge geschehen aus einem bestimmten Grund. Gott würde mir nicht mehr aufbürden, als ich tragen kann. Also muss ich nur fest genug daran glauben, dass sich alles zur rechten Zeit richten wird. Und so, wie es geschieht, so soll es auch sein.“
Celia hat eine starke spirituelle Neigung. Wird sie das durchstehen?
„Ich muss mich erholen. Ich muss heute Nacht von hier verschwinden, und sei es auch nur in eine Notunterkunft, sonst bringe ich am Ende noch jemanden um. Ich will einfach nur verschwinden …“
Wieder einmal telefonieren wir mit verschiedenen Rehakliniken. Am Nachmittag springt Celia, zwei Blocks vom Portland entfernt, aus dem Taxi, das sie zu der Unterkunft fahren sollte, die das Personal für sie organisiert hat. Am nächsten Morgen ist sie wieder im Portland, zugedröhnt mit Kokain.
Dezember 2004
Celia hat seit einer Woche kein Kokain mehr genommen und ist entschlossen, clean zu bleiben. „Ich kann mich einfach nicht in irgendeiner Suchtklinik einsperren lassen“, sagt sie, „aber wenn ich mich vom Crack fernhalten kann, geht es mir gut.“ Sie ist fröhlich, hat einen klaren Kopf und ist optimistisch. Die Schwangerschaft entwickelt sich rasant. Während sie zunimmt, werden ihre etwas kantigen Züge weicher, und sie scheint sich rundum wohlzufühlen. Bei der Geburtsvorbereitung und der HIV-Behandlung wird sie vom Oak Tree betreut, einer Klinik, die dem Frauenkrankenhaus von British Columbia angegliedert ist.
Wenn ich Celia so sehe, erinnere ich mich an ihre Stärken. Zusätzlich zu ihrer Intelligenz und ihrem liebebedürftigen Wesen hat sie eine einfühlsame, spirituell lebendige und künstlerische Seite. Sie schreibt Gedichte, malt und hat auch eine schöne Mezzosopran-Stimme. Die Mitarbeiter waren gerührt, als sie Celia in der Portland-Musikgruppe und sogar unter der Whirlpool-Dusche, die wir für unsere Patienten auf der gleichen Etage wie die Klinik haben, zu den Songs von Bob Dylan und den Eagles ihr Herz ausschütten hörten. Wenn man doch nur ihre lebensbejahenden Tendenzen aufrechterhalten könnte, damit sie die Oberhand über ihre resignierten, von Angst geplagten emotionalen Mechanismen bekommen könnten.
„Sie hätten nicht vielleicht einen Dollar für ein paar Zigaretten, oder, Doktor?“
„Ich sag Ihnen was“, erwidere ich. „Wir gehen runter an die Ecke und ich hole Ihnen ein Päckchen. Nikotin ist schwerer zu widerstehen als Kokain.“
Celia scheint gerührt. „Ich kann nicht glauben, dass Sie das für mich tun würden.“ „Betrachten Sie es als Geschenk fürs Baby“, antworte ich, „obwohl es keines ist, von dem ich jemals gedacht hätte, dass ich es einer schwangeren Patientin schenken würde.“
Als ich die Zigaretten bezahle und sie Celia überreiche, schaut mich der Verkäufer prüfend an. „Das ist so toll“, sagt Celia. „Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.“ Als wir den Laden verlassen, höre ich, wie der Verkäufer ihre Worte leise, in einem spöttischen Ton wiederholt: „Das ist so toll. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.“ Ich drehe mich in der Tür um und schaue ihm ins Gesicht. Er lächelt. Er weiß genau, warum hier in East Hastings ein einigermaßen gut gekleideter Mann mittleren Alters eine Schachtel Zigaretten für eine zerzauste junge Frau kauft.
Januar 2005
Rick begleitet Celia zu diesem Termin in meine Praxis. Sie scheinen entspannt zu sein und sich miteinander wohlzufühlen.
„Ich kann mit dieser Seifenoper nicht mithalten“, scherze ich.
„Ich auch nicht“, sagt Rick, während Celia nur vor sich hin summt und ein Lächeln ihre Mundwinkel umspielt.
Sie war in der Oak Tree Klinik. Ihr Baby wächst, und die Bluttests haben ergeben, dass ihr Immunsystem in guter Verfassung ist. Obwohl sie erst im Juni Termin hat, wird sie bald, vier Monate früher, zur vorgeburtlichen Betreuung in Fir Square, der Spezialabteilung des British Columbia Women’s Hospital für suchtkranke werdende Mütter, aufgenommen. Heute ist sie wegen eines Methadon-Rezepts da und bittet erneut um einige Telefonnummern von Rehakliniken. Ich gebe ihr beides.
Die beiden gehen. Durch die offene Tür sehe ich sie durch den Hintereingang auf die sonnenbeschienene Veranda treten, sich in die Augen sehen, Händchen halten und ruhig und friedlich davongehen. Es ist das letzte Mal, dass ich sie während der Schwangerschaft zusammen sehe.
Januar 2005: später im Monat
An einem Nachmittag Ende Januar wird Celia freiwillig für eine Entgiftungsmaßnahme aufgenommen, ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Reha-Programm. Am Abend entlässt sie sich selbst. In dem Albtraum, den Celia durchlebt, fühlt sie sich in einem Sumpf von Schmerzen gefangen, hilflos, bestraft und völlig allein. Sie wiederholt ihr Mantra: „Ich habe mich in meinem ganzen verdammten Leben noch nie so verlassen gefühlt.“ Ihr Blick, verschleiert und unkonzentriert, ist auf die Wand irgendwo links von mir gerichtet. „Wie soll ich damit umgehen ohne einen Berg von Dope?“
Was auch immer ich auf diese Frage geantwortet haben mag und was auch immer Celia sich selbst zu beantworten versuchte, es passte nicht. Die restliche Zeit ihrer Schwangerschaft lässt sich zusammenfassen als kurze Episoden von Krankenhausaufenthalten und Flucht, anhaltendem Drogenkonsum, der wilden Jagd nach Kokain und Verhaftungen. Eine Verhaftung erfolgte wegen Körperverletzung, weil Celia auf den Schreibtisch der Krankenschwester in der Aufnahmeabteilung gespuckt hatte. Natürlich erinnerte ich mich, dass sie in ihrer Kindheit Erfahrung mit Spucken gemacht hatte. Aber schließlich brachte sie ein bemerkenswert gesundes Mädchen zur Welt, das leicht von ihrer Opiatabhängigkeit entwöhnt werden konnte. In jeder anderen Hinsicht ging es dem Baby gut. Im Gegensatz zu den Opiaten Methadon und Heroin ruft Kokain keine gefährlichen physiologischen Entzugsreaktionen hervor.
Rick, der Vater des Kindes, war fantastisch. Celia verließ das Krankenhaus am Tag nach der Entbindung – ihr Bedürfnis nach Drogen war stärker als ihre Entschlossenheit, ihr Neugeborenes zu bemuttern –, aber als außerordentliche Ausnahmen von den Richtlinien durfte Rick stationär auf der Entbindungsstation bleiben. Mit großer Unterstützung des Krankenhauspersonals fütterte und versorgte er das Baby mit der Flasche und baute in den zwei Wochen, in denen er sich rund um die Uhr mit seiner Tochter beschäftigte, eine Beziehung auf, bevor er sie dann zu sich nach Hause nahm. Die Krankenschwestern, die diese Vater-Kind-Verbindung betreuten, waren erstaunt über seine Sanftmut, Liebe und Hingabe an seine Tochter.
Celia, die feindselig und drogensüchtig war, wurde per Gerichtsbeschluss vom Besuch ausgeschlossen. Sie war untröstlich und wütend. Sie glaubte, sie sei vorsätzlich von der Zuneigung zu ihrem Neugeborenen weggedrängt worden. „Es ist mein verdammtes Baby“, schrie sie in meiner Praxis, „meine eigene kleine Tochter. Sie haben mir das Kostbarste in meinem Leben geraubt!“
Dezember 2005
Rick kommt auf einen kurzen Besuch vorbei. Ich frage nach seinem und Celias Kind. „Sie ist jetzt bei Pflegeeltern“, sagt Rick. „Sie war eine Zeit lang bei mir, aber dann verschlechterte sich die Wohnsituation wegen der Drogenkonsumenten in diesem Haus. Sie wurden rückfällig. Und ich hatte einen Alkoholrückfall, deswegen nahmen sie mir das Baby weg. Sie hatten eine Kinderschutzverfügung.“ Seine Schultern zittern, als er versucht, sein Weinen zu unterdrücken. Dann schaut er auf. „Ich habe sie letzten Monat besucht. Ich bin gerade dabei, mir eine neue Wohnung zu suchen, und ich habe vor, an Elterngruppen teilzunehmen sowie eine Alkohol- und Drogenberatung und alles andere in Anspruch zu nehmen. So weit geht es mir ganz gut.“
Januar 2006
Celia ist wegen ihres monatlichen Methadon-Rezepts gekommen. Der inzwischen sechs Monate alte Säugling ist in einem Pflegeheim. Celia träumt immer noch davon, das Sorgerecht für ihre Tochter wiederzuerlangen und ein Familienleben aufzubauen. Aber sie ist nicht in der Lage, auf Kokain zu verzichten.
„So sehr Sie Ihr Baby auch lieben“, sage ich ihr noch einmal, „und so sehr Sie es auch lieben wollen, wenn Sie auf Crack sind, sind Sie als Mutter nicht geeignet. Sie selbst haben einmal gesagt, dass es nicht möglich ist, das Beste aus einem Menschen herauszuholen, wenn es um Sucht geht. Das Kind braucht das Beste von Ihnen, Sie müssen dafür emotional stabil und präsent sein. Sein Sicherheitsgefühl hängt davon ab. Die Gehirnentwicklung Ihrer Tochter braucht es, um zu gedeihen. Sie sind kein Elternteil, wenn Sie von Ihrer Sucht kontrolliert werden. Verstehen Sie das nicht?“
Meine Stimme ist angespannt und kalt, ich spüre die Anspannung in meiner Kehle. Ich bin wütend auf diese Frau. Ich versuche, ihr eine Wahrheit aufzudrängen, die ich als arbeitssüchtiger Arzt und auch auf andere Weise in meinem eigenen Leben zu ignorieren pflege.
Celia starrt nur mit mürrischem, hartem Blick zurück. Ich erzähle ihr nichts, was sie sich selbst nicht schon gesagt hat.
———
Als menschliches Schauspiel hat diese Geschichte kein glückliches Ende – zumindest nicht, wenn wir wollen, dass unsere Geschichten einen klaren Anfang und ein klares Ende hat. Doch im größeren Kontext möchte ich darin einen Triumph sehen: Sie zeigt, wie das Leben das Leben sucht, wie sich die Liebe nach Liebe sehnt und wie der göttliche Funke, der in uns allen brennt, weiterhin glüht, auch wenn er nicht in voller, offener Flamme lodern kann.
Was wird mit diesem Säugling, diesem Wesen der unendlichen Möglichkeiten, geschehen? Angesichts seines schrecklichen Starts kann es durchaus sein, dass er ein Leben in grenzenlosem Leid führen wird – aber es ist nicht zwingend, dass dieser Lebensbeginn prägend ist. Es hängt davon ab, wie gut unsere Welt sich um dieses kleine Mädchen kümmert. Vielleicht wird unsere Welt genügend liebevolle Zuflucht bieten – genug „shelter from the storm“, wie Bob Dylan gesungen hat –, damit das Baby, im Gegensatz zu seiner Mutter, in sich selbst etwas anderes als seinen eigenen schlimmsten Feind kennenlernen kann.
KAPITEL 7
Beethovens Geburtszimmer
Mir ist es anfangs kaum bewusst, aber Ralph und ich sind bei unserem ersten Treffen dabei, eine spannende Geschichtsdebatte zu führen. Ein dünner, großer Mann mittleren Alters mit hängenden Wangen humpelt in meine Praxis und stützt sich dabei auf einen Stock. Ein Großteil seiner Kopfhaut ist rasiert, eine ungeschickte Selbstrasur mit unebenen Flecken und Schnitten vom Rasiermesser. Sein tief schwarz gefärbtes Haar mit notdürftigem Irokesenschnitt ziert den Scheitel seines Kopfes. Der Hitlerschnurrbart unter seiner Nase ist kein eitles modisches Accessoire, wie unser Gespräch bald zeigen wird.
Der Zweck dieses Besuchs besteht für mich darin, seine Krankengeschichte aufzunehmen, Medikamente zu verschreiben und das Sozialhilfeformular auszufüllen, das Ralph zu einem monatlichen Lebensmittelzuschuss berechtigt. Sein linker Knöchel, der bei einem Arbeitsunfall verletzt worden war, entwickelte in der Folge eine Arthritis, außerdem verhinderte seine Drogensucht eine angemessene medizinische Behandlung. Sein Schmerzmittelbedarf ist legitim, und trotz seiner Drogenabhängigkeit werde ich ihm das Morphium nicht vorenthalten. Auf jeden Fall sind Stimulanzien Ralphs bevorzugte Drogen, wobei Kokain für ihn am wichtigsten ist.
Ich werde Ralph bald als einen der intellektuell begabtesten Menschen kennenlernen, die ich je getroffen habe. Er ist auch ein zutiefst trauriger Mensch – eine verlorene poetische Seele mit einer hoffnungslosen, unerfüllten Sehnsucht nach menschlicher Verbundenheit. Neben seinem breit gefächerten, aber undisziplinierten Intellekt, der es mit jedem Gedanken oder Gefühl, das ihn beherrscht, aufnehmen kann, verfügt er über einen scharfen, selbstironischen Humor. Wenn er unter dem Einfluss der von ihm verwendeten Stimulanzien steht, kann er höchst aggressiv und sogar gewalttätig sein. „Ich bin ein schizo-affektiver, zwanghafter, hyperaktiver, paranoider Depressiver mit bipolaren Tendenzen, die sich mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung überlagern. Außerdem leide ich an halluzinatorischen Zuständen, die durch Drogen ausgelöst werden“, verkündet er einleitend. „All diese Diagnosen wurden mir bereits von dem einen oder anderen Psychiater gestellt“, erklärt er weiter. „Ich war bei vielen.“
Wegen des Lebensmittelzuschusses führt Ralph alle entscheidenden Aspekte an. „Ich brauche frisches Fleisch, Gemüse und Fisch, Wasser in Flaschen und Vitamine. Ich habe Hepatitis C und Diabetes.“
Je mehr Krankheiten eine Person nachweisen kann, desto größer ist die zu erwartende finanzielle Unterstützung. Süchtige, die täglich etwa hundert Dollar oder mehr für ihre illegalen Drogen ausgeben und oft gesundheitsrelevante Termine versäumen, verpassen selten den Zeitpunkt, wenn sie wieder ihre Papiere für die monatlichen zwanzig, vierzig oder fünfzig Dollar ausfüllen müssen, die sie als Unterstützung für Lebensmittel erhalten. Ich fülle diese Formulare pflichtbewusst aus, jedoch mit gemischten Gefühlen, denn ich weiß, wo das Geld landen wird. Ich denke, dass es einen besseren Weg geben muss, um diese unterernährten Menschen angemessen zu versorgen. Um ein alternatives System einzurichten, bräuchten wir Mitgefühl, Fantasie und Flexibilität – Eigenschaften, die unser soziales System nicht ohne Weiteres auf die Hardcore-Drogensüchtigen anwendet.
„Außerdem muss ich mich natriumarm ernähren“, sagt Ralph.
„Warum?“
„Ich esse kein Salz. Ich mag kein Salz. Ich kaufe immer Butter ohne Salz … Und was ist Dysphagie?“, fragt er und wirft einen Blick auf die Liste mit den Bedingungen für einen Zuschuss.
„Vom griechischen phag, essen“, erkläre ich. „Dysphagie bedeutet Schwierigkeiten beim Schlucken.“
„Oh, ja, ich habe Schluckbeschwerden. Und ich muss mich glutenfrei ernähren …“
„Das kann ich nicht alles aufschreiben. Ich habe keine medizinischen Anhaltspunkte dafür, dass Sie Diabetes, Dysphagie oder irgendein salz- oder glutenbedingtes Problem haben.“
Ralphs unmittelbare Reaktion, ein brummeliges Knurren, ist ein spezielles, herausforderndes Hörerlebnis. Den Anfang seines nächsten Satzes kann ich nicht verstehen, er endet mit „… reiche amerikanische Touristen lachen uns aus … amerikanische Juden …“
„Amerikanische was?“
„Amerikanische Juden.“
Ich bin überrascht über diese Wendung des Gesprächs.
„Was ist mit ihnen?“
„Sie lachen über uns. Sie sind so verdammt bösartig … sie fressen die ganze verdammte Welt auf.“
„Amerikanische Juden sind …? Sie sprechen mit einem kanadischen Juden.“
„Ungarischen Juden, habe ich gehört.“ Ralphs trübe Augen haben einen bösartigen Glanz und sein mürrisches Stirnrunzeln verwandelt sich in ein Grinsen.
„Kanadischer und ungarischer Jude“, gebe ich zu.
„Ungarischer Jude“, beharrt Ralph. „‚Arbeit macht frei‘*… Heh, heh … Wissen Sie noch, was das heißt?“
„Ja. Finden Sie das lustig?“
„Natürlich nicht.“
„Wissen Sie, dass meine Großeltern in Auschwitz unter dem Schild mit diesem Schriftzug getötet wurden? Mein Großvater war Arzt.“
„Er hat die Deutschen verhungern lassen“, sagt Ralph, als ob er eine unbestreitbare Tatsache festhält.
Das hätte mein Stichwort sein sollen, um die Diskussion zu beenden. Mich drängt jedoch meine Entschlossenheit, meine professionelle Ruhe und den therapeutischen Kontakt zum Patienten zu bewahren. Außerdem bin ich neugierig zu erfahren, was es mit diesem Mann auf sich hat.
„Mein Großvater war Arzt in der Slowakei. Wie hat er die Deutschen verhungern lassen?“
Ralphs gelassene Pseudo-Rationalität verflüchtigt sich im Bruchteil einer Sekunde. Seine bleichen Wangen zittern vor Wut, seine Stimme hebt sich und das Tempo seiner Rede beschleunigt sich mit jedem Wort. „Die Juden hatten all das Gold, sie nahmen all die Ölgemälde … sie nahmen die ganze Kunst, sie waren die Polizeibeamten, Richter, Anwälte und sie ließen die Deutschen verdammt noch mal verhungern. Dieser Jude Stalin schlachtete 90 Millionen Deutsche ab … die Invasion unseres verdammten Landes … alle wie gelähmt, an Hunger sterbend. Sie wissen das genauso gut wie ich. Ich habe keine Gewissensbissen gegenüber Ihnen und auch keine Trauer.“
Dass ich mir als Jude und Kleinkind, das den Genozid überlebt hat, diese Faseleien ruhig anhören kann, liegt daran, dass ich weiß, dass sie nicht von mir oder meinen Großeltern oder gar vom Zweiten Weltkrieg oder von Nazis und Juden handeln. Ralph stellt den schrecklichen Aufruhr seiner Seele zur Schau. Die leidenden Deutschen und raffgierigen Juden in seiner Erzählung sind Projektionen seiner eigenen Phantome. Der unberechenbare Mischmasch, den er Geschichte nennt, spiegelt sein inneres Chaos, seine Verwirrung und seine Angst wider. „Als Kind bin ich in Deutschland verhungert, und auch in diesem Land bin ich verdammt noch mal verhungert … ich kam 1961 hierher.“ (Ralph kam als Teenager.) „Scheiß Kanadier. Ich hasse die Kanadier.“
Es ist an der Zeit, ethnische Zusammenhänge und die Geschichte hinter sich zu lassen. „Okay“, sage ich. „Mal sehen, wie das Morphium bei Ihnen wirkt.“
„Wie viel bekomme ich?“
„Es reicht für vier oder fünf Tage. Dann muss ich Sie wieder sehen.“
„Ich hasse es, ständig in die Arztpraxis zu kommen. Ich hasse die Arztpraxis. Es ist Zeitverschwendung.“
„Ich hasse auch die Tankstelle“, versichere ich ihm, „aber ich fahre hin, sonst geht mir das Benzin aus.“
Ralph ist versöhnlich. „Danke, mein Herr“, erwidert er auf Deutsch. „… nichts für ungut.“
„Nein“, sage ich.
Wir tauschen auf Deutsch ein herzliches Auf Wiedersehen aus, um diese - unsere erste - Begegnung zu beenden. Es wird noch viele weitere geben, einige enden damit, dass Ralph zum Abschied den Arm zum Hitlergruß hochreißt. Wenn er wütend ist, weil ich mich weigere, ihm das eine oder andere Medikament zu verschreiben, schreit er: „Heil Hitler!“ oder „Arbeit macht frei!“ oder die immerwährende Beschimpfung „Schmutziger Jude“. Nicht, dass ich endlose Toleranz gegenüber Nazi-Parolen habe, die er auf Deutsch auf mich abfeuert! Im Allgemeinen stehe ich auf, wenn die Schimpftirade beginnt, und öffne die Tür, um das Ende des Besuchs zu signalisieren. Ralph geht normalerweise auf den Wink ein, aber einmal musste ich ihm mit der Polizei drohen, sollte er sich nicht schnellstens aus meinem Büro entfernen.
———
Das Deutsch, das Ralph spricht, ist nicht immer voller hasserfüllter Beschimpfungen. Er deklamiert im Stakkato in fließendem Deutsch oder er rezitiert Zeilen aus der Ilias in einer Sprache, die wie Altgriechisch klingt. Bei unserem zweiten Treffen bricht er in einen Schwall deutschsprachiger Rezitationen aus; das einzige Wort, das ich erkenne, ist „Zarathustra“. „Nietzsche“, erklärt er. „Als Zarathustra dreißig Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge …“
Diese Zeilen von Nietzsche gleiten ihm schnell von der Zunge, ebenso wie Zitate aus anderen Klassikern der Literatur seines Heimatlandes. Es ist unmöglich zu erkennen, wie viel Wahrheit in seinen eigentümlichen Anekdoten steckt, aber seine kulturellen Kenntnisse sind beeindruckend – umso mehr, als sie weitgehend selbst erworben zu sein scheinen. Seine Behauptungen, er habe irgendwo das College abgeschlossen, erscheinen mir zweifelhaft. Diplom hin oder her, er ist auf jeden Fall belesen.
„Ich liebe Dostojewski“, teilt er mir eines Tages mit. Ich beschließe, ihn zu prüfen.
„Mein Lieblingsautor“, sage ich. „Was haben Sie von ihm gelesen?“
„Oh“, antwortet Ralph und leiert nonchalant einige Titel der Romane und Kurzgeschichten des russischen Autors herunter: „Der Idiot, Schuld und Sühne, Der Spieler– das gefiel mir besonders gut, wissen Sie, weil es um einen Suchtkranken geht –, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Die Brüder Karamasow habe ich nicht geschafft. Zu lang.“
Ein anderes Mal erzählt er mir von einem Abenteuer, das er als Jugendlicher erlebt hat, als er zu Besuch in Deutschland war.
„Ich nahm dieses Mädchen mit in Beethovens Geburtszimmer.“
Ich erinnere mich an mein rudimentäres Deutsch aus der Kindheit – geboren: to be born; Zimmer: room. „Beethovens Geburtszimmer?“
„Ich nahm etwas Wein, Käse und etwas Salami mit sowie ein bisschen Marihuana. Ja, das Zimmer, in dem er geboren wurde. Wir sind eingebrochen. Ich knackte das Schloss, nahm dieses Mädchen mit, spielte auf seinem Klavier und hatte eine tolle Zeit.“
„Ha“, sage ich und hebe skeptisch eine Augenbraue. „In welcher Stadt war das?“ Ein weiterer Test.
„Bonn.“
„Ja, Beethoven wurde in Bonn geboren“, murmelte ich.
Ralph, ein bisschen Kokain-durchgeknallt, geht spontan zu einer völlig unerwarteten Aufführung über.
„Hier ist ein Gedicht von mir, das Ihnen gefallen könnte. Es heißt ‚Präludium‘.“ Sein mit einer tiefen, körnigen Stimme vorgetragenes Stakkato-Rezital ist so schnell, dass man als Zuhörer kaum mitbekommt, ob er zwischendrin Luft holt. Das Gedicht besteht aus Paarreimen in durchgehendem Pentameter. Es handelt von Einsamkeit, Verlust und Fatalismus.
„Haben Sie das geschrieben?“
„Ja. Ich habe fünfhundert Seiten Gedichte geschrieben. Es war mein Leben. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben sind. Ich war fünf Jahre lang obdachlos. Ich ließ meine Gedichte in einem Hostel, wo ich eine Woche lang gewohnt hatte. Sie wollten hundert Dollar haben, wenn ich mein Zeug zurückhaben wollte, aber ich konnte es mir nicht leisten. Vielleicht wurde es versteigert, vielleicht hat es der Wachmann bekommen, vielleicht ist es in den Müll gewandert. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur an wenige Texte. Es ist alles weg. Ich habe alles verloren.“
Ralph ist für einen Moment ungewohnt nachdenklich. Plötzlich leuchtet sein Gesicht auf. „Das werden Sie erkennen“, sagt er und deklamiert in schnell gesprochenen Reimen auf Deutsch. Ich konnte die Sprache nie fließend sprechen, ich verstehe nichts von dem, aber ich rate gerne. „Das klingt mehr nach Goethe als nach Goebbels.“
„Ist es auch“, bestätigt Ralph triumphierend. „Die letzten acht Zeilen von Faust“. Ohne eine Zeile auszulassen, rezitiert er auf Englisch:
All things transitory
Are but a parable,
Earth’s insufficiency
Here finds fulfillment.
The ineffable
Wins life through love.
The eternal feminine
Leads us above
[Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird’s Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.]
Er trägt die Verse ohne die übliche Hast vor, seine Stimme ist weich und sanft.
Als ich an diesem Abend wieder zu Hause bin, nehme ich Faust II aus dem Bücherregal und blättere zur letzten Seite. Da steht es: Goethes Lobgesang auf die spirituelle Erleuchtung, die selige Vereinigung des menschlichen Geistes mit dem weiblichen Prinzip, mit der göttlichen Liebe. Goethe stellt, wie Dante in Die Göttliche Komödie, die göttliche Liebe als weibliche Eigenschaft dar. Ich finde Ralphs Übersetzung von Goethe, sei es seine eigene oder eine auswendig gelernte, bewegender als die Version, die ich in meinen Händen halte.
Während ich die Verse des großen deutschen Dichters in meinem gemütlichen Zuhause in einem gehobenen, grünen Vancouver-Viertel lese, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ralph, unterstützt von seinem Stock, in diesem Moment irgendwo in der düsteren und schmutzigen Hastings unterwegs ist und es ihn nach seinem nächsten Kokain-Trip drängt. Und in seinem Herzen wünscht er sich Schönheit, nicht weniger als ich, und braucht Liebe, genau wie ich.
Wenn ich ihn richtig verstehe, sehnt sich Ralph vor allem nach der Einheit mit der ewig weiblichen caritas – der gesegneten, seelenrettenden göttlichen Liebe. Göttlich bezieht sich hier nicht auf eine übernatürliche Gottheit, sondern auf die unsterbliche Quintessenz der Existenz, die es in uns, durch uns und über uns hinaus gibt. Religionen mögen darin einen Gottesglauben erkennen, aber die Suche nach dem Ewigen geht weit über bekannte religiöse Konzepte hinaus.
Eine Folge spiritueller Entbehrung ist die Sucht, und zwar nicht nur nach Drogen. Auf Konferenzen, die der wissenschaftsbasierten Suchtmedizin gewidmet sind, gibt es immer häufiger Vorträge über den spirituellen Aspekt von Süchten und deren Behandlung. Gegenstand, Form und Schwere von Süchten werden durch viele Einflüsse geprägt – durch die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umstände, die persönliche und familiäre Geschichte sowie physiologische und genetische Veranlagungen –, doch im Kern aller Abhängigkeiten gibt es eine spirituelle Leere. Im Fall von Serena, der Ureinwohnerin von Kelowna, entstand diese Leere durch den unerträglichen Missbrauch, den sie als Kind erlitt – ein Thema, auf das ich später zurückkommen werde. Aber an dieser Stelle genügt es zu sagen, dass Ralph seine Gottessehnsucht, wenn ich sie nicht schon bei seinem Goethe-Rezital gespürt hätte, ein paar Monate später wortreich bestätigte. Aus tiefster Seele sehnt er sich danach, sich mit derselben weiblichen Qualität in seinem Inneren zu verbinden, die seine Streitsüchtigkeit und ungezügelte Aggressivität so bösartig mit Füßen tritt.
Bald darauf, vielleicht schon beim nächsten Termin, muss ich mir wieder Arbeit macht frei, Schmutziger Jude, Heil Hitler anhören. „Steck dir dein Morphium in den Arsch“, schreit Ralph mit einer Stimme wie Schmirgelpapier. „Geben Sie mir Ritalin. Geben Sie mir Kokain. Geben Sie mir Xylocain!“ Er könnte genauso gut sagen: „Geben Sie mir Freiheit oder geben Sie mir den Tod.“ Drogen sind die einzige Freiheit, die er kennt.
———
Durch Blut übertragene bakterielle Infektionen sind häufige Komplikationen des Drogenkonsums, insbesondere angesichts des schlechten hygienischen Zustands vieler Süchtiger in Downtown Eastside. Letztes Jahr wurde Ralph ins Krankenhaus eingeliefert, wo er zwei Monate lang intravenös mit hochwirksamen Antibiotika behandelt werden musste, um eine lebensbedrohliche Sepsis zu heilen.
Gegen Ende seiner Behandlung besuche ich ihn auf der Station im Krankenhaus von Vancouver. Dort treffe ich auf eine Person, die ganz anders ist als der wütende, feindselige Pseudo-Nazi aus meiner Praxis. Er liegt auf dem Rücken, das Kopfteil des Krankenhausbettes leicht erhöht, und ist bis zur Taille mit einem weißen Laken bedeckt. Sein dürrer Brustkorb und seine oberen Gliedmaßen sind entblößt. Sein geschecktes Haar ist nun ordentlich geschnitten und bildet eine kurze Tonsur über seinen rasierten Schläfen. Er winkt mir zur Begrüßung mit seinem linken Arm.
Wir beginnen, über seinen Gesundheitszustand und seine Pläne für die Zeit nach seiner Entlassung zu reden. Ich hoffe, dass ich ihm helfen kann, eine Unterkunft abseits der Drogenszene zu finden. Ralph ist zunächst ambivalent, stimmt aber schließlich zu, dass es eine gute Idee wäre, sich vom Downtown Eastside fernzuhalten.
„Ich bin froh, dass Sie gekommen sind“, sagt er mir. „Daniel war auch da. Wir hatten ein gutes Gespräch.“ Zu dieser Zeit war mein Sohn Daniel als Mitarbeiter für psychische Gesundheit im Portland angestellt. Er besuchte Ralph als Musiker und Songschreiber im Krankenhaus, und die beiden nahmen zusammen fast eine Stunde lang Lieder von Bob Dylan auf. Dabei spielt und zupft Daniel auf seiner Gitarre zu Ralphs rohem, kratzigem Halbbariton. Als Sänger beherrscht Ralph die Melodien erstaunlich unsicher, aber er hat ein Gespür für die emotionale Resonanz von Dylans Texten und seiner Musik.
„Ich entschuldige mich für das, was ich zu Daniel gesagt habe, und ich entschuldige mich bei Ihnen, für den ‚Arbeit macht frei‘-Mist.“
„Ich bin neugierig. Was bedeutet das alles für Sie?“
„Es geht nur um Überlegenheit. Ich glaube sowieso nicht daran. Keine Rasse ist einer anderen überlegen. Vor Gott sind alle Menschen gleich … es ist sowieso egal. Es sind nur Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Ich bin im Umfeld des Nationalsozialismus aufgewachsen, so wie Sie auch, nur dass Sie sich auf der anderen Seite befanden. Das war eine unglückselige Situation. Ich entschuldige mich für alles, was ich gegen Sie und Ihren Sohn gesagt habe. Ich wünsche mir echt, bald hier raus zu sein, damit Daniel und ich mehr Musik machen können.“
„Wissen Sie, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass es Sie isoliert. Ich schätze, Sie haben gelernt, in der Welt zurechtzukommen, indem Sie extrem feindselig waren.“
„Ich schätze, das stimmt.“ Wenn Ralph emotional bewegt ist, so wie jetzt, wölbt sich die Haut über seinen Unterarmmuskeln wie bei einem Beutel voller Murmeln. „Denn die Leute haben mich schlecht behandelt und … und man lernt, sie auch schlecht zu behandeln. Das ist eine der Möglichkeiten. Es ist nicht der einzige Weg …“
„Das ist ziemlich normal“, sage ich. „Und manchmal kann ich selbst auch ziemlich arrogant sein.“