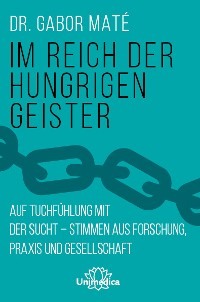Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 7
Wie immer, wenn ich eine unerwartet lange Zeit mit einer Patientin verbringe, bricht die Menge im Wartezimmer in lärmenden Protest aus. „Beeilen Sie sich“, ruft einer lauthals. „Wir brauchen auch unseren Saft!“ Serenas ganzer Schmerz und all ihre Wut explodieren aus ihr heraus in einem lautstarken „Halt’s Maul!“. Ich stecke meinen Kopf aus der Tür, um die nervöse Menge zu beruhigen.
Ich bin damit einverstanden, Serena ein Antidepressivum zu verschreiben, und erkläre ihr, dass es je nach der besonderen Physiologie einer Person funktionieren kann oder auch nicht und dass es Nebenwirkungen haben kann. Und ich sage ihr, dass wir ein anderes Mittel ausprobieren können, wenn dieses nicht wirkt. Ich gebe ihr das Rezept und suche in meinem Herzen nach mitfühlenden Worten, nach Worten, die dazu beitragen könnten, die Qualen zu lindern, die Serenas Herz plagen. Und die Worte kommen, zunächst noch stockend.
„Was Ihnen passiert ist, ist wirklich entsetzlich. Es gibt kein anderes Wort dafür, und es gibt nichts, was ich sagen könnte, das auch nur annähernd anerkennen würde, wie schrecklich, wie ungerecht es für jedes Wesen, für jedes Kind ist, gezwungen zu werden, all das zu ertragen. Aber unabhängig davon akzeptiere ich immer noch nicht, dass die Dinge für irgendeinen Menschen hoffnungslos sind. Ich glaube, dass in jedem Menschen eine natürliche Stärke und angeborene Perfektion steckt. Auch wenn sie von allen möglichen Schrecken und Narben verdeckt sind, sind sie da.“
„Ich wünschte, ich könnte sie finden“, sagt Serena mit einer Stimme, die so erstickt und leise ist, dass ich von ihren Lippen lesen muss, um die Worte zu verstehen.
„Es ist in Ihnen. Ich sehe es. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, aber ich sehe es.“
„Ich habe versucht, es mir selbst zu beweisen, und ich bin gescheitert.“
„Ich weiß. Sie haben es versucht und es hat nicht funktioniert und nun sind Sie wieder hier. Es ist sehr schwierig. Es sollte viel mehr Unterstützung geben.“
Schließlich sage ich Serena, dass für einen depressive Menschen alles absolut hoffnungslos aussieht. „So fühlt es sich an, wenn man depressiv ist. Wir werden sehen, wie Sie mit den Medikamenten zurechtkommen. Lassen Sie uns in zwei Wochen wieder miteinander reden.“
Und in dieser Situation fühle ich mich beschämt, beschämt durch meine Schwäche, diesem Menschen nicht helfen zu können. Beschämt, dass ich die Arroganz besaß zu glauben, ich hätte alles gesehen und gehört. Man kann nie alles sehen und hören, denn trotz all ihrer schäbigen Ähnlichkeiten entfaltet sich jede Geschichte in Downtown Eastside in der individuellen Existenz eines einzigartigen Menschen. Jede Geschichte muss jedes Mal aufs Neue gehört, bezeugt und anerkannt werden, jedes Mal, wenn sie erzählt wird. Und ich fühle mich besonders beschämt, weil ich es gewagt habe, mir ein Bild von Serena zu machen, das weniger komplex und leuchtend ist als die Person, die sie ist. Wer bin ich, über sie zu urteilen, weil sie sich dem Glauben verschrieben hat, dass sie nur durch Drogen Erlösung von ihren Qualen finden wird?
Spirituelle Lehren aller Traditionen fordern uns auf, in jedem das Göttliche zu sehen. „Namaste“, der heilige Gruß aus dem Sanskrit, bedeutet: „Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir.“ Das Göttliche? Es ist so schwer für uns, das Menschliche überhaupt zu sehen. Was habe ich dieser jungen Ureinwohnerin zu bieten, die in den drei Jahrzehnten ihres Lebens die komprimierten Qualen von Generationen ertragen musste: Jeden Morgen eine Antidepressivum-Kapsel, die zusammen mit Methadon genommen wird, sowie ein- bis zweimal im Monat eine halbe Stunde meiner Zeit.
KAPITEL 5
Angelas Großvater
Angela McDowell ist eine Prinzessin der Küsten-Salish, einer indigenen Gruppe, die an der Pazifikküste Nordamerikas in British Columbia, Washington und Oregon beheimatet ist. Sie hat eine aufrechte Haltung, ein ovales Gesicht, dunkle Augen und lange, schwarze Haare, die in Wellen auf ihre Schultern fallen. Hier in Downtown Eastside lebt sie das Leben einer Exilantin. Eine lange, horizontale Narbe überzieht ihre linke Wange. „Ein Mädchen hat mich geschnitten, als ich ins Sunrise Hotel zog“, erzählt sie mir in einem sachlichen Ton.
Sie kommt immer zu spät zu den Terminen, wenn sie diese überhaupt wahrnimmt. Oft übersteht sie einige Tage den Entzug ohne Methadon, bevor sie ihr Rezept einlöst. Oder sie spritzt sich Straßenheroin.
Als Dichterin trägt Angela in ihrer Handtasche ein rosafarbenes Notizbuch mit einer Spiralheftung. Auf jeder Seite stehen in fein säuberlicher Handschrift naive Reime von Hoffnung und Verlust, Trostlosigkeit und Möglichkeiten. Einige, so meine ich, sind authentischer als andere. „Eines Tages werden wir mit dieser Sucht, die wir bekämpfen / alle gewinnen und das Licht sehen“, beschwört sie am Ende eines Gedichts ein Leben, das geprägt ist von der Jagd nach der elenden Droge. Ich habe meine Zweifel: Sind dies ihre wahren Gefühle, oder schreibt sie das, was sie für die angemessene Empfindung hält?
Ich weiß jedoch, dass sie an einem realen Ort gewesen ist, und die Wahrheit, die sie dort erblickt hat, verleiht ihr Autorität. Die Freude, die sie vor langer Zeit erlebt hat, ist in ihrem umwerfend strahlenden Lächeln gegenwärtig. Wenn sich ihre Lippen öffnen, um zu lachen oder zu lächeln, zeigen sich zwei Reihen perfekter, weißer Zähne, die in dieser Ecke der Welt durchaus auffallen. Ihre Augen leuchten, die Anspannung in ihrem Gesicht löst sich und ihre Narbe verblasst. „Die Heilung ist in mir“, sagt sie mir eines Tages. „Ich habe die Stimmen meiner Vorfahren gehört. Als Kind hatte ich einen wirklich mächtigen Geist.“
Angela wurde zusammen mit ihren Brüdern und ihrer Schwester von ihrem Großvater, einem großen Schamanen ihres Stammes, erzogen. „Er war der letzte überlebende McDowell seiner Familie. Alle seine Brüder, Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten wurden getötet, daher wurde mein Großvater in ein Internat geschickt und dort aufgezogen, seit er ein kleiner Junge war. Er wuchs heran, heiratete meine Großmutter und bekam alle seine Kinder – elf Mädchen und drei Jungen. Er trug den Geist all unserer Vorfahren in sich. Jedes First Nation Reservat hat seine eigenen Mächte und Geister. Wir, die Küsten-Salish, tragen die Gabe … – ich weiß nicht, wie ich es sagen soll – wir können den Tod nahezu vorhersagen. Wir sehen Geister. Wir sehen über das Sichtbare hinaus. Wir sehen die andere Seite.“ Sie schüttelt den Kopf, als wolle sie einem Missverständnis meinerseits entgegentreten. „Es ist nicht so, als ob man ein klares Bild sieht – eher so, als ob man etwas aus den Augenwinkeln sieht. Dies ist eine Gabe, die mir überliefert wurde.“
Ein Jahr, bevor Angelas Großvater starb, –sie war sieben Jahre alt–, begann er, sich damit zu beschäftigen, welcher seiner Nachkommen die Gabe weitertragen sollte. „Er musste uns auf seinen Tod vorbereiten und sehen, wer von uns auserwählt wurde. Ein Jahr lang gingen wir jeden Tag zum Fluss, immer an dieselbe Stelle, und nahmen ein Zedernbad – alle Kinder.“
Der Schriftsteller, Kulturkommentator, Süchtige und Bankräuber Stephen Reid hat mir erklärt, dass das spirituelle Bad in kaltem Wasser mit Zedernblättern eine heilige Zeremonie der Küsten-Salish ist. Zurzeit verbüßt er eine lange Gefängnisstrafe im William-Head-Gefängnis auf Vancouver Island, studiert mit einem Salish-Ältesten, der zu Besuch kommt, und fühlt sich hoch geehrt, am spirituellen Bad teilnehmen zu dürfen. In den Erzählungen von Stephen und Angela klingt es wie ein zermürbendes Ritual, das der spirituellen Reinigung dient.
Um fünf Uhr morgens, es ist schon später Winter, führten der alte Mann und seine Frau die Kinder zu einer Gruppe von Zedernbäumen am Flussufer. Im Sommer wie im Winter lagen die Kinder am Ufer, nackt ausgezogen. Der Schamane sang, während ihre Großmutter kleine Zweige von den Stellen riss, wo die aufgehende Sonne auf die Bäume schien. Dann tauchte sie in absoluter Stille, man hörte nur das Rascheln der Blätter und das Rauschen des Baches, die Zweige in das kalte, sprudelnde Wasser. Sie badete die Kinder und bürstete mit den Zweigen ihre Körper. „Sie haben uns abgewaschen und gereinigt und uns für unser Erwachsenenleben gestärkt“, sagt Angela, „um uns darauf vorzubereiten, dass wir keine Knochenbrüche erleiden und dass wir, wenn wir krank sind, nicht sehr lange krank bleiben. Und es war auch eine Möglichkeit für meinen Großvater, herauszufinden, welches von uns Kindern stark genug ist, um die Spiritualität weiterzuführen. Alle unsere Vorfahren leben in diesem Auserwählten weiter.“
„Wie findet er das heraus?“
„Du stehst in eiskaltem Wasser und es fühlt sich an, als würden sie dir die Haut von der Haut kratzen – das ist für ein kleines Kind kein Vergnügen. Wir glaubten nicht, dass es das war, was er uns erzählte. Aber schon bald konnte ich Trommeln hören – die Trommeln der Ureinwohner. Nach einer Weile war es das, was mich beruhigte, das, was ich hörte. Als mein Großvater betete und meine Großmutter mich badete, konnte ich Trommeln hören. Es war so kalt und wir mussten still liegen. Ich beschloss, dass der einzige Weg, es zu überstehen, darin bestand, nicht wahrzunehmen, was mein Körper fühlte. Ich lag einfach nur da, hörte den Trommeln zu und ließ es geschehen. Als die Zeit verging und es schneite, begann ich einen leisen, ruhigen, schönen Gesang in einer Sprache zu hören, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Es war die Musik der Ureinwohner. Seltsam war, dass ich damals noch nicht wusste, wie man Küsten-Salish spricht, aber in dem Moment sang ich mit.“
Ich höre Angela mit Faszination und einer vagen Sehnsucht zu – es ist das Gefühl der verlorenen Verbindung zu vergangenen Generationen. In meinem Leben gab es keine Großeltern. Angela ist durchdrungen von Traditionen und der Welt der Geister. Sie hat die Stimmen ihrer Vorfahren gehört. Ich lese die Stimmen meiner Vorfahren, aber ich höre nur meine eigenen Gedanken.
„Woher kommt das Lied?“, fragte der Schamane Angela eines Tages, als er seine Frau beobachtete, wie sie das Kind mit den Zedernzweigen bürstete, und sah, dass sie, das kleine Mädchen, nicht litt. Sie wurde ihm gebracht, das wusste er, und könnte nun seine Führerin sein. Die beiden gingen langsam den Weg am Fluss entlang und ließen Angelas Brüder, Schwester und Großmutter zurück, bis sie ganz allein waren. Und dort saßen sie auf einer Lichtung, der Schamane und seine junge Enkelin, und lauschten den Stimmen der Toten ihres Stammes. Die Toten vieler Generationen klagten, jammerten und sangen in einer alten Sprache von ihrem Leben, erzählten ihre Geschichten und wie sie seit der Ankunft des weißen Volkes und bereits davor gearbeitet und gekämpft hatten und wie sie gestorben waren. Angela erfuhr die Geschichten und alle Weisheiten.
Ich sehe es in ihr. Ich habe miterlebt, wie sie in meiner Praxis anderen Süchtigen gegenüber Worte des Mitgefühls und des Trostes sprach. Ich war auch beeindruckt von der stillen Zuversicht, mit der sie bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Zentralbibliothek von Vancouver die Bühne betrat.
Ich hielt einen Vortrag über Sucht und hatte Angela eingeladen, ihre Gedichte vorzutragen, und wie immer kam sie zu spät. Als ich sie vorstellte, schritt sie zielstrebig von ihrem hinteren Platz auf das Podium zu. Unbekümmert blickte sie über die dreihundert Zuhörer und rezitierte ihre Werke mit klarer, klangvoller Stimme, als wäre es für sie eine selbstverständliche, alltägliche Praxis. Es war eine bewegende Darbietung, die von ihren Zuhörern mit langem und warmem Applaus belohnt wurde.
Diese Lichtung am Fluss ist nach wie vor Angelas Ort der Erhabenheit, auch wenn ihre Verbindung dorthin durch Misshandlungen später in ihrer Kindheit verdunkelt wurde. Sie ist weit weg davongelaufen und weiß nicht, ob sie jemals zurückkehren wird. Sie ist heute keine Hüterin der heiligen Stammesüberlieferungen mehr, sondern lebt in Downtown Eastside als kokainabhängige Hinterhof-Stricherin. „Blow for your dough / play for your pay“ [„Einen blasen für Geld / spielen gegen Lohn“], sagt sie in einem Gedicht.
Doch ihr fröhliches Lächeln und ihre patrizische Autorität verdankt sie ihrem tiefen Wissen, dass es einen solchen Ort gibt und dass sie dort gewesen ist und die Stimmen gehört hat. Sie sprechen zu ihr durch all ihr Elend hindurch. Sie helfen ihr immer noch, sich selbst zu finden. „Spiegel meines inneren Selbst, was sehen andere?“, fragt Angela in einem ihrer Verse. „Ist es die Wahrheit in meinem Herzen oder menschliche Eitelkeit? Und was sehe ich?“
KAPITEL 6
Tagebuch einer Schwangerschaft
Dies ist die kurze Schilderung einer Schwangerschaft – und der Geburt eines opiatabhängigen Säuglings von einer süchtigen Mutter. Trotz ihrer Entschlossenheit, sich ihren Dämonen zu stellen, wird die Mutter nicht in der Lage sein, ihr Kind zu behalten. Ihre Mittel werden nicht ausreichen, und weder ihre Bitten an die göttliche Stimme in ihrem Herzen noch die Unterstützung, die wir in Portland bieten können, werden ausreichen, um ihr bei der Verwirklichung ihres heiligen Ziels, ihre Aufgabe als Mutter zu erfüllen, zu helfen.
Juni 2004
Ich eile in den fünften Stock, wo Celia völlig außer Kontrolle geraten sein soll und droht, aus dem Fenster zu springen. Das ist keine leere Drohung, andere haben es vor ihr schon getan. Der Widerhall des die Wände durchdringenden Geschreis erreicht mich im Treppenhaus zwei Stockwerke tiefer, während ich auf den Lärm zurenne.
Ich finde Celia, die barfuß auf Glasscherben randaliert und aus mehreren kleinen Schnitten blutet. Der Boden glitzert von den Scherben zerbrochener Bildschirme, Gläser und zerborstenen Geschirrs, beleuchtet von der Mittagssonne, die ihre Strahlen in einem scharfen Winkel in den Raum wirft. Die ausgeweidete Fernsehkonsole liegt im Flur. Lebensmittelreste tropfen von den Wänden und von kaputten Holzstühlen. Überall liegt Kleidung herum. Auf der Küchentheke gurgelt und zischt eine kleine Espressomaschine und verbreitet das scharfe, säuerlichen Aroma von verbranntem Kaffee. Ein paar blutverkrustete Spritzen liegen auf dem Tisch, dem einzigen noch intakten Möbelstück.
Celia stampft umher und brüllt mit einer Stimme, die schon nicht mehr menschlich klingt: kratzig, hoch und knirschend. Tränen strömen ihr aus den rot geschwollenen Augen über die Wangen und zittern tröpfchenweise am Kinn. Sie trägt ein schmutziges Nachthemd aus Flanell. Es ist eine überirdische Szene, die sich da bietet.
„Ich hasse ihn, verdammt noch mal. Beschissener, gottverdammter, fucking Bastard.“ Als Celia mich sieht, kippt sie auf der zerlumpten Matratze in der Ecke um. Ich kicke einen Stapel Handtücher beiseite und kauere mich gegen das Balkonfenster. Im Moment gibt es nichts zu sagen. Während ich auf ein Zeichen von ihr warte, dass sie zum Kontakt bereit ist, lese ich das Gebet, das sie an die Wand über ihr Bett geschrieben hat: „Oh, Großer Geist, dessen Stimme ich im Wind höre und dessen Atem der ganzen Welt um mich herum Leben einhaucht, höre unser Weinen, denn wir sind klein und schwach.“ Es endet mit einer Bitte: „Hilf mir, Frieden mit meinem größten Feind zu schließen – mit mir selbst.“
Juni 2004: nächster Tag
Celia ist ruhig und sogar heiter, während sie auf ihr Methadon-Rezept wartet. Sie scheint über mein Erstaunen amüsiert zu sein.
„Ihr Zimmer ist wieder aufgeräumt, sagen Sie?“
„Nun, es ist makellos.“
„Wie kann es makellos sein?“
„Ich hab‘s mit meinem Alten wieder hergerichtet.“
„Der Typ, den Sie hassen?“
„Ich hab gesagt, dass ich ihn hasse, aber das stimmt nicht.“
Mit ihrem sanften Gesichtsausdruck, den klaren Augen, den glatten braunen Haaren und ihrem ruhigen Auftreten ist Celia eine attraktive dreißigjährige Frau. Es ist unmöglich, in ihr die wütende Xanthippe zu erkennen, die ich vor weniger als vierundzwanzig Stunden erlebt habe. „Was, glauben Sie, hat Sie so aus der Haut fahren lassen?“, frage ich sie. „Sie waren aufgebracht, aber da muss noch irgendeine Droge mit im Spiel gewesen sein, die Sie so verrückt gemacht hat. Irgendwas hat Sie völlig umgehauen.“
„Nun ja, stimmt. Koks. Es ist sehr explosiv. Je weniger Dope [Heroin] ich nehme, desto mehr Zeugs aus der Vergangenheit kommt an die Oberfläche. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll. Mit Crack kommen Erinnerungen an sensible – unglaublich sensible – ungelöste Dinge in meinem Leben hoch. Dinge, die mich verletzt haben, sie überwältigen mich, bis zu dem Punkt, dass ich völlig am Boden zerstört und verzweifelt bin oder wie ein Vulkanausbruch – es ist erschreckend für mich.“
„Sie stocken Ihr Methadon also immer noch mit Heroin auf. Warum?“
„Weil ich diesen Komazustand will, in dem ich nichts mehr fühle.“ Celia spricht langsam, fast förmlich, mit ihrer tiefen, heiseren Stimme – in einer nachdenklichen, überzeugenden und klaren Weise. Eine Zahnlücke lässt sie ein wenig lispeln.
„Was ist es, das Sie nicht fühlen wollen?“
„Jede Person, der ich jemals vertrauen wollte, hat mich verletzt. Ich bin wirklich in Rick verliebt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er mich nicht auch betrügen wird. Das geht direkt auf meinen sexuellen Missbrauch zurück.“
Celia erinnert sich, dass sie im Alter von fünf Jahren zum ersten Mal sexuell missbraucht wurde, und zwar von ihrem Stiefvater. „Das ging acht Jahre lang so. Seit Kurzem erlebe ich den Missbrauch in meinen Träumen wieder.“ In ihren Albträumen ist Celia mit dem Speichel ihres Stiefvaters getränkt. „Das war ein Ritual“, erklärt sie fast nüchtern. „Als ich ein kleines Mädchen war, stand er über meinem Bett und spuckte mich am ganzen Körper an.“
Ich erschaudere. Nach drei Jahrzehnten als Arzt glaube ich manchmal, dass ich jede Art von Verderbtheit gehört habe, die Erwachsene jungen und ungeschützten Menschen antun können. Aber in Downtown Eastside werden immer wieder neue Kindheitsschrecken enthüllt. Celia quittiert meinen Schock mit einem Flackern ihrer Augenlider und einem Nicken und fährt dann fort. „Mein Alter, Rick, war bei der Armee in Sarajevo, und er leidet nun unter posttraumatischem Stress. Da bin also ich, die wegen ihrer Albträume von sexuellem Missbrauch aufwacht, und ich habe ihn, der aufwacht und wegen der Waffen und dem Tod schreit …“
„Sie nehmen also Drogen, um von den Schmerzen wegzukommen“, sage ich nach einer Weile, „aber der Drogenkonsum verursacht mehr Schmerzen. Wir können Ihre Opiatabhängigkeit mit dem Methadon in den Griff bekommen, aber wenn Sie wollen, dass dieser Kreislauf aufhört, müssen Sie sich verpflichten, das Kokain aufzugeben.“
„Das tue ich. Ich will das mehr als alles andere.“ Im Wartebereich vor meinem Praxiszimmer werden die Patienten unruhig. Jemand schreit. Celia winkt abweisend mit der Hand.
Ich lächle sie an. „Sie klangen gestern gar nicht so anders.“
„Ich war viel schlimmer als das. Ich war völlig verrückt.“
Das Geschrei geht weiter, diesmal lauter. „Verpiss dich, du gottverdammtes Arschloch“, schreit Celia, ihr Tonfall plötzlich bösartig. „Ich spreche mit dem Arzt!“
August 2004
Ich mag es, wenn Musik aus der kleinen Musikanlage hinter meinem Schreibtisch tönt. Meine Patienten, von denen nur sehr wenige mit klassischer Musik vertraut sind, sagen oft, dass sie es als willkommene, beruhigende Überraschung empfinden. Heute ist es Kol Nidrei, Bruchs Vertonung des Gebetes der jüdischen Seele um Sühne, Vergebung und Einheit mit Gott. Celia schließt ihre Augen. „Das ist so schön“, seufzt sie.
Als die Musik zu Ende ist, erwacht sie aus ihrer Träumerei und erzählt mir, dass sie und ihr Freund Pläne für die Zukunft schmieden.
„Was ist mit Ihrer anhaltenden Sucht? Bedeutet das ein Problem für Sie oder für ihn?“
„Nun ja, schon, denn ich bin ja nicht mit meinem ganzen Ich präsent. Sie bekommen nicht das Beste von einem Menschen, wenn er süchtig ist, stimmt’s?“
„Richtig“, stimme ich zu. „Ich habe es selbst erlebt.“
Oktober 2004
Celia ist schwanger. Hier in Downtown Eastside ist das im besten Fall immer ein gemischter Segen. Man könnte meinen, dass der erste Gedanke eines Arztes bei einer frisch schwangeren, drogensüchtigen Patientin ist, zur Abtreibung zu raten. Aber die Aufgabe des Arztes – ob bei dieser oder einer anderen Bevölkerungsgruppe – besteht darin, die eigenen Präferenzen der Frau zu ermitteln und gegebenenfalls die Optionen zu erläutern, ohne Druck auszuüben, sich für diesen oder jenen Weg zu entscheiden.
Viele süchtige Frauen entscheiden sich für ihre Kinder, anstatt den Weg eines vorzeitigen Schwangerschaftsabbruchs zu gehen. Celia ist entschlossen, die Schwangerschaft durchzustehen und das Kind zu behalten. „Sie haben mir meine ersten beiden Kinder weggenommen; dieses Kind werden sie mir niemals nehmen“, schwört sie.
Eine Durchsicht von Celias Krankengeschichte der letzten vier Jahre offenbart nichts Ermutigendes. Mehrere Selbstmorddrohungen. Unfreiwillige Einweisung in die Psychiatrie, weil sie während eines Brandes im Washingtoner Hotel nicht von der Feuertreppe runterkommen wollte. Zahlreiche körperliche Verletzungen – Knochenbrüche, Prellungen, blaue Augen, Abszesse, die mittels einer chirurgischen Drainage behandelt wurden, Zahninfektionen, Lungenentzündungen, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten, Ausbruch einer Gürtelrose, wiederkehrender Pilzbefall im Mund, eine seltene Blutinfektion – Manifestationen eines Immunsystems, das von HIV geschwächt und durch häufige Drogeninjektionen bis an die Grenze seiner Belastbarkeit gefordert wird. Celia hielt sich lange Zeit nicht an die vorgeschriebenen antiviralen Behandlungen. Ihre Leber ist durch Hepatitis C geschädigt. Der einzige hoffnungsvolle Aspekt ist, dass sie seit ihrer Zeit mit Rick, ihrem derzeitigen „Alten“, ihre HIV-Medikamente regelmäßig einnimmt und ihre Immunwerte wieder in den sicheren Bereich geklettert sind. Wenn sie die Behandlung fortsetzt, wird sich ihr Baby nicht infizieren.
Heute ist sie hier mit Rick. Die beiden kuscheln sich aneinander und werfen sich zärtliche Blicke zu. Es ist der erste vorgeburtliche Termin, und Celia berichtet über ihre bisherigen Schwangerschaften.
„Ich habe meinen ersten Sohn neun Monate lang großgezogen. Sein Vater verließ uns schließlich … er war ein guter Vater … Ich habe gespritzt. Es war äußerst unverantwortlich von mir.“
„Sie verstehen also, warum Ihnen auch dieses Baby weggenommen werden könnte, wenn Sie weiter Drogen nehmen.“
Celia erwidert mit Nachdruck: „Oh, ja, auf jeden Fall. Ich würde nie ein Kind in die Lage versetzen, an meiner Sucht zu leiden. Ich meine, das ist leichter gesagt als getan, aber …“
Ich sehe Rick und Celia an und spüre, wie glühend sie sich dieses Kind wünschen. Vielleicht sehen sie ihr Baby als ihren Retter, als die Kraft, die ihnen die Stärke gibt, ihr Leben zusammenzuhalten. Meine Sorge ist, dass sie vom magischen Denken besetzt sind, wie Kinder, die glauben, dass der Wunsch reicht, um Wirklichkeit zu werden. Celia ist tief in ihren Süchten verstrickt. Weder sie noch Rick sind kurz davor, die Traumata und psychischen Belastungen, die ihre Beziehung zerstören, zu lösen. Ich glaube nicht, dass dieses neue Leben, das sich in Celias Schoß regt, für diese Eltern das bewirken wird, was sie für sich selbst nicht erreichen konnten. Freiheit gewinnt man nicht so leicht.
Trotz meiner Zweifel und Bedenken wünsche ich ihnen von ganzem Herzen, dass sie Erfolg haben. Die Schwangerschaft hat einigen Süchtigen geholfen, aus ihrer Abhängigkeit auszubrechen, und Celia wäre nicht die erste, die es schaffen würde. Carol, die junge Frau, die von Crystal Meth und Opiaten abhängig war, von der ich in Kapitel 3 erzählt habe, hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht, ihre Sucht aufgegeben und ist ins Landesinnere von British Columbia gezogen, um bei ihren Großeltern zu leben. Und es hat im Laufe der Jahre noch einige andere Erfolgsgeschichten unter meinen Patientinnen gegeben.
„Ich werde Ihnen helfen, wo immer ich kann“, sage ich. „Es ist eine Chance für ein neues Leben, nicht nur für das Baby, sondern auch für jeden von Ihnen – und für Sie beide zusammen. Aber Sie wissen, dass Sie noch einige Hindernisse überwinden müssen.“
Der erste Punkt, den ich zur Sprache bringe, ist Celias Sucht. Ihre Opiatabhängigkeit kann durch das Methadon behoben werden. Im Gegensatz zu dem, was Celia erwartet, werden wir sie nicht nur auf diesem Medikament belassen, sondern wahrscheinlich die Dosis mit fortschreitender Schwangerschaft erhöhen. Ein Fötus, der in der Gebärmutter unter Opiatentzug leidet, kann neurologische Schäden erleiden, sodass es für das Baby besser ist, mit einer Opiatabhängigkeit auf die Welt zu kommen und es nach der Geburt sanft davon zu entwöhnen. Kokain ist eine andere Sache. Wenn man bedenkt, wie wahnsinnig gestört Celia unter dem Einfluss dieser Droge ist, ist es unvorstellbar, dass sie in der Lage sein könnte, sich der geburtsvorbereitenden Betreuung zu unterziehen oder später das Sorgerecht für ihr Kind zu behalten, falls sie das Kokain nicht aufgibt. Ich fordere sie dringend auf, in eine Rehaklinik zu gehen, weit weg von Downtown Eastside.
„Ich kann nicht von Rick getrennt sein“, antwortet Celia.
„Es geht nicht um mich“, sagt Rick. „Es geht darum, dass du die Genesung und Stabilität bekommst, die du brauchst.“
„Sie haben mir vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass Sie Probleme mit dem Vertrauen haben“, erinnere ich Celia. „Wie sicher sind Sie sich, dass Sie Rick jetzt vertrauen?“
„Nun, ich sehe, dass er sehr engagiert ist. Aber“ – sie holt tief Luft und schaut ihren Partner direkt an – „ich habe Angst, denn jedes Mal, wenn ich in der Vergangenheit Vertrauen hatte, bin ich immer … bin ich immer enttäuscht worden. Also habe ich Angst, aber ich bin immer noch bereit zu vertrauen.“
„Wenn das der Fall ist“, deute ich an „dann wird die physische Nähe zu Rick …“
Celia vervollständigt meinen Gedanken. „Dann wird es nichts ändern, wenn ich ihm körperlich nahe bleibe.“
Vor dem Praxiszimmer steigern sich die Rufe der wartenden Patienten. Ich verspreche, die Reha-Möglichkeiten für Celia zu prüfen und gebe ihr den Standard-Bluttest und die Überweisung zum Ultraschall mit. Als ich aufstehe, um die Tür zu öffnen, rührt sich Celia nicht von ihrem Stuhl. Sie zögert und blickt Rick kurz an, bevor sie spricht. „Du musst es mir leichter machen“, sagt sie zu ihm. „Ich weiß, es ist sehr schwer für dich mit anzusehen, wie ich Drogen nehme, obwohl ich schwanger bin …“ Sie hält inne und starrt auf den Boden. Ich dränge sie, weiterzumachen.
„Ich brauche Ermutigung, keine Wut. Rick kann mit seinen Worten sehr schneidend sein … sehr scharf.“ Sie konfrontiert ihn noch einmal und spricht ihn bewusst und entschlossen an. „Du verstärkst all die negativen Dinge, die die Leute über mich gesagt haben, indem du mir Vorwürfe machst … ‚Ja, sie hatten recht, sie sagten dies, sie sagten das. Ja, du bist dies, du bist das‘, und wirfst noch ein paar Sachen hinterher, die nichts mit mir zu tun haben. Ich bin nicht promiskuitiv; ich bin keine Hure …“
Rick wird unruhig und starrt auf seine Füße. „Wir haben noch einiges an unserer Beziehung zu arbeiten“, sagt er, „aber wir haben jetzt eine andere Motivation.“
„Es ist frustrierend für Sie, Celia zuzusehen, wie sie Drogen nimmt.“
„Sehr frustrierend. Aber es ist mein Frust. Es ist meine Verantwortung.“
Rick hat als Alkoholiker einige Entwicklungen mithilfe eines Zwölf-Schritte-Programms gemacht. Er ist leicht zu verstehen, und wie Celia ist er einfühlsam und wortgewandt. „Es gibt einen schmalen Grat“, bemerkt er, „zwischen den gesunden Grenzen und der Co-Abhängigkeit, bei der einfach über einen hinweggegangen wird. Im Eifer des Gefechts ist es für mich so schwer, das zu erkennen.“
Ich erlaube mir für einen Moment einen gewissen Optimismus. Wenn irgendjemand es schaffen kann, dann sind es diese beiden.
Oktober 2004: später in diesem Monat
Celia hält den Reha-Plan nicht durch. Als sie beim nächsten Mal wegen ihres Methadon-Rezepts in meine Praxis kommt, gesteht sie, dass sie immer noch Koks raucht.
„Es ist ziemlich sicher, dass man Ihnen das Baby wegnehmen wird“, erinnere ich sie. „Wenn Sie Kokain nehmen, wird man Sie nicht als kompetente Mutter betrachten.“ „Das ist eine Sache, mit der ich aufhören werde. Ich versuche verdammt noch mal mein Bestes. Das war’s. Ich höre auf.“
„Es ist Ihre beste Chance, das Baby zu behalten – Ihre einzige Chance.“
„Ich weiß.“
November 2004
Celia hält eine feuchte Kompresse an die große Schwellung über ihrem rechten Auge und geht von der Tür zum Fenster. „Ich bin mit einem Mädchen in eine Schlägerei geraten. Das wird schon wieder. Aber, hey, ich habe den Ultraschall gemacht. Ich habe eine kleine Hand gesehen! Sie war so winzig.“
Ich erkläre ihr, dass es sich bei dem Schatten auf dem Ultraschallbildschirm nicht um eine Hand gehandelt haben kann: Nach sieben Wochen Schwangerschaft sind die Gliedmaßen noch nicht ausgebildet. Aber ich bin gerührt von Celias Aufregung und ihrer offensichtlichen Verbundenheit mit dem embryonalen Leben, das sie in sich trägt. Sie erzählt mir, dass sie seit über einer Woche kein Kokain mehr genommen hat.
November 2004: später in diesem Monat
Ich weiß nicht, ob ich jemals eine solche Traurigkeit gesehen habe, wie ich sie an diesem Tag in Celias Gesichtszüge eingebrannt sehe. Ihr langes, strähniges Haar fällt ihr vor das Gesicht, während sie den Kopf hängen lässt, und hinter diesem Schleier spricht sie ihre Worte mit schmerzhafter Langsamkeit. Ihre Stimme ist ein wehklagendes, wimmerndes Stöhnen.
„Er hat mir gesagt, ich soll mich verpissen … Er hat es mehr als deutlich gemacht, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will.“
Ich fühle mich bestürzt, ja sogar irritiert, als ob Celia es mir persönlich schuldig wäre, eine glückliche, aller Wahrscheinlichkeit trotzenden Erlösungsfantasie auszuleben. „Waren das Ricks Worte oder Ihre Interpretation?“