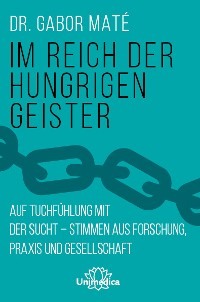Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 9
„Super. Alles, was ich wirklich will … Es ging immer um die Drogen. Ich wollte kein Morphium … Ich wollte Xylocain. Das hätte all meine Probleme gelöst … Es hätte nichts mehr gegeben, wonach es mich gedrängt hätte, nichts, wonach ich auf der Suche gewesen wäre. Es hätte alles gelöst.“
Ralph erklärt auf sehr komplizierte Weise, wie man Xylocain, ein Lokalanästhetikum, zur Inhalation vorbereitet, indem man es mit Backsoda und destilliertem Wasser mischt. Die erhitzte Mischung wird durch ein Stück Scheuerschwamm aus Edelstahl eingeatmet. Er legt großen Wert auf die Inhalationstechnik, bei der, seiner Ansicht nach, die Substanz am Ende langsam durch die Nase ausgeblasen werden muss. Ich höre diesem außergewöhnlichen Vortrag in angewandter Psychopharmakologie fasziniert zu.
„All diese Leute in der Hastings Street und Pender Street und in Downtown Eastside blasen es durch den Mund aus. Das ist lächerlich. Es hat überhaupt keine Wirkung. Um es richtig zu verstoffwechseln, muss es durch die Drüsen der Nasenschleimhaut ins Gehirn gelangen. Wenn es das Gehirn erreicht, wird es verstoffwechselt und blockiert die kleinen Kapillaren, die zu den Gehirnzellen führen …“
„Was empfinden Sie, wenn Sie das tun?“
„Es befreit mich von meinen Schmerzen und meiner Angst. Es nimmt mir meinen Frust. Es gibt mir die reine Essenz des Homunkulus … Sie wissen schon, des Homunkulus im Faust.“
In Goethes epischem Drama ist der Homunkulus ein kleines, in einem Laborkolben erdachtes Wesen aus Feuer. Es ist eine männliche Figur, die sich freiwillig mit dem weiten Ozean, dem göttlich-weiblichen Aspekt der Seele, vereinigt. Nach den mystischen Traditionen aller Glaubensrichtungen und Philosophien ist es ohne eine solche Ego-auflösende Unterwerfung unmöglich, spirituelle Erleuchtung zu erlangen, „den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt“. Ralph sehnt sich nach nichts weniger.
„Der Homunkulus“, fährt er fort, „ist die Figur, die all das verkörpert, was ich gewesen wäre, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so zu sein. Aber die hatte ich nicht. Deshalb nehme ich jetzt Xylocain, wenn ich es kriegen kann, oder Kokain, wenn ich es nicht bekomme.“
Ralph hofft, durch das Rauchen einer Glaspfeife einen friedlichen Bewusstseinszustand zu erlangen. „Ich kann nicht der Homunkulus sein“, sagt er, „daher muss ich ein Süchtiger sein.“
„Wie lange hält dieser Effekt an?“, frage ich.
„Fünf Minuten“, sagt er. „Es sollte nicht vierzig Mäuse kosten, nur um den Schmerz für fünf Minuten abzutöten. Und für fünf Minuten Atempause schlage ich mich auf der Hastings Street herum, rauf und runter, rauf und runter, spreche mit meinen Kumpels und erpresse etwas Geld von ihnen. ‚Hör zu, Kumpel, her mit dem Geld, sonst kriegst du einen mit meinem Stock übergezogen.‘„
Unter dem Laken zittert Ralphs nach zwei Monaten Ruhe und Krankenhauspflege etwas voller gewordener Bauch vor Vergnügen, als er von seinem haarsträubenden krummbeinigen Banditentum erzählt. „Meine Kumpel lachen und geben mir ein paar Münzen. Ich habe eine Menge Freunde. Und ich bettle auch. Aber ich muss stundenlang da draußen herumhetzen, nur um den Schmerz für fünf Minuten zu betäuben.“
„Also sind Sie stundenlang beschäftigt, um fünf Minuten lang Erleichterung zu bekommen.“
„Ja, und dann gehe ich wieder raus, und wieder und wieder.“
„Was ist das für ein Schmerz, den Sie abtöten wollen?“
„Zum Teil ist er körperlich, zum Teil emotional. Körperlich auf jeden Fall. Wenn ich etwas Kokain hätte, würde ich jetzt aus diesem Bett steigen und draußen eine Zigarette rauchen.“
Ich sehe, dass Ralph einen vorübergehenden Nutzen aus seinem Drogenkonsum zieht, und sage es ihm auch. Aber erkennt er nicht die negativen Auswirkungen auf sein Leben? Er ist jetzt seit zwei Monaten im Krankenhaus, nachdem er kurz vor knapp eingeliefert worden war, ganz zu schweigen von seinen Zusammenstößen mit dem Gesetz und dem ganzen anderen Elend.
„All die Zeit und Energie, die Sie aufwenden müssen, um diesen fünf Minuten nachzujagen – ist es das wert? Seien wir ehrlich, die Art und Weise, wie Sie jetzt mit mir sprechen, ist ganz anders als wie Sie sich in Downtown Eastside gebärden, wenn Sie Drogen nehmen, wenn es Ihnen schlecht geht und Sie unglücklich und feindselig sind. Sie provozieren die ablehnende Haltung der Menschen Ihnen gegenüber. Vielleicht ist es nicht Ihre Absicht, aber so ist es. Es hat eine enorme negative Wirkung. Sind es diese fünf Minuten wert?“
In seinem gegenwärtigen drogenfreien Zustand und in seiner freundlichen Stimmung bringt Ralph kein Argument hervor. „Ich verstehe, was Sie sagen, und ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Ich bin die Dinge stumpfsinnig angegangen …“
„Ich würde es nicht einmal stumpfsinnig nennen“, antworte ich. „Ich denke, Sie sind die Dinge so angegangen, wie Sie es gelernt haben. Ich vermute, dass die Welt Sie von frühester Kindheit an nicht sehr gut behandelt hat. Was ist mit Ihnen geschehen? Was hat Sie so defensiv gemacht?“
„Ich weiß nicht … Mein Vater. Mein Vater ist ein gemeiner, mieser Mensch, und ich hasse ihn abgrundtief.“ Ralph spuckt die Worte aus. Unter dem Laken zittern seine Beine heftig. „Wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, den ich verabscheue, dann ist es dieser Mann, der … mein Vater sein musste. Ach, es ist egal. Er ist jetzt ein alter Mann, und er kann für seine Verbrechen nicht mehr büßen, als er es bereits getan hat. Er hat schon tausendmal dafür bezahlt.“
„Ich glaube, das tun alle.“
„Ich weiß“, knurrt Ralph. „Ich habe auch für meine Verbrechen bezahlt. Sehen Sie mich an. Ich kann ohne diesen blöden Stock nicht mal laufen. Ich will fliegen und hänge am Boden fest, weil … Irgendwann erzähle ich es Ihnen …“
Dann beginnen wir, über etwas anderes zu reden. Ralph übt eine kluge, intuitive und scharfsinnige Kritik an der alltäglichen menschlichen Existenz und an der gesellschaftlichen Besessenheit von Zielen, die sich seiner Meinung nach nur wenig von seinem eigenen Streben nach Drogen unterscheidet. Ich erkenne in seiner Analyse eine unbequeme Wahrheit, ganz gleich, wie unvollständig sie ist.
Wir trennen uns in gutem Einvernehmen. „Ich würde mich freuen, wenn Daniel noch mal kommt“, sagt Ralph, „und ich hoffe, er bringt dann einen Videorekorder mit. Daniel könnte bei ein paar Liedern ein Intro spielen und mich begleiten – ich bin der bessere Sänger, wissen Sie. Wir könnten weitere Dylan-Songs oder ‚Homeward Bound‘ von Simon und Garfunkel singen. Sie sind alle Juden. Dadurch verschwand mein Antisemitismus, denn viele der größten poetischen Köpfe sind Juden: Bob Dylan, Paul Simon, John Lennon – wenn es diese Leute nicht gäbe, wäre die Welt ein weitaus schlimmerer Ort.“
Ich teile ihm nur ungern mit, dass John Lennon kein Jude war.
———
Seine Pläne, sich eine neue Bleibe zu suchen, wurden nicht verwirklicht. Kurz nach unserem zivilisierten Austausch im Krankenhaus von Vancouver nahm Ralph sein Leben in Downtown Eastside wieder auf. Seit die Drogen wieder Teil seines Lebens geworden waren, war er wieder zu der unberechenbaren, verbitterten Persönlichkeit zurückgekehrt, die er nur sporadisch ablegen konnte. Vor nicht allzu langer Zeit kam er in meine Praxis, um weitere Gedichte vorzutragen.
„Hier ist eins, das Ihnen gefallen wird“, sagt er und beginnt mit seinem schnellen, mechanischen Dröhnen.
Mir gefällt die erbärmliche Ehrlichkeit von Ralphs Versen. Die Binnenreime, die er in jedes Verspaar einfügt, verstärken die atmosphärisch dichte und erstickende Logik der Welt des Vortragenden. Alles passt zusammen: die vergebliche Suche nach Kameradschaft, die sexuelle Frustration, Entfremdung, Flucht in Drogen, Trauer, das Pathos und der Zynismus.
„Schreiben Sie immer noch?“, frage ich.
„Nein.“ Er wischt mit einer resignierten Handbewegung über sein Gesicht. „Ich schreibe schon lange nicht mehr. Seit Jahren, seit Jahren. Ich habe alles geschrieben, was ich schreiben wollte. Alle meine Gedanken und Gefühle habe ich in Poesie ausgedrückt.“
Ich schaue auf meine Uhr und bin mir der Patientenmenge vor meinem Zimmer bewusst. „Warten Sie“, sagt Ralph schnell, „ich habe noch ein Gedicht für Sie. Es heißt …“ Er sucht in seinen Gedanken nach dem Titel und kratzt sich dabei an seinem neuerdings kahlen Kopf. Seine Fingernägel sind mit dunklem, violettblauem Nagellack lackiert. Unter dem Saum seines schmutzigen T-Shirts führen seine Unterarmmuskeln einen aufgeregten, schlangenartigen Tanz auf.
„Ah ja, es heißt ‚Wintersonnenwende‘.“ Wieder rezitiert Ralph in seinem unnachahmlichen, schnellen, affektierten Gekrächze. Er fixiert mich mit den Augen, als ob er darauf bestehen wollte, gehört zu werden. Das Gedicht endet mit einem Adler, der mitten im Flug tot vom Himmel fällt.
Zwei Tage später kommt er wieder, mit unrealistischen Forderungen nach Medikamenten und nach Unterstützung für Lebensmittel und Unterkunft, die ich nicht befriedigen kann. Ralphs Wut ergießt sich mit seinem ungebremsten teutonischen Gift. „Und später gibt es noch etwas Kunst für Sie“, schreit er und stampft wütend aus meinem Büro ins Wartezimmer, wo seine Mitsüchtigen irritiert und missbilligend den Kopf schütteln. „Es ist bestimmt manchmal nicht leicht für Sie, hier zu arbeiten“, sagt mein nächster Patient, der bereits durch die Tür kommt.
Als ich am Nachmittag das Büro verlasse, wäscht einer der Portland Hausmeister mit heißem Seifenwasser und einem Scheuerschwamm ein großes, grob gezeichnetes, schwarzes Hakenkreuz von der Wand, direkt neben dem Ausgang im ersten Stock.
* „Arbeit macht frei“ stand auf Schildern an den Toren der nationalsozialistischen Konzentrationslager, einschließlich Auschwitz.
KAPITEL 8
Es muss Momente der Hoffnung geben
Wenn man über das Leben in einem Drogenghetto in einer trostlosen Ecke des Reichs der Hungergeister schreibt, ist es schwierig, die Gnade zu beschreiben, deren Zeuge wir sind – wir, die wir das Privileg haben, hier zu arbeiten: die Gnade, dass Mut, menschliche Verbundenheit und der hartnäckige Kampf um die Existenz und sogar um die Würde möglich sind. Das Elend im Drogen-Gulag ist außerordentlich, aber die Menschlichkeit ist es ebenfalls.
Primo Levi, der verständnisvolle und unendlich mitfühlende Chronist von Auschwitz, nannte jene unerwarteten Augenblicke, in denen die „komprimierte Identität“ eines Menschen zum Vorschein kommt und ihre Einzigartigkeit selbst inmitten der Qualen eines von Menschen geschaffenen Infernos behauptet, Momente der Gnade. In Downtown Eastside gibt es viele solcher Momente, in denen sich das wahre Wesen einer Person zeigt und darauf besteht, trotz der schmutzigen Vergangenheit oder düsteren Gegenwart erkannt zu werden.
———
Josh wohnt seit etwa zwei Jahren im Portland Hotel. Er ist ein kräftig gebauter junger Mann mit aufrechter Körperhaltung, blauen Augen, ebenmäßigen Gesichtszügen, einem blonden Bart und langen Haaren. Aufgrund seiner psychischen Instabilität und seines Drogenkonsums gehen sein angeborener Charme und seine Liebenswürdigkeit gegenüber anderen oft verloren. Seine Intuition erfasst die Schwachstellen von Menschen mit der Präzision eines Radars. Seine Intelligenz verleiht seiner Sprache eine Schärfe, die schneidend sein kann. An einem Freitagmorgen, als ich mich darauf vorbereitete, einen großen Abszess an seinem Bein aufzuschneiden und zu reinigen, sprach Josh ein abschätziges Wort zu viel. Ich hatte keinen guten Tag – ich war gereizt und müde. Meine Reaktion war ungebremst und aggressiv – zu sagen, dass ich es vermasselt hatte, wäre eine Untertreibung.
Am Nachmittag stapfte ich beschämt nach oben zu Joshs Zimmer, um es wiedergutzumachen. Als er sich meine Entschuldigung anhörte, sah er mich in seiner gewohnten Art an, ohne mit der Wimper zu zucken, aber mit Freundlichkeit in seinen Augen. Dann sagte dieser Mann, dessen Feindseligkeit andere dazu veranlasst, sich in seiner Gegenwart zusammenzuziehen, und dessen zügellose, drogenbedingte Paranoia überall nur das Böse sieht: „Danke, aber ich wollte mich eigentlich bei Ihnen entschuldigen. Ich verstehe, wie es für Sie ist. Sie haben mich letzte Woche im Krankenhaus besucht und Sie waren ruhig und aufmerksam, ein Inbegriff des guten Arztes. Es muss hier schwer für Sie sein, all die negativen Energien …, und ein Teil davon kommt von mir – ich sehe, wie Sie alles runterschlucken, und ich frage mich, wie Sie es aushalten und trotzdem Ihre Arbeit tun. Sie sind ein Mensch, und manchmal ist es einfach zu viel.“
„Die Menschen hier zeigen viel Einsicht“, sagt Kim Markel, die lebhafte Krankenschwester aus Portland mit stachelig gegeltem Haarschopf, „aber es überrascht mich nach wie vor, wenn sie ihre Sorge um uns zum Ausdruck bringen. Man meint immer, dass sie zu sehr auf ihre Psycho- und Drogentrips sowie ihre Krankheiten fixiert sind, um etwas zu bemerken. Ich erinnere mich, als es mir privat einige Zeit mal nicht gut ging, wie Larry auf mich zukam und sagte: ‚Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Das merke ich.‘ [Larry, ein Drogen- und Kokainsüchtiger, hat ein Lymphom, das man hätte beseitigen können, wenn sein Drogenkonsum die Behandlung nicht verhindert hätte. Jetzt ist er nicht mehr zu retten.] ‚Wissen Sie was, Larry?‘, sagte ich. ‚Sie haben recht. Etwas stimmt nicht mit mir, und ich arbeite daran.‘ Und er sagte: ‚Okay … möchten Sie ein Bier trinken gehen?‘ Ich lehnte ab, aber ich war gerührt. Trotz ihrer Probleme sind sie aufmerksam genug, um mitzubekommen, wenn es uns nicht gut geht.“
Kim verbindet professionelle Effizienz mit Humor, sie hat eine bodenständige Präsenz und eine erfrischende Offenheit für Neues und Andersartiges. Außerdem ist sie freundlich. Sie hat den Vorfall mit Josh mitbekommen und massiert mir, nachdem Josh den Untersuchungsraum verlassen hat, sanft die Schulter.
Josh war drei Jahre lang obdachlos gewesen, bevor er ins Portland kam. Seine Paranoia, Gewaltausbrüche und Drogenabhängigkeit waren so außer Kontrolle geraten, dass er nirgendwo untergebracht werden konnte. Ohne die Einrichtungen der Schadensminderung, die von der Portland Hotel Society und anderen Organisationen angeboten werden, wären viele Süchtige und psychisch kranke Menschen in Downtown Eastside Straßennomaden oder bestenfalls Migranten mit fünf oder sechs verschiedenen Adressen pro Jahr, die von einem schäbigen Etablissement zum nächsten weitergeschoben würden. Es gibt Hunderte von Obdachlosen in der Umgebung. Mit dem Herannahen der Olympischen Winterspiele 2010 prognostiziert die Stadt, dass die Zahl der Obdachlosen steigen wird – eine Aussicht, die von einigen politischen Entscheidungsträgern offensichtlich eher als potenzielle Peinlichkeit denn als humanitäre Krise angesehen wird.
„Als Josh frisch ins Portland kam, durfte ich nicht einmal sein Zimmer betreten“, erinnert sich Kim. „Jetzt will er mich jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, hereinbitten, um mir sein abgefahrenes Zimmer zu zeigen und wie aufgeräumt er es hält. Stellen Sie sich vor, er hat mich letzte Woche auf eine Pizza eingeladen. Er wollte mir unbedingt eine Pizza kaufen. Ich sagte: ‚Nein, nein, ich lade dich zum Mittagessen ein. Ich habe mehr Geld.‘ Er war unnachgiebig, für ihn bedeutete es ein Vergnügen. Es war die ekeligste Pizza, die ich je gegessen habe“, lacht Kim. „Ich kaute jeden Bissen und dachte: ‚Mmmm, danke, Mann.‘ Er weigert sich immer noch, seine Medikamente zu nehmen, und er wird nie stabil sein, aber er ist viel zugänglicher geworden.“
———
Die Atempausen in Portland passieren nicht, wenn wir außerordentliche Ziele anstreben – zum Beispiel die Überwindung der Sucht oder die Heilung einer Krankheit –, sondern wenn Klienten uns erlauben, sich ihnen zu nähern, wenn sie auch nur eine kleine Öffnung in dem harten, stacheligen Panzer zulassen, den sie angelegt haben, um sich selbst zu schützen. Damit dies geschieht, müssen sie zunächst unsere Bereitschaft spüren, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist die Essenz des Konzepts der Schadensminderung, aber es ist auch die Essenz jeder heilenden oder fürsorgenden Beziehung. In seinem Buch Entwicklung der Persönlichkeit beschreibt der große amerikanische Psychologe Carl Rogers eine warmherzige, fürsorgliche Haltung, die er als bedingungslose positive Wertschätzung bezeichnet, weil, wie er sagt, „daran keine bewertenden Bedingungen geknüpft sind“. „Dies ist eine fürsorgliche Haltung“, schreibt Rogers, „die nicht besitzergreifend ist, [die] keinem persönlichen Vorteil dient. Es ist eine Atmosphäre, die einfach zeigt, dass ich mich kümmere; nicht, dass ich mich kümmere, wenn Sie sich so oder so verhalten.“1
Die bedingungslose Akzeptanz des Gegenübers ist eine der größten Herausforderungen für uns Menschen. Nur wenige von uns haben sie durchgehend erlebt; der Süchtige hat sie noch nie erlebt – am wenigsten von sich selbst. „Bei mir funktioniert es am besten“, sagt Kim Markel, „wenn ich mich darin übe, nicht den großen, strahlenden Erfolg zu suchen, sondern das Kleine zu schätzen: Wenn jemand zu seinem Termin kommt, der normalerweise nicht kommt … dann ist das eigentlich ziemlich erstaunlich. Im Washingtoner Hotel habe ich einen Klienten mit einem chronischen Geschwür am Schienbein. Diese Woche ließ er mich endlich einen Blick auf seine Beine werfen, nachdem ich ihn sechs Monate lang gedrängt hatte, es mir ansehen zu dürfen. Das ist großartig, finde ich. Ich versuche, die Dinge nicht als gut oder schlecht zu bewerten, sondern sie einfach aus der Sicht des Klienten zu betrachten. ‚Okay, Sie waren zwei Tage in der Entgiftung – war das gut für Sie?‘ Nicht: ‚Wieso sind Sie nicht länger geblieben?‘ Ich versuche, mein eigenes Wertesystem herauszunehmen und den Wert wahrzunehmen, den es für den anderen hat. Selbst wenn es den Menschen übelst schlecht geht, wenn sie sich so richtig niedergeschlagen fühlen, kann man immer noch diese Momente mit ihnen erleben. Deshalb versuche ich jeden Tag als einen kleinen Erfolg zu betrachten.“
Kim hatte eine sehr schwierige Zeit im Zusammenhang mit Celias Schwangerschaft, wie auch viele andere Mitarbeiterinnen. „Es war schrecklich mit anzusehen“, erinnert sich Susan Craigie, Gesundheitskoordinatorin im Portland. „Celia wurde am Tag vor der Entbindung auf der Straße zusammengeschlagen. Sie lag auf dem Bürgersteig, hatte zwei blau geschlagene Augen und eine blutende Nase und schrie: ‚Das Portland gibt mir kein Geld fürs Taxi zum Krankenhaus!‘ Ich bot ihr an, sie zu fahren. Sie bestand darauf, dass ich ihr zuerst zehn Dollar gebe, damit sie sich einen Schuss setzen konnte. Ich lehnte natürlich ab, aber es brach mir das Herz.“
Wir drei – Susan, Kim und ich – unterhalten uns an einem verregneten Novembermorgen in meinem Büro. Es ist „Welfare Wednesday“, der vorletzte Mittwoch des Monats, an dem Schecks für die Sozialhilfe ausgestellt werden. Im Drogenghetto herrscht ausgelassene Stimmung. Die Praxis ist ruhig und wird es auch bleiben, bis am Donnerstag und Freitag das Geld ausgeht – dann kommt eine große Menge von verkaterten, drogensüchtigen Patienten auf den Platz und beschwert sich, fordert und man streitet miteinander. „Celia und ihr Baby …“, sagt Kim und schürzt traurig ihre Lippen, „einer der schönsten Momente, die ich je erlebt, war, als ich sie eines Tages singen hörte. Ich war auf ihrer Etage beschäftigt, als sie gerade duschte. Sie begann zu singen. Es war ein schreckliches Country-Lied, etwas, das ich mir nie anhören würde. Aber ich musste innehalten und zuhören. Celias Stimme hat etwas sehr Reines. Eine reine, warme Stimme. Sie schmetterte das Lied nur so heraus. Mir war plötzlich ganz klar – dieser Klang und die darin mitschwingende Unschuld – das ist die wahre Celia! Sie sang immer weiter, fünfzehn oder zwanzig Minuten lang. Sie erinnerte mich daran, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, all diese verschiedenen Aspekte haben. Im täglichen Leben vergisst man das leicht.“
Es gab mir auch dieses gewisse, mit ein wenig Traurigkeit behaftete Glücksgefühl. Ihr Leben hätte so anders aussehen können, dachte ich. Ich versuche, solche Gedanken in meiner täglichen Arbeit zu vermeiden. Ich versuche die Menschen so zu nehmen, wie sie gerade sind, und sie dabei zu unterstützen. Ich urteile nicht über sie oder stelle mir für sie ein alternatives Leben vor, das sie hätten haben können, denn wir alle könnten alternative Leben haben. Ich konzentriere mich nicht so sehr auf mein eigenes ‚Was wäre wenn‘, also versuche ich, mich auch nicht auf das anderer Menschen zu konzentrieren. Nur … es gab diesen Bruchteil einer Sekunde, als ich zwei Bilder in meinem Kopf hatte: Celia in den schlimmsten Momenten, in denen ich sie gesehen habe, und dann eine Celia, wie sie ihren Kindern vorsingt und mit ihnen irgendwo auf einem Bauernhof bei ihrer Familie lebt … Und dann ließ ich beide Bilder fallen und hörte nur noch die liebliche Stimme, die friedlich an mein Ohr drang.
———
An die Angehörigen:
Sie kennen mich nicht, obwohl Ihnen der Name auf dem Umschlag vielleicht bekannt vorkommt. Ich bin derjenige, der Ihrem Sohn das Leben genommen hat … am 14. Mai 1994.
Remys Stimme zittert vor Aufregung oder vielleicht auch vor Angst. Er ist ein kleiner, schlanker Mann mit einem blassen Gesicht, übersät von grauen Stoppeln, die zu seinem vorzeitig ergrauten Haar passen. Er steht vor dem geöffneten Fenster in der Hastings Street. Über den Verkehrslärm, der ins Zimmer dringt, liest er die Worte von einem zerknitterten und fleckigen Stück Papier ab. „Mann“, sagt er, „Sie wissen nicht, was das für mich bedeutet, dass ich das geschrieben habe und dass ich es Ihnen vorlesen kann. Wohlgemerkt, ich weiß nicht, ob ich es jemals abschicken werde.“
Es bedurfte eines Ritalin-Rezepts, um Remy zu helfen, seine Seele zu entlasten. Er leidet an einer schweren Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Sie wurde nie zuvor diagnostiziert und er war verblüfft, als ich ihm von den lebenslangen Mustern körperlicher Unruhe, Aufmerksamkeitsstörung und mangelnder Impulskontrolle erzählte, die diesen Zustand kennzeichnen. „Das bin ich“, wiederholte er immer wieder und schlug mit der Handfläche gegen seine Stirn. „Woher wissen Sie so viel über mich? Das bin ich, seit ich ein kleiner Pimpf war!“
Die Unterhaltung mit Remy ist immer ein weitschweifiges Unterfangen. Er beginnt jedes Thema mit einem Redeschwall und erinnert sich dann nicht daran, was er bereits gesagt hat oder worauf er hinauswill. Er schlängelt sich von einem zum anderen, verfängt sich im Gestrüpp eines Gedankengangs und verirrt sich im Strudel des nächsten. Er weiß nicht, wie er den Fluss der Worte aufhalten soll. Einige Fachleute betrachten ADHS als eine vererbte neurophysiologische Dysfunktion, aber meiner Ansicht nach hat eine derartige psychische Erregung eine tiefere Ursache. Remys abschweifendes Redeverhalten ist der Versuch, dem quälenden Unbehagen mit seinem eigenen Selbst zu entkommen.
Der heute fünfunddreißigjährige Remy ist seit seiner Teenagerzeit süchtig. Seine erste Droge war Kokain. Seine Heroinsucht, die er sich im Gefängnis angeeignet hat, wird erfolgreich mit Methadon behandelt, aber seit seiner Entlassung ist er nur selten vom Kokain weggekommen. Nachdem ich bei ihm ADHS diagnostiziert hatte, erklärte er sich bereit, sich vom Kokain fernzuhalten – zumindest vorübergehend, damit wir ihm einen Versuch mit Methylphenidat, besser bekannt unter dem Handelsnamen Ritalin, ermöglichen konnten.
Als er dieses Medikament am ersten Tag einnahm, war er sehr erstaunt. „Ich bin ruhig“, berichtete er. „Mein Verstand rattert nicht wie ein Maschinengewehr los. Ich denke nach, statt gedanklich zu rotieren. Ich werde nicht endlos in zwanzig verschiedene Richtungen getrieben. Ich sage mir: ‚Stopp, immer nur eine Sache nach der anderen machen. Mach einfach langsam.‘„ Ein paar Tage später kommt Remy in meine Praxis. Er ist frei von der aufwühlenden Wirkung des Kokains und spürt die beruhigende Wirkung des Methylphenidats auf die Hyperaktivität seines Gehirns. Er ist in einer nachdenklichen Stimmung und sagt: „Da ist etwas, über das ich mit Ihnen sprechen muss.“
Ich warte. Lange Zeit sagt Remy nichts mehr. Dann: „Ich habe mal einen Typen niedergestochen. Ich war vier Tage lang auf Kokain. Ich fing an, Schnaps zu trinken, ich war völlig fertig. Ich war einfach das Übelste, was man sich vorstellen kann – ich war ein einziger Alptraum!“
„Ich war fast zehn Jahre im Knast. Zehn Jahre. Alles wegen Drogen. Jeden Tag denke ich daran. Jeden Tag, Mann. Jeden Tag … Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen. Ich schüttle es einfach ab, als ob es nichts bedeuten würde. Aber es hat etwas zu bedeuten … Ich habe jemanden ums Leben gebracht, der es nicht verdient hatte zu sterben. Denn ich war vollgepumpt mit Kokain, Pillen und Schnaps …“
Nichts in der medizinischen Ausbildung bereitet einen darauf vor, ein solches Geständnis zu hören. Remy war in meinem Büro und suchte mit Sicherheit Absolution, als wäre er ein Sünder in einem Beichtstuhl und ich ein Priester in Soutane.
„Wir alle haben Momente in unserem Leben, die wir gerne noch einmal leben würden … und noch einmal ändern wollten“, sage ich. „Aber für Sie muss es echt schlimm sein.“
„Wissen Sie, ich erinnere mich an etwas, das meine Mutter einmal zu mir sagte. Sie sagte, um wieder auf die Beine zu kommen, müsste ich anfangen, auf mein Herz zu hören. Und ich fange an, darauf zu hören. Diese Sache, die ich getan habe, diese schreckliche Sache, ist das Einzige, was ich habe. Das ist die Realität, meine Realität. Und ich nehme sie jetzt an.“
„Können Sie sich selbst verzeihen?“
„Ja, das kann ich. Ich weiß nicht wie, aber ich kann mir selbst verzeihen. Seine Familie wird mir allerdings nie verzeihen. Sie wollen mich töten. Aber ich selbst, ja, ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Ich muss mit meinem Leben weitermachen. Ich meine, es wird immer da sein, und ich muss weitermachen und positiv bleiben und mich auf das Leben konzentrieren. Ich muss es tun! Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber ich kann nicht in der Vergangenheit verharren und mich runterziehen lassen. Sonst bin ich am Arsch.“
„Haben Sie jemals mit der Familie Kontakt aufgenommen?“
„Nein. Sie sind sehr, sehr voreingenommen gegenüber Weißen. Ich habe einen von ihnen, einen Ureinwohner getötet, und sie sind sehr, sehr voreingenommen …“
Ich unterdrücke meinen Impuls, ihn darauf hinzuweisen, dass die Trauer und Wut oder sogar die Rachegefühle einer Familie unter solchen Umständen nicht unbedingt etwas mit rassistischem Fanatismus zu tun haben.
„Vergebung ist ein wichtiges Prinzip in der Gemeinschaft der Ureinwohner.“
„Ja, aber nicht für diese. Ich weiß … Deshalb habe ich Saskatchewan verlassen. Sie suchen nach mir.“
„Ich möchte Ihnen etwas vorschlagen.“
„Sie meinen, ich soll einen Brief an mich selbst schreiben, an sie? Ich weiß genau, was Sie sagen werden!“
„Ja, das ist es, was ich sagen wollte. Sehen Sie, Sie hören auf Ihr Herz.“
„Es macht Sinn, nicht wahr“, erwidert Remy enthusiastisch. „Ich könnte es versuchen, nur um zu sehen, wie ich mich dabei fühle. Ich zeigen es Ihnen, und Sie lesen es. Wir reden dann darüber … Ich werde meine Medikamente nehmen. Ich möchte gleich morgen früh damit anfangen. Ich habe darüber nachgedacht – schon als Sie anfingen, wusste ich, was Sie vorschlagen würden. Es könnte mir helfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich denke jeden Tag daran … es ist nicht mein Ding, anderen Menschen das Leben zu nehmen. Wissen Sie, das ist vor elf Jahren passiert.“ Ich habe Remy oft aufgedreht erlebt, aber noch nie so zielstrebig.
Später in derselben Woche kommt Remy wieder in mein Büro und liest seinen Text vor, nervös und triumphierend zugleich. Seine Kaninchenaugen huschen umher, springen von dem Papier, das er mit beiden Händen festhält, zu meinem Gesicht und überprüfen ständig meine Reaktion. Während er spricht, schwankt er und verlagert sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen.
An die Angehörigen,
Sie kennen mich nicht, obwohl der Name auf dem Umschlag Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. Ich bin die Person, die Ihrem Sohn am 14. Mai 1994 das Leben genommen hat.
Der Grund, warum ich Ihnen diesen Brief schreibe, ist, weil ich Sie wissen lassen möchte, dass seit jener tragischen Nacht kein Tag vergangen ist, an dem ich nicht an das denke, was ich getan habe!
Ich erwarte keine Vergebung von Ihrer Familie. Aber ich fühle mich verpflichtet, Ihnen dies zu schreiben, damit Sie wissen, wie sehr es mir leidtut, dass es passiert ist, und dass ich einen großen Fehler gemacht habe.
Dies nagt seit nunmehr 11 Jahren an mir, und ich glaube wirklich nicht, dass die schreckliche Missachtung und Respektlosigkeit, die ich Ihrem Sohn in so jungen Jahren entgegengebracht und angetan habe, indem ich sein Leben im Alter von 19 Jahren zerstörte, jemals meinen Geist verlassen wird.
Ich hoffe, dass der Hass, den Sie vielleicht für mich empfunden haben, nicht mehr so stark ist wie 1994! Aber wenn dem so ist, dann verstehe ich das und kann Ihnen und Ihrer Familie dafür keine negativen Gefühle entgegenbringen.
Es tut mir wirklich unendlich leid, was ich getan habe. Ich trinke keinen Alkohol mehr, schlucke keine Pillen mehr, als gäbe es kein Morgen. Ich nehme kein Heroin mehr, und ich habe endlich das Kokain aufgegeben, das die Wurzel allen Übels ist.
Im Grunde schreibe ich Ihnen, um zu sagen, dass es mir sehr leidtut, was ich Ihnen und Ihrer Familie angetan habe, und ich hoffe, dass Sie eines Tages Frieden finden werden.
Remy hat den Brief nie abgeschickt. Er hat ihn mir als Erinnerung gegeben. Ich wünschte, ich könnte berichten, dass er sich das Kokainmonster erfolgreich vom Leib gehalten hat. Dazu war er nicht in der Lage, und infolgedessen musste ich die Verschreibung von Methylphenidat für ihn einstellen. Seine Absichten scheiterten, als er kurz darauf eine hoffnungslos überdrehte Beziehung zu einer psychisch instabilen Frau einging, die noch stärker vom Kokain abhängig war als er.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.