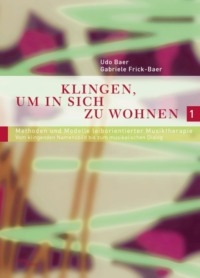Kitabı oku: «Klingen, um in sich zu wohnen 1», sayfa 2
Und noch einige Hinweise: Wir reden in diesem Buch meistens von KlientInnen und meinen damit auch PatientInnen. Wir sehen keine grundsätzlichen Unterscheidungen, die Bezeichnung KlientInnen ist uns lediglich vertrauter und gewohnter.
Zumeist sprechen wir unsere KlientInnen mit „Sie“ an. In unseren Seminaren, Fortbildungsgruppen und Supervisionen ist dagegen das „Du“ üblich. Da wir in diesem Buch auch Beispiele aus diesem Bereich anführen und da wir KlientInnen, die wir in Gruppenbegegnungen geduzt haben, auch in Einzelbegegnungen mit „Du“ ansprechen, verwenden wir in diesem Buch beide Anredeformen. Wenn in den Beispielen von „dem Therapeuten“ bzw. „der Therapeutin“ die Rede ist, so meinen wir uns beide damit. Sollte es sich dabei um eine Kollegin oder einen Kollegen handeln, weisen wir ausdrücklich darauf hin.
Die musiktherapeutische Gruppenarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit, eigenes Erleben gemeinsam mit dem anderer Menschen hörbar werden zu lassen, andere zu beeinflussen und gleichzeitig beeinflusst zu werden. Soll aber innerhalb einer Gruppe das besondere Eigene erklingen, gibt es eine Schwierigkeit: die wunderbare Eigenschaft des Musizierens, andere Menschen zu beeinflussen, kann störend wirken, da die Klänge der anderen die Suche nach dem eigenen musikalischen Ausdruck beeinflussen. Wir beschreiben in diesem Buch Anleitungen, in denen innerhalb einer Gruppenarbeit aufgefordert wird, persönliches Erleben musikalisch auszudrücken. Dies ist nur in Gruppen möglich, die klein sind und deren TeilnehmerInnen in der Lage sind, Klänge anderer zu hören und gleichzeitig Eigenes zu betonen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, muss bei einer Gruppenarbeit der musikalische Ausdruck nacheinander erfolgen.
Ob man unseren Beitrag einer „Richtung“ zuordnen kann, sei dahingestellt und ist uns nicht wichtig. Sicherlich verstehen wir uns als Teil der Strömung humanistischer Psychologie und teilen die meisten von deren Grundannahmen. KollegInnen, die mit uns zusammenarbeiten, bezeichneten die Musiktherapie, die wir vertreten, gelegentlich als „leiborientierte Musiktherapie“, was wir gerne aufgegriffen haben, und verweisen damit v. a. auf unsere leibphilosophischen Quellen. Und sicherlich „atmen“ die vorgestellten Methoden und Praxisbeispiele unsere leibtherapeutischen Grundlagen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Möglichkeiten des leibphänomenologischen Ansatzes für die Therapie fruchtbar zu machen, auch für die Musiktherapie. Und gleichzeitig gilt, dass alle MusiktherapeutInnen, ganz gleich aus welcher „Richtung“ oder „Schule“ sie stammen, die hier vorgestellten Anregungen nutzen können. Zumindest wünschen wir uns das.
Wer noch mehr Zuordnungen sucht: Nimmt man die gängige Unterscheidung zwischen „rezeptiver Musiktherapie“ und „aktiver Musiktherapie“, so ließe sich aus vielen hier vorgestellten Praxisansätzen ein dritter Schwerpunkt, der der „themenzentrierten Musiktherapie“, benennen (s. u. a. Kap. 15). Doch wie dem auch sei: Etiketten erleichtern zwar das Zuordnen und die Orientierung, entscheidend aber ist der Nutzen, den man im Gebrauch des Inhalts gewinnen kann. Diesen Nutzen wünschen wir Ihnen und den Menschen, mit denen Sie arbeiten.
Wir danken Martin Lenz, der die ersten musiktherapeutischen Fortbildungsgruppen innerhalb der Zukunftswerkstatt therapie kreativ geleitet hat und dessen Leidenschaft für die musikalische Improvisation uns Mut gemacht und angestiftet hat. Wir danken Monika Vogel dafür, dass sie in ihrer Lehrtätigkeit auch einen Teil der Pioniertätigkeit geleistet hat, Musiktherapie mit leiborientierter Kunst- und Gestaltungstherapie zusammenzuführen.
Wie so oft hat Susanne Wolters schnell, zuverlässig und engagiert den Hauptteil der Schreibarbeiten übernommen und haben Cosima und Klaus Schneider die Umschlagsgestaltung und Antje Händel aufbauend auf Sabine Bremers Arbeiten zur ersten Auflage kreativ und zügig sowohl die Gestaltung als auch die Produktion des Buches übernommen. Wir danken sehr. Dies gilt auch für Lore Remkes engagierte Lektoratsarbeit.
Viele Kapitel dieses Buches sind in ihrer Rohfassung als Arbeitsmaterialien für die späteren, von uns geleiteten musiktherapeutischen Ausbildungsgruppen entstanden. Wir danken den TeilnehmerInnen der Fortbildungen, den KollegInnen in der Fortbildungsleitung und aus der „Arbeitsgruppe Musiktherapie“ Waltraut Barnowski-Geiser, Eva-Maria Brettschneider und Ralf Hollnack und den MusiktherapeutInnen Marlis Marchand und Lutz Debus sowie – last not least – Martin Lenz für ihre engagierten und kompetenten Rückmeldungen und Anregungen. Herzlichen Dank auch an Prof. Dr. Hans-Helmut Decker-Voigt für die Ermutigung, dieses Buch zu veröffentlichen, und für seine Bereitschaft, trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen ein Vorwort zu verfassen, aus dem ein Essay geworden ist, mit dem er dieses Buch würdigt und in die Musiktherapieentwicklung einordnet. Auch für die zahlreichen Anregungen aus seinen Veröffentlichungen bedanken wir uns bei ihm sowie bei den anderen in diesem Buch zitierten (Musik-)TherapeutInnen. Wir danken allen KlientInnen, bei denen wir, wie Jeffrey Eugenides es in einem Roman ausgedrückt hat, Zeugen werden durften, „wie ein Ich das Ich entdeckte, das es sein konnte“ (Eugenides 2003, S. 472).
1
Wer bin ich? – Musiktherapeutische Wege der Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung
Wer bin ich? – Die Beschäftigung mit dieser Frage zieht sich wie ein roter Faden durch viele therapeutische Prozesse. KlientInnen sind verunsichert in ihrer Selbstwahrnehmung, manches in ihnen und an ihnen erleben sie als fremd, brüchig oder unzusammenhängend. Sie wünschen sich Rückmeldungen, Spiegelungen von uns TherapeutInnen und sie wünschen sich Wege, zu einer stimmigeren und sicheren Selbsteinschätzung zu finden.
Damit verbunden ist die Frage der Selbstwertschätzung. Wer sich nicht selber klar genug wahrnimmt, sich nicht auch den unangenehmen, ungeliebten Seiten wahrhaftig stellt, wird auch unklar in dem sein, was er an sich selbst wertschätzt. Die Selbstwertschätzung vieler KlientInnen wurde durch Beschämungen, Missachtungen und Gewalt erniedrigt oder von Verboten und Tabus überlagert. Wer sich in der Therapie mit sich selbst beschäftigt, landet unweigerlich auch bei der Frage, wie wertvoll er sich selbst einschätzt. Wir werden einige Methoden darstellen, mit denen wir auf musiktherapeutischen Wegen KlientInnen darin unterstützen, sich selber besser kennen zu lernen und zu versuchen, das, was in ihnen kostbar und schätzenswert ist, zu entdecken und mit Zuneigung ernst zu nehmen.
1.1 Das klingende Namensbild
Namen sind wichtig. Namen sind Teil unserer Identität. Mit unserem Namen ist unser Selbstbild verknüpft. In unserem Namen steckt unsere Geschichte. Mit unserem Namen werden wir von anderen Menschen identifiziert. Es liegt also nahe, den Namen zum Klingen zu bringen. Wir wollen ihn, bevor es ans Musizieren geht, zum Ausgangspunkt eines Selbstbildes machen, also ein Namensbild gestalten.
„Aber mit welchem Namen beginne ich?“, fragen sich viele KlientInnen. „Ist es mein Vorname oder mein Nachname? Nehme ich den Namen meiner Eltern oder lehne ich diesen ab? Ist es der Name, der Doppelname oder der Name meines Partners oder meiner Partnerin, den ich in der Ehe angenommen habe?“ Und dann fallen ihnen Schimpfnamen ein, Kosenamen oder Spitznamen. Jeder Name hat eine Geschichte und eine Bedeutung. Zu jedem Namen werden Geschichten assoziiert, angenehme und unangenehme, liebevolle und beschämende. Den Namen zu präsentieren, bedeutet, sich zu präsentieren, sich vorzustellen. „Ich heiße“, meint immer auch: „Ich bin“.
Zur Erstellung des Namensbildes geben wir folgende Anregungen:
„Wählen Sie einen Namen aus. Sie haben zwar einen offiziellen Namen, aber Sie haben sicher noch viele Namen darüber hinaus. Sie können Ihren Vornamen nehmen oder Ihren Nachnamen, Ihren Geburtsnamen oder Ihren Spitznamen oder einen Kosenamen, vielleicht sogar ihren Wunschnamen. Wählen Sie den Namen aus, der Ihnen jetzt am ehesten in den Sinn kommt, der Ihnen jetzt wichtig ist und Sie vielleicht auch neugierig macht.“
„Nehmen Sie einen Stift, Ölkreide oder Pastellkreide in der Farbe Ihrer Wahl in die Hand und ein großes Blatt Papier und schreiben oder malen Sie Ihren Namen auf das Blatt.“
„Betrachten Sie nun Ihren Namen und malen Sie das Bild weiter, lassen Sie aus Ihrem Namen ein Namensbild entstehen. Vielleicht braucht Ihr Name eine Umgebung, vielleicht regen der Schriftzug oder einzelne Buchstaben zur Gestaltung von Figuren, Landschaften, Personen, Fabelwesen usw. an. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.“
Nun soll dieses Namensbild zum Klingen gebracht werden:
„Befestigen Sie Ihr Bild an der Wand oder legen Sie es irgendwo auf den Boden, wo Sie es gut betrachten können. Schauen Sie es sich an, lassen Sie es auf sich wirken. Nehmen Sie wahr, welche Empfindungen, Gedanken und Gefühle es auslöst, und dann holen Sie sich ein Instrument – Sie können auch Ihre Stimme benutzen – und behandeln Sie Ihr Namensbild wie eine Partitur. Lassen Sie Ihr Namensbild erklingen …“
Je nach Namensbild, je nach den Empfindungen beim Betrachten, je nachdem, was die Beschäftigung mit dem Namen, dem Malen und dem Sinnieren darüber ausgelöst hat, entstehen Klänge unterschiedlicher Art und Weise. Manche finden nach einigem Experimentieren und Suchen ein Namens-„Thema“, so, wie es bei Wagner das „Tristan-Thema“ oder das „Isolde-Thema“ gibt. Andere spielen eher Gefühle oder Stimmungen, die die Beschäftigung mit dem Namen hervorgerufen hat. Wieder andere sind angetan von dem, was sie an Neuem oder Vielfältigem in sich und auf dem Bild entdecken, und improvisieren, indem sie Töne, Klänge, Melodien, Rhythmen erklingen lassen.
Danach gilt es, den KlientInnen eine Möglichkeit zu verschaffen, Echos auf ihr klingendes Namensbild zu erhalten. In der Einzeltherapie geben der Therapeut oder die Therapeutin die Rückmeldung, in der Gruppe zusätzlich andere TeilnehmerInnen. Die KlientInnen spielen die Klänge ihres Namens anderen vor, zeigen vielleicht auch noch ihr Bild, erzählen etwas darüber und erhalten Echos: Wie hat es sich angehört, was wurde beim Hören und Schauen gefühlt, was ist aufgefallen? usw. Die Rückmeldung kann in Worten erfolgen oder musikalisch. Das Selbstbild eines Menschen ist immer auch ein Fremdbild. Wir Menschen brauchen die Rückmeldungen anderer, um zu wissen, wer wir sind. Wir brauchen ehrliche Rückmeldungen, wohlwollende, auch kritische, aber keine niedermachenden oder verachtenden. Die bloße Gegenüberstellung von Selbstbild und Fremdbild ist unfruchtbar. Das Selbstbild erwächst aus dem Gemisch von Selbstwahrnehmungen und Rückmeldungen anderer Menschen. Es geht eher darum, zwischen den Fremdbildern zu differenzieren, Menschen darin zu unterstützen, aus den Rückmeldungen, die sie erhalten, diejenigen auszuwählen, die sie akzeptieren und integrieren können, und den Mut und die Kraft zu gewinnen, andere abzulehnen. Deswegen ist der gegenseitige Austausch über das klingende Namensbild so wesentlich. Und dann kann es sehr bewegend und hilfreich sein, noch einmal das Namensbild erklingen zu lassen, um diesen Prozess der Differenzierung musikalisch zu unterstützen und all das zu spielen oder zu singen und zu hören, was sich davon im Selbstbild verankern kann.
Es besteht auch die Möglichkeit, den eigenen Namen unmittelbar zu vertonen. Dies hat sich aber für den Erlebensprozess als nicht so fruchtbar herausgestellt wie der beschriebene Weg. Bei einer unmittelbaren Vertonung sind häufig die Hemmungen größer und viele Menschen neigen dazu, nach formalen künstlerischen Tricks zu suchen, so, wie Bach sein B-A-C-H vertont hat. Doch wer kann das schon wie Bach! Häufig führen solche Bestrebungen zu Kopfknoten, die den Erlebensprozess bremsen oder gar nicht erst in Gang kommen lassen. Das Malen schafft Zeit und Raum für die vielfältigen Erinnerungen, Geschichten, Assoziationen, die mit dem eigenen Namen verbunden sind, und lässt das in den Vordergrund treten, was im Moment besonders wichtig ist. Und die Namensbild-Partitur bleibt erhalten; der musikalische Moment ist nicht ganz so flüchtig. Sie kann später wieder vertont werden, vielleicht ähnlich, vielleicht aber auch, z. B. durch Perspektivwechsel, indem man sie auf den Kopf stellt, neu – und damit der Entwicklung, der Veränderung, dem Überraschenden einen klingenden Spielraum gebend.
1.2 Die sechs Kostbarkeiten
Beginnen wir mit einem Beispiel:
Eine Klientin leidet an Entscheidungsschwäche. Immer wenn sie Entscheidungen treffen muss, große oder kleine, gerät sie ins Schwanken, wird unsicher, weiß nicht, was sie tun, in welche Richtung sie sich bewegen soll. In der Therapie hat sie dieses und jenes versucht, sie kennt auch die Quellen und Gründe ihrer Entscheidungsunsicherheit – aber es ändert sich wenig.
An der Entscheidungsfindung zu arbeiten, was für viele KlientInnen ein wichtiger Ansatz ist, hilft ihr nicht weiter, da ihre Entscheidungsunsicherheit in einer tiefgreifenden Verunsicherung ihres Selbstbildes begründet ist. Wenn andere Menschen ihr Positives zurückmelden, nimmt sie das einen Moment zur Kenntnis und lässt es dann von sich abperlen – wie von einer Teflonplatte. Sie nimmt positive Rückmeldungen nicht in sich hinein.
Zu tief und zu selbstverständlich hat sie die von ihren Großeltern oft geäußerte Haltung übernommen, dass sie nichts wert sei, dass sie letzten Endes genauso „schlecht“ sei wie ihre früh verstorbene Mutter oder wie ihr Vater, der „Tunichtgut“.
Therapeut und Klientin suchen gemeinsam nach Wegen, auf denen sie lernen könnte, sich selbst wertzuschätzen.
In einer Stunde schlägt der Therapeut vor: „Ich möchte Sie heute bitten, mich zu einem Besuch in ein chinesisches Restaurant einzuladen. Dort werden wir auf die ‚sechs Kostbarkeiten’, die auf der Speisekarte angeboten werden, aufmerksam. Die sechs Kostbarkeiten vereinen das beste, was das Restaurant zu bieten hat. Ich bitte Sie, nun zu überlegen, welche sechs Kostbarkeiten Sie haben, was Sie an sich und in sich kostbar finden.“ Die Klientin schreckt zurück und meint, dass sie doch nie sechs Kostbarkeiten finden könne.
Der Therapeut: „Auch im chinesischen Restaurant wird jede Kostbarkeit nacheinander serviert. Beginnen Sie mit einer Kostbarkeit, beginnen Sie mit einer Eigenschaft, Tätigkeit, Kompetenz, was auch immer, mit einem Aspekt Ihrer Lebendigkeit, die Sie an sich schätzen, die Sie an sich für kostbar halten.“
Die Klientin überlegt: „Vielleicht, dass ich mit mir so ehrlich bin. Und auch anderen gegenüber. Ich will mir und anderen nichts vormachen … Ja: meine Ehrlichkeit.“
„Wunderbar, die erste Kostbarkeit haben Sie schon gefunden. In chinesischen Restaurants ist es nun so, dass weiter hinten in der Speisekarte, dort, wo die sechs Kostbarkeiten zu finden sind, zumeist auch ein Farbfoto der sechs Kostbarkeiten abgebildet ist, damit sie sichtbar sind und bemerkt werden. Für unsere menschlichen Kostbarkeiten gilt Ähnliches. Der erste Schritt besteht darin, sie überhaupt wahrzunehmen, sie zu registrieren und sie ernst zu nehmen. Der zweite Schritt darin, sie kund zu tun, öffentlich zu machen, sichtbar und hörbar werden zu lassen. Ich bitte Sie nun, ein Instrument auszusuchen und ihre Kostbarkeit, die Ehrlichkeit, auf irgendeine Art und Weise erklingen zu lassen.“ Die Klientin äußert zuerst wieder ihre Unsicherheit, blickt sich dabei aber schon suchend unter den Musikinstrumenten um. Sie probiert ein Xylofon, probiert eine Trommel, probiert eine Zither, dann das Balafon und wieder die Zither und schaut den Therapeuten fragend an: „Ich weiß nicht, wie ich die Ehrlichkeit darstellen soll?“
„Ich weiß es auch nicht. Es ist Ihre Ehrlichkeit, Ihre Kostbarkeit. Probieren Sie aus und nehmen Sie den Ton oder die Klänge, die kostbar klingen, die ehrlich klingen.“
Sie greift zum Balafon, probiert einige Töne aus und wählt zwei Töne, wiederholt sie mehrmals und sieht auf: „Diese Töne sind es!“
Und so geht es weiter: Eine Kostbarkeit nach der anderen entdeckt die Klientin, immer nach Phasen der Unsicherheit und des Zögerns. Und eine Kostbarkeit nach der anderen bringt sie zum Klingen, auf jeweils unterschiedlichen Instrumenten, mit jeweils unterschiedlichen Klang- und Tonfolgen. Am Ende ist sie aufgeregt und erstaunt, glücklich darüber, so viel gefunden zu haben, was sie an Kostbarem hat, was sie an sich schätzt. Sie strahlt und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie ist freudig erregt und gleichzeitig traurig darüber, dass ihre Selbstwertschätzung so lange mit Füßen getreten wurde.
Zum Abschluss schenkt der Therapeut der Klientin – um im Bild zu bleiben: als Nachtisch – eine siebte Kostbarkeit: Ihre zarte und langsam wachsende Achtsamkeit für ihre Gefühle, die in der Therapie allmählich erblühte. Diese Kostbarkeit ist noch so neu und klein, dass sie der Klientin selbst nicht einfiel, deswegen der „Nachtisch“. Und er spielt ihr diese siebte Kostbarkeit vor: eine leise Melodie auf der C-Flöte.
Das Erklingen der sechs Kostbarkeiten dient der Selbstwertschätzung. Diese Einheit ist immer dann angesagt, wenn es gilt, die Selbstwertschätzung zu stärken oder über ihr Gewahrwerden einen inneren Boden für den weiteren therapeutischen Prozess zu schaffen. Manchmal liegt ein Thema in der Luft und eine Klientin oder ein Klient traut sich nicht daran – dann kann die Arbeit mit den sechs Kostbarkeiten einen Boden schaffen, der Selbstsicherheit verstärkt und damit den Mut, neue Wege zu beschreiten und unbekanntes Terrain des Erlebens zu erkunden. Manchen KlientInnen schlagen wir vor, alle Kostbarkeiten nacheinander zu spielen. Sie hören dann ihre persönliche Klangwelt: So klinge ich, so bin ich.
Es kommt bei dieser Arbeit nicht so sehr darauf an, welche Kostbarkeiten die Menschen entdecken und zum Klingen bringen. Häufig fallen ihnen im Nachklang einige Stunden oder Tage später noch weitere Kostbarkeiten ein. Wichtig ist der Erfahrungsprozess, wichtig ist, dass sie selbst auf die Suche gehen und dass sie ihre Selbstwertschätzung nicht nur für sich behalten, sondern auch hörbar machen. Dabei tauchen Schwierigkeiten auf, die den Prozess beeinträchtigen, manchmal auch unterbrechen können. Da kann die Angst auftauchen und gefragt werden: „Wie klingt die Angst?“ Da kann die Scham die Kostbarkeiten verschleiern und die Sprache verstummen lassen, so dass es gilt, sich gegen die Beschämung abzusichern und einen Weg zu finden, durch die Scham hindurch den eigenen Kostbarkeiten zu begegnen. Da wird bei der Entdeckung neuer Wege auch die Trauer wach, die Trauer darüber, dass diese Wege so lange versperrt waren.
Ein Klient wiederholte bei jeder Kostbarkeit den gleichen Ablauf. Er äußerte eine seiner Eigenschaften positiv, stellte sie im zweiten Satz in Zweifel und wertete sie im dritten Satz ab, als „eigentlich nichts Besonderes“ oder „doch eher negativ“. Als der Therapeut ihm dies spiegelte, war ihm sofort klar: „Das ist mein Vater, der aus mir spricht. Alles schlecht machen, alles abwerten, kein Lob, kein Kompliment stehen lassen.“ Dies erkennend gelang es ihm erfolgreich, seine Selbstwertschätzungen ernst zu nehmen und anzunehmen.
Eine Klientin nannte zügig und problemlos die erste, die zweite, schließlich die dritte Kostbarkeit und ließ sie erklingen. Alle drei Kostbarkeiten bezogen sich auf Fähigkeiten, die sie in ihrem beruflichen Leben gut nutzen und zum Tragen bringen konnte. Die Therapeutin fragte sie, ob sie denn auch Kostbarkeiten kenne, die in ihrem privaten Leben lebendig sind. Die Klientin lachte: „Das ist mal wieder typisch für mich, alles dreht sich um die Arbeit und das Private kommt zu kurz …“ Hier nun bekam es Wert.
Das Erklingenlassen der Kostbarkeiten macht erstaunlicherweise (oder vielleicht auch nicht) den meisten KlientInnen weniger Probleme als das Finden und Aussprechen dessen, was sie an sich wertschätzen. Ist es einmal benannt, gibt es zwar Unsicherheit, Suchen und Ausprobieren, bis die passenden Klänge gefunden sind, doch fast immer gelingt dieser Prozess, ohne dass weitere Hilfestellungen durch die Therapeutin oder den Therapeuten notwendig sind.
Manchmal scheint die Aufgabe, kostbare Eigenheiten zu finden, unlösbar zu sein. Dann hilft es, sich auf den umgekehrten Weg zu begeben – zuerst erklingen lassen, dann benennen.
Ein Klient war gerade so in seiner Selbstabwertung verfangen, dass er auf die Frage der Therapeutin nach seinen Kostbarkeiten nur mit tiefer Hilflosigkeit und Traurigkeit reagieren konnte. „Kostbarkeiten? Was soll an mir schon kostbar sein!“ „Ich weiß Einiges, was ich an Ihnen kostbar finde und ich bin sicher, Sie werden auch etwas finden. Aber vergessen Sie meinen Vorschlag erst einmal und suchen Sie sich bitte aus all den Instrumenten, die hier stehen, sechs aus, die gerade jetzt Ihre Aufmerksamkeit erregen. Fragen Sie nicht, wieso warum gerade die, grübeln Sie nicht zu lange, sondern vertrauen Sie Ihren Impulsen … Geben Sie diesen Instrumenten ihren jeweiligen Platz im Raum … Und nun lassen Sie eins davon erklingen … Was hören Sie? Was geht Ihnen durch den Sinn? Welche Eigenschaft, die Sie an sich schätzen, könnte das gerade gewesen sein? Welche Kostbarkeit?“ Auf die Art und Weise erspielte sich der Klient nach und nach einige Kostbarkeiten, erhörte sich selbst: auf der Trommel seine Gradlinigkeit und berufliche Kompetenz, auf dem Gong seine Fähigkeit, seine Kinder um Entschuldigung für manche Zumutungen zu bitten, auf der Kalimba seine Liebe und Zärtlichkeit für seine Familie, auf der Rassel seine offensive Verteidigungs- und Schutzbereitschaft für manche andere, auf dem Klavier seine Kreativität, auf der Mundharmonika seine Intelligenz und Neugier. Auf Nachfrage bestätigte er: Er empfand sich nicht „zur Selbstwertschätzung manipuliert“, diese Kostbarkeiten nicht als „aufgesetzt“, sondern als wahrhaftige Entdeckungen seiner ihm eigenen Wesenszüge – ein guter Boden für die therapeutische Weiterarbeit.
Die Kostbarkeiten zum Erklingen zu bringen, impliziert, dass sie auf eine besondere, intime Art hörbar werden. Dieses Hörbar-werden-Lassen bedarf der Resonanz, bedarf der Antwort, bedarf der wertschätzenden und gleichzeitig ehrlichen Rückmeldung, da sonst die Scham als Nach-Scham auch in Bezug auf diese Therapieeinheit die KlientInnen ergreifen kann.
Eine siebte Kostbarkeit von uns als Therapeutin oder Therapeut den KlientInnen mitzuteilen und musizierend zu Gehör zu bringen, machen wir nur in Ausnahmefällen. Wir bieten dies immer dann an, wenn eine Klientin oder ein Klient eine für uns sichtbare und bedeutsame Eigenschaft, Fähigkeit „überhört“, die aber für sie bzw. für den therapeutischen Prozess eine besondere Bedeutung hat.
Und noch ein letzter Hinweis: Das Entdecken, Aussprechen und Erklingenlassen der sechs Kostbarkeiten braucht Zeit, in der Regel eine halbe bis eine dreiviertel Stunde, manchmal sogar länger, in der Einzeltherapie möglicherweise mehrere Stunden. In der Arbeit mit Gruppen bitten wir die GruppenteilnehmerInnen, diese Kostbarkeiten in Kleingruppen zu finden, auszusprechen und erklingen zu lassen, und fordern die anderen TeilnehmerInnen der Kleingruppen auf, zu den jeweiligen Kostbarkeiten Rückmeldungen zu geben. Dies braucht, da alle TeilnehmerInnen ihre Kostbarkeiten finden sollen, entsprechend mehr Zeit, so dass wir häufig die Anzahl der Kostbarkeiten für jede und jeden auf drei oder vier beschränken. In der Einzelarbeit sollte in jedem Fall versucht werden, sechs Kostbarkeiten zu finden. Gerade unter den letzten benannten Kostbarkeiten finden sich oft besondere Schätze, die sonst eher im Verborgenen bleiben würden.