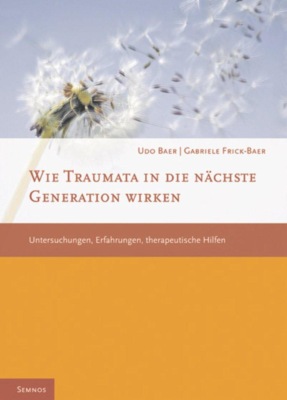Kitabı oku: «Wie Traumata in die nächste Generation wirken», sayfa 2
2 Was Therapeut/innen über Traumata wissen müssen
Trauma heißt Wunde. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen und wurde ursprünglich in der Medizin als Begriff für schwere körperliche Verletzungen mit schockartigen Folgen eingeführt. In der Psychologie und Psychotherapie wurde die Bezeichnung schließlich auf schwere seelische Verletzungen erweitert.
Um zu verstehen, wie Traumata in die nächste Generation weitergegeben werden, müssen wir wissen, was ein Trauma ist und welche Folgen es haben kann.
Wir wollen die Grundlagen, die für ein Traumaverständnis notwendig sind, hier vorstellen und verweisen auf ausführliche Darstellungen in der Literatur, z.B. Herman 1994/2007, Fischer/Riedesser 2004, Frick-Baer 2009. Dabei ist uns wichtig, unser Traumaverständnis möglichst klar zu definieren. Es gibt gelegentlich Tendenzen, den Traumabegriff inflationär zu benutzen und auf jedes belastende Ereignis anzuwenden. Daran wollen wir uns nicht beteiligen, weil damit der Traumabegriff seinen Wert in Diagnostik und Therapie verliert bzw. zumindest verlieren kann. In diesem Buch geht es nicht darum, was Eltern oder Elternteile allgemein an Belastungen, Kränkungen oder Störungen an ihre Kinder weitergeben, sondern um einen Teil davon, einen bestimmten Aspekt, nämlich das Trauma und dessen transgenerative Weitergabe.
Begrifflich hat es sich dabei für uns als sinnvoll herausgestellt, verschiedene Aspekte zu unterscheiden, die in der Sammelbezeichnung „Trauma“ enthalten sind. Diese sind:
» das Traumaereignis,
» das Traumaerleben, also die Art und Weise, wie ein Mensch sich und seine Welt vor, während und unmittelbar nach dem Traumaereignis erlebt,
» die Traumabewältigung, also die Art und Weise, wie der Mensch kurz- und langfristig sein Traumaerleben bewältigt,
» die Traumafolgen, also die Folgen des Traumaerlebens und der Traumabewältigung.
Betrachten wir diese vier Aspekte genauer.
Jedes Trauma beginnt mit einem Traumaereignis. Traumaereignisse können sehr unterschiedlich sein. Menschen kämpfen als Soldaten im Krieg oder werden als Zivilisten bombardiert, andere werden überfallen, ausgeraubt oder vergewaltigt. Kinder und Jugendliche werden sexuell missbraucht, andere erleben einen Tsunami, ein Erdbeben oder einen Verkehrsunfall. Ein Lokführer überfährt einen Selbstmörder mit seinem Zug, ein anderer sieht zu, wie ein Mensch ertrinkt, ohne dass er helfen kann. So unterschiedlich die Ereignisse sein können, die ein Trauma hervorrufen, so ist ihnen doch gemeinsam, dass die beteiligten Menschen sich durch dieses Ereignis existenziell bedroht und erschüttert fühlen. Das Ereignis macht noch kein Trauma aus, sondern die Qualität des Erlebens eines Ereignisses. Traumaereignisse sind Ereignisse, die Menschen als existenziell bedrohlich erleben und durch die sie in ihren Grundfesten erschüttert werden.
Zum Traumaereignis gehört allerdings auch die Zeit unmittelbar danach – nach der Vergewaltigung, nach dem Unfall, nach dem Unglück. Wir haben in unseren Therapien immer wieder erfahren, dass die „Zeit danach“ zum Traumaereignis hinzuzuzählen ist. Zur Zeit laufende Studien haben dies bestätigt (Frick-Baer i.V.). Die Art und Weise, wie der Beteiligte an einem schweren Verkehrsunfall unmittelbar danach behandelt wird, kann das Erleben abmildern oder vertiefen. Ob ein Kind nach der Erfahrung eines sexuellen Missbrauchs beschämt, beschuldigt oder im Folgenden allein gelassen wird oder ob es Halt, Parteilichkeit und Trost erfährt, bestimmt das Erleben und die Bewältigungsmöglichkeit des Traumas im wesentlichen Maße. Uns ist deshalb wichtig, die Zeit „unmittelbar danach“ zum Traumaereignis zu zählen und entsprechend in Therapie und Begleitung zu würdigen.
Schon bei der Beschreibung des Traumaereignisses haben wir das Traumaerleben erwähnt. Die Art und Weise, wie ein Mensch sich und das traumatische Ereignis erlebt, muss mit einbezogen werden, um ein Ereignis als ein Traumaereignis zu identifizieren. Jede traumatische Erfahrung wird als Ohnmachtsgefühl erlebt. Die Betroffenen sind anderen Menschen, dem Krieg, der Gewalt, der Natur usw. ausgeliefert. Dies erschüttert bei vielen Menschen die Gewissheit, wirksam zu sein, und beeinträchtigt damit oft das Selbstwertgefühl. Dies erschüttert auch die Illusion unserer Unverletzlichkeit, der wir Menschen uns im Alltag so gerne hingeben. Bei den meisten traumatischen Erfahrungen werden die Schutzgrenzen, die die Intimität und Persönlichkeit bewahren, durchbrochen, insbesondere bei sexueller Gewalt. Zumeist ist zudem eine traumatische Erfahrung ein Beziehungserleben. Bei Überfällen, sexueller Gewalt etwa sind andere Menschen unmittelbar beteiligt, ebenso bei Kriegserfahrungen, Flucht, Vertreibung usw. Auch bei Verkehrsunfällen und Naturkatastrophen gibt es immer andere Opfer und sind andere Menschen „in der Zeit danach“ Teil der traumatischen Erfahrung, helfen und vermindern oder vergrößern die Not.
All diese Aspekte führen dazu, dass wir sagen: Ein Trauma ist in erster Linie ein Erlebensprozess und ein Beziehungsprozess.
Für den erlebenden Menschen hat die phänomenologische Philosophie den Begriff „Leib“ geprägt. Leib stammt aus dem indogermanischen „lib“ und bedeutet „lebendig“. Mit „Leib“ bezeichnen wir den sich und seine Welt erlebenden Menschen. (Deswegen bezeichnen wir auch unseren therapeutischen Ansatz als „Kreative Leibtherapie“ bzw. hier als „Leiborientierte Kreative Traumatherapie“. Doch dazu später.)
Das Trauma ist also ein leiblicher Prozess. Dieser Erlebensprozess vollzieht sich auch als biologisch-neuronaler Prozess im Gehirn. Im Gehirn ist ein Mechanismus eingebaut, der das Überleben der Menschen in existenziell bedrohlichen Situationen sichern soll. Ein bestimmtes neuronales Teilsystem, die Amygdala, überprüft alle im Gehirn eingehenden Informationen daraufhin, ob sie potenziell bedrohlich sein können. Früher konnte dies das Brüllen eines Säbelzahntigers sein, heute sind es die vielfältigen anderen Elemente der erwähnten Traumaereignisse. Wird eine Information als Anzeichen für eine möglicherweise existenziell bedrohliche Situation eingestuft, tritt ein Notfallprogramm in Gang. Dies betrifft den gesamten Körper vom Denken bis zum Blutdruck. Im vegetativen Nervensystem wird ein Alarm-Stress-Modus aktiviert, um gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen oder vor ihm zu fliehen.
Doch bei den meisten traumatischen Ereignissen gibt es kaum Möglichkeiten, zu kämpfen oder zu fliehen, das traumatische Erleben eint das Merkmal der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Deswegen bleiben viele Opfer traumatischer Erfahrungen in der Ohnmacht erstarrt und die Hochspannung und Hocherregung kann sich nicht oder nicht vollständig abbauen.
Diese Reaktionen und damit ein traumatisches Erleben erleiden Menschen auch dann, wenn sie nicht unmittelbar betroffen, sondern nur mittelbar Zeugen eines Ereignisses sind. Wer bei einer Vergewaltigung, einem Unfall oder einem anderen traumatischen Ereignis zusieht, besonders als Kind, das die Tatsache und seine Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit noch nicht einzuordnen weiß, kann genauso traumatisiert sein wie die unmittelbar Beteiligten.
Zu dieser biologisch-neuronalen Notfallreaktion gehört auch, dass die Teile des Gehirns, die für die kognitive Verarbeitung und Erinnerung des existenziell bedrohlichen Ereignisses zuständig sind, in einen Sparmodus gehen. Sie werden nicht gebraucht, um unmittelbar gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen oder vor ihm zu fliehen, deswegen werden sie als zweitrangig behandelt. Dies führt dazu, dass die kognitiven Erinnerungen an traumatische Ereignisse oft lückenhaft, manchmal sogar gar nicht vorhanden sind, während der leibliche Modus des Erinnerns, das Leibgedächtnis, weiter die Erinnerung an das traumatische Ereignis aufrechterhält. „Ist die Erinnerung an die traumatische Situation verloren oder fragmentiert, so repräsentieren traumatische Reaktionen bzw. Prozesse diese Erfahrung als implizite Erinnerung, auf der Ebene des Körpergedächtnisses.“ (Fischer/Riedesser 2004, S.119)
Wir ziehen aus der Analyse des Traumas als Erlebensprozess die Konsequenz, dass auch Hilfen bei der Traumabewältigung sich nicht auf rein verbale und kognitive Interventionen beschränken dürfen, sondern leibliche Prozesse, die auch das Leibgedächtnis ansprechen und verändern helfen, beinhalten müssen. Doch dazu ebenfalls später.
Wird das Erleben eines Traumas unaushaltbar, können Menschen im Interesse ihres psychischen Überlebens dieses Ereignis oder manche Aspekte dieses Erlebens dissoziieren. Eine Dissoziation ist mehr als ein Vergessen, sie ist ein weitgehendes Auslöschen von Erinnerungen und damit verbundenen Erlebensqualitäten, an deren Stelle eine Leere tritt. Doch nicht alles ist „verschwunden“: Die Leerstelle ist spürbar und es gibt häufig Phänomene, die auf das Traumaereignis hinweisen, aber von den Betroffenen mit dem Dissoziierten nicht in Verbindung gebracht werden. Für den Romanhelden Austerlitz in W. G. Sebalds gleichnamigem Roman war der Verlust seiner Eltern und seiner Heimat ein traumatisches Ereignis. Seine Eltern hatten ihn als jüdischen Jungen 1937 im Rahmen eines Hilfsprogramms nach England geschickt, damit er dort vor den Nazis in Sicherheit sei.
Diese Erfahrung hatte der Junge dissoziiert, doch wie es in jeder Dunkelheit einen kleinen Lichtspalt geben kann, so gab es auch hier Phänomene, die die innere Verbindung zu diesem traumatischen Ereignis aufrecht erhielten. Austerlitz verband den Schrecken seines Heimat- und Elternverlustes unbewusst mit dem Bahnhof, auf dem er in England eintraf. Auch an diesen Schrecken erinnerte er sich nicht mehr, aber er studierte Zeit seines Lebens Bahnhöfe, war fasziniert von deren Architektur usw.
Zum Traumabegriff gehört auch der Aspekt der Traumabewältigung. Manche Menschen, die einen Unfall erlebt haben, sind davon erschüttert, steigen aber wieder ins Auto und bewältigen allmählich den Schrecken des Ereignisses. Andere können nie wieder mit einem Auto fahren und leiden jahre- oder jahrzehntelang unter den Folgen. Das Gleiche gilt für Lokomotivführer, die mit ihrem Zug einen Menschen überfahren haben. Auch wenn ihr Verstand sagt, dass sie nichts dafür konnten, ja dass die Opfer sterben wollten, so können viele von ihnen nie wieder einen Zug besteigen und schrecken jahrzehntelang nachts mit Bildern dieses Ereignisses aus dem Schlaf auf. Andere können das gleiche Ereignis aus welchen Gründen auch immer in relativ kurzer Zeit verarbeiten und ihrem Beruf weiter nachgehen. Ob ein Traumaereignis zu einem Trauma mit nachhaltigen Folgen wird, hängt also nicht nur davon ab, wie es erlebt wird, sondern auch davon, wie die Bewältigungsmöglichkeiten sind. „Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden.“ (Fischer/Riedesser 1999, S.19)
Ein Trauma beinhaltet folglich immer auch die Diskrepanz zwischen dem Erleben eines traumatischen Ereignisses und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Wie groß diese Diskrepanz ist, hängt zum einen von der Schwere und der Dauer der existenziellen Bedrohung durch das traumatische Ereignis ab. Bei bestimmten Qualen, wie Folter oder sequenzielle, sich häufig wiederholende sexuelle Gewalt, reichen keine menschlich vorstellbaren Bewältigungsmöglichkeiten aus, um anhaltende Schädigungen zu vermeiden. Die Art und Weise der Traumabewältigung hängt zum anderen auch von der „Zeit danach“ ab, davon, ob Menschen Schutz, Trost und Verständnis finden oder ob sie allein gelassen oder gar beschuldigt werden und im Schweigen erstarren (müssen). Auch das Befinden vor dem traumatischen Ereignis ist wichtig.
Jemand, dessen Identität geschwächt und brüchig ist, der von Selbstzweifeln angefüllt ist und sich einsam und unbeachtet erlebt, wird wahrscheinlich nach einem traumatischen Ereignis weniger heilungsfördernde Bewältigungsstrategien zur Verfügung haben (können) als ein Mensch, der sich in seiner Identität als gefestigt und in sozialen Beziehungen aufgehoben fühlt.
Und schließlich gehören zum Traumabegriff auch die Traumafolgen. Einige dieser Folgen haben wir schon erwähnt, vor allem die Erschütterungen von Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl. Wer in seinem Beziehungsvertrauen z. B. durch eine Gewalterfahrung tief verletzt wurde, wird in Zukunft zumeist misstrauischer an neue Beziehungen herangehen als jemand, der diese Erfahrungen nicht gemacht hat. Wenn einem Menschen eine traumatische Erfahrung widerfahren ist, wird das Leibgedächtnis über den beschriebenen neuro-biologischen Alarmprozess besonders geschärft, um alle Anzeichen für eine mögliche Wiederholung dieses existenziell bedrohlichen Ereignisses zu erkennen. Wer als Kind Bombardierungen erlebt hat, wird auch im hohen Alter zusammenschrecken, wenn er das Grollen eines Gewitterdonners hört. Die Amygdala aktiviert über das Leibgedächtnis alle Warnsignale. Solche Auslöser für ein traumatisches Wiedererleben werden „Trigger“ genannt.
Manche langfristigen Auswirkungen eines Traumas können sich verfestigen und die Betroffenen Jahre und jahrzehntelang begleiten. Bei einer bestimmten Kombination solcher Symptome gibt es den diagnostischen Begriff des „Posttraumatischen Stresssyndroms“. Mit ihm werden wir uns im nächsten Kapitel beschäftigen und der Frage nachgehen, ob und wie einzelne oder mehrere Symptome eines Posttraumatischen Stresssyndroms oder anderer Traumafolgen der ersten Generation sich auch bei der zweiten Generation zeigen können.
3 Die erste und die zweite Generation: Gemeinsamkeiten
3.1 Das Leiden und das Posttraumatische Stresssyndrom
Das Posttraumatische Stresssyndrom beschreibt ein gleichzeitiges Eintreffen mehrerer Symptome, die sich bei zahlreichen Menschen, die traumatische Erfahrungen erlitten haben, verfestigen und unter denen sie leiden. Das Leiden, eine subjektive und individuelle Kategorie, ist ein wesentlicher Aspekt. Man hat bei größeren Untersuchungen mit Kindern von Holocaust-Überlebenden festgestellt, dass nicht alle unter den Folgen des Holocaust, nicht alle unter den dramatischen Erfahrungen ihrer Eltern leiden, sondern dass es zwei Gruppen gibt. Eine Gruppe bezeichnet sich als halbwegs stabil und normal, eine andere zeigt pathologische Folgen und leidet sehr stark. Das bedeutet, dass die Untersuchungen und Beschreibungen einzelner Betroffener, meist Therapiepatient/innen, nicht unbedingt für alle zu verallgemeinern sind. Wenn wir hier davon reden, dass Menschen unter traumatischen Erfahrungen gelitten und diese an die nächste Generation weitergegeben haben, dann meinen wir die Menschen, die unter diesen traumatischen Erfahrungen leiden und dies in der Regel langfristig. Das sind nach dem Ergebnis der oben erwähnten Befragungen nicht 100 Prozent der Betroffenen.
Wir wissen aber, dass es noch eine dritte Gruppe gibt: Die Gruppe derjenigen, bei denen die Frage, ob sie leiden oder nicht, nicht eindeutig zu beantworten ist. Dazu zählen die Menschen, bei denen äußerlich alles normal scheint, in denen aber innerlich „eine Hölle“ tobt, wie eine Klientin in der vertrauensvollen Atmosphäre der therapeutischen Situation sagte. Sie würden nie in einem Interview oder in einem Fragebogen diese Diskrepanz zwischen innen und außen zugeben – da ist die Scham zu groß.
Bei unseren Befragungen waren zwei Menschen dabei, die von traumatischen Erfahrungen ihrer Eltern bzw. eines Elternteils erzählten und berichteten, dass sie diese gut verarbeitet hätten und auf keinen Fall unter den Folgen leiden würden. Wir beendeten infolgedessen das Interview zu diesem Thema und fragten gleichsam als Ausklang, ob es sonst Erzählenswertes aus ihrem Leben gäbe. Eine der Befragten (I 14), deren Mutter sexuelle Gewalt erfahren hatte, arbeitete in einer Einrichtung der Jugendhilfe in einem sozialen Brennpunkt mit jugendlichen Opfern sexueller Gewalt. Sie hatte mindestens zwei Episoden schwerer Essstörungen hinter sich, brachte dies aber nicht mit einer möglichen transgenerativen Traumaweitergabe in Verbindung. Dies muss auch nicht miteinander in Verbindung stehen, es ist aber möglich, dass Menschen unter Folgen der Traumaweitergabe leiden, die sie nicht mit dem Trauma eines Elternteils in Verbindung bringen können oder wollen.
Im zweiten Interview (I 4) war die Situation ähnlich. Der Befragte litt an „depressiven Phasen“, wie er es nannte, in denen er voller Ängste war und sich aus allen sozialen Kontakten zurückzog. Seine mittlerweile hochbetagten Eltern hatten offensichtlich ihre Kriegserfahrungen mit affektiven Störungen zu bewältigen versucht, in denen sich Phasen depressiven Rückzugs mit Abschnitten eines manieähnlichen Workaholismus abwechselten. Später kam bei den Eltern Alkoholismus dazu, so dass die Last, die der Sohn zu tragen hatte, sehr massiv und vielfältig war. Er beschrieb sich selbst als „innerlich leer“, was, wie wir sehen werden, zumindest die Vermutung eines Aspektes transgenerativer Traumaweitergabe nahelegt.
Doch zurück zum Posttraumatischen Stresssyndrom. In diesem PTSD sind vor allem vier hauptsächliche Symptome beschrieben, die einer genaueren Betrachtung wert sind. Es handelt sich um Flashbacks, Erregung, Vermeidungsverhalten sowie emotionale Abflachung und Ängstlichkeit. Nur die wenigsten traumatisierten Menschen leiden unter all diesen vier Aspekten gleichzeitig, bei manchen fehlen ein oder zwei, andere wie Scham kommen hinzu. Die langfristigen Auswirkungen traumatischer Erfahrungen sind so unterschiedlich, wie die Persönlichkeit und die Lebensumstände der Betroffenen. Doch diese vier Symptome sind Phänomene, die wir bei vielen traumatisierten Menschen antreffen und ebenso auch häufig bei Menschen der nächsten Generation.
3.2 Flashbacks
Eine Frau geht auf eine Geburtstagsparty. Als sie den Raum betritt, blickt ein Mann auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers auf und schaut sie abschätzend an. Sie erstarrt, beginnt zu schwitzen und verlässt fluchtartig den Raum.
Diese Frau hat sexuelle Gewalt erfahren. In dieser Situation auf der Geburtstagsparty erlebt sie ein Flashback, das innere Bild einer Szene flammt wie ein Blitzlicht auf („flash“) und sie spürt sich wie in der traumatischen Situation, die schon jahrelang zurück („back“) liegt. Sie erinnert sich nicht an diese Situation, sondern erlebt sie. Manchmal gehört das Erinnern zu den Flashbacks hinzu, oft aber merken die Menschen in den Flashbacks nicht, was mit ihnen geschieht, und wissen nicht, dass dies mit dem traumatischen Ereignis zusammenhängt. Flashbacks wie diese haben oft einen Auslöser, einen Trigger. Hier war es der abschätzende Blick des Mannes auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers.
Solche Flashbacks sind eine verbreitete Erscheinungsform des Posttraumatischen Stresssyndroms und bei vielen Opfern traumatischer Ereignisse anzutreffen. In unseren Interviews haben wir gehört, dass mehr als die Hälfte der Befragten ebenfalls unter Flashbacks litt.
Ein Mann erzählt: „Irgendwie war ich mein ganzes Leben lang ruhelos, immer auf dem Sprung. Immer, wenn ich mal etwas länger an einem Ort war, und das war ziemlich selten, weil ich geschäftlich ziemlich viel unterwegs sein musste … Ich habe dann immer Bilder vor mir gehabt, dass ich mit der Eisenbahn fort muss. Nie mit dem Auto. Und das war dann so dringend, dass es ganz schnell gehen musste. Von null auf gleich … Na ja, ich habe so wieder Hummeln unterm Hintern bekommen, wie man so sagt, und musste weiter. Mit meinen Beziehungen war es auch so. Nichts hielt lange. Ich weiß auch nicht. Irgendwie war ich ein Wandergesell, aber kein fröhlicher. Bin ich eigentlich immer noch.“ (I 3)
Der Mann war ohne Vater aufgewachsen. Seine Mutter, damals ein junges Mädchen, war aus dem östlichen Brandenburg vor der vorrückenden russischen Armee geflohen. Ihre Familie versteckte sich westlich von Berlin. Nach der Kapitulation des Hitler-Regimes kehrte die Familie im Herbst 1945 wieder in die Heimat im östlichen Brandenburg zurück, in dem Glauben, das Schlimmste sei überstanden. 1947 wurde die Familie vertrieben.
Sie wurden nachts geweckt, hatten eine halbe Stunde Zeit, das Nötigste einzupacken, und mussten sich dann an der Bahnstation des Ortes sammeln. Anschließend wurden sie in offenen Viehwaggons in die damalige sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR, gebracht. Die Mutter ließ sich in einer Kleinstadt in Thüringen nieder, heiratete, bekam einen Sohn und verließ diese Kleinstadt nie wieder, auch nicht, nachdem ihre Ehe scheiterte. Sie hatte genug Ortswechsel hinter sich gebracht und hielt nun an der neu gewonnenen Heimat fest.
Doch der Sohn übernahm von ihr die innere Ruhelosigkeit und blieb in seinem Erleben immer wieder auf der Flucht, ein „Wandergesell“.
Eine andere Frau erzählte, dass sie bei Dunkelheit Angstanfälle bekomme.
„Wenn es dunkel ist, das halte ich nicht aus. Ich kann immer nur bei Licht schlafen, wenigstens ein kleines Licht muss an sein. Und ich muss wissen, wo die Tür ist, und ich muss sicher wissen, dass die Tür auf ist, so dass ich jederzeit raus kann. Sonst geht das nicht. Sonst dreh ich durch. Als ich vor vier Jahren im Urlaub war, da gab es … einen Stromausfall und dann bin ich durchgeknallt. Es war so dunkel und das auch so überraschend und ich wusste nicht, was los ist, und da habe ich so hyperventiliert, dass die den Notarzt geholt haben.“ (I 7)
Die Frau wurde erst nach dem Krieg geboren, doch ihre sechs Jahre ältere Schwester und ihre Mutter waren bei einem Bombenangriff verschüttet worden. Die Schwester war gestorben, die Mutter ausgegraben worden, sie hatte überlebt, da sie aus einem Hohlraum Luft bekommen hatte. Danach hatte sie zwei Selbstmordversuche unternommen und überlebt, sich dann wieder stabilisiert, nachdem ihr Mann aus der Kriegsgefangenschaft gekommen und jenes Kind geboren worden war, das als erwachsene Frau obiges Interview gab.
Über den Bombenangriff sprach die Mutter nie. Als die Tochter erwachsen war, erfuhr sie vom Vater, dass sie eine Schwester gehabt hatte und was geschehen war.
Ohne zu wissen, warum, durchlebte sie Flashbacks des traumatischen Ereignisses der Mutter. Dunkelheit und mögliches Eingesperrtsein waren die Trigger, die massive Ängste auslösten. In einer Therapie reduzierten sich die Ängste, konnten ihre lebensbestimmende Kraft aber erst verlieren, als der transgenerative Zusammenhang aus dem Dunkeln gehoben werden konnte.
Bei beiden Beispielen leiden die Menschen unter Flashbacks, ohne zu wissen, warum. Sie erinnern sich leiblich an Situationen, die sie nicht selbst erlebt haben. Der Schrecken dieser Situationen wird in ihnen lebendig.
Auch bei der Forschung über transgenerative Traumaweitergabe bei Kindern von Holocaust-Opfern wurde dieses Phänomen des Flashbacks festgestellt.
„Diese Bilder (…) dringen auf erstickende Weise in mich ein. Wie zum Beispiel morgens mit all den Autos und Abgasen, dann denke ich: ‚Nicht atmen‘, und ich denke mir, dass sie so die Menschen vergasen würden, indem sie die Auspuffe in die Lastwagen voller Gefangener umleiten. Meine Mutter ist beinahe vergast worden, müssen Sie wissen. Sie haben sie in Duschen geschleppt, aber herausgefunden, dass sie nicht genug Zyklon B hatten. Sie haben also versagt (…), ich denke 20 Mal am Tag daran, 100 Mal am Tag.“ (Gottschalk 2000, zit. n. Kellermann 2008, S. 57)
Hier sind die Abgase der Autos der Trigger und die Tochter erlebt täglich das Holocaust-Trauma ihrer Mutter. Sie weiß offensichtlich von dem Zusammenhang, ohne dass sie das von den leiblichen Reaktionen auf ihre Flashbacks lösen kann. Die furchtbaren Erlebnisse der Mutter verfolgen sie Jahrzehnte später, obwohl sie selbst viele Jahre nach dem Krieg geboren wurde. „Die Kinder von Überlebenden zeigen Symptome, die zu erwarten wären, wenn sie den Holocaust selbst durchlebt hätten. (…) Sie haben das Gefühl, dass der Holocaust das zentrale Geschehen in ihrem Leben ist, obwohl er sich vor ihrer Geburt ereignet hat.“ (Opher-Cohn 2000, S.163)