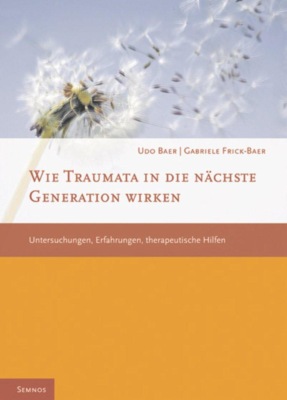Kitabı oku: «Wie Traumata in die nächste Generation wirken», sayfa 3
3.3 Erregung
Das zweite wichtige Symptom des Posttraumatischen Stresssyndroms besteht darin, dass viele Opfer traumatischer Ereignisse unter anhaltender Hocherregung und Anspannung leiden. Erregung und Anspannung sind ursprünglich ein Schutzmechanismus, der helfen soll, die bedrohliche traumatische Situation zu überleben. Die Blutzirkulation wird angeregt, der Herzschlag erhöht, die Muskeln werden angespannt, um für den Kampf oder die Flucht – gegenüber Säbelzahntigern oder anderen Bedrohungen. Doch die Säbelzahntiger unserer Zeit bieten kaum noch Chancen, zu kämpfen oder zu fliehen.
Der 16-Jährige, der Anfang 1945 noch in den sogenannten Volkssturm eingezogen wurde, nachdem er schon vorher ein Jahr lang als Flakhelfer „dienen“ musste, wurde an die Front geschickt, um gegen „die Russen“ zu kämpfen. Sein Zug hatte kaum die Stellung ausgehoben, als er unter schweren Artilleriebeschuss geriet. Da gab es weder ein Kämpfen, noch ein Fliehen. Der Junge wurde bald gefangen genommen. Als er aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, verlor er nie wieder die Anspannung und die innere Hocherregung, die während des Artilleriebeschusses von ihm Besitz ergriffen hatte. Vom Denken her wusste er, dass die Bedrohung vorbei war, doch in seinem Leib war der Schrecken dieser Stunden eingefroren.
Auch viele andere Opfer traumatischer Ereignisse wie zum Beispiel sexueller Gewalt leiden unter diesem Symptom. Manchmal ist diese Daueranspannung oder Erregung äußerlich sichtbar, oft aber lauert sie unter der Oberfläche und entlädt sich bei unterschiedlichen, manchmal mehr oder weniger zufälligen Gelegenheiten, „in denen das Fass überläuft“, wie es ein Klient beschrieb.
Gemeinsam ist den Menschen mit traumatischen Erfahrungen häufig die Erwartung, dass jederzeit etwas Schlimmes geschehen könne, oft gerade dann, wenn sie sich sicher fühlen und es sich gut gehen lassen. Viele Opfer traumatischer Ereignisse der Kriegsgeneration haben dies auch in Worten als Lebensweisheit an ihre Kinder weitergegeben: „Lass es dir ja nicht zu gut gehen, denn dann steht das Unglück vor der Tür.“
Viele traumatisierte Menschen suchen Wege, wie sie mit ihrer Erregung und Anspannung umgehen können. Diejenigen, die den Krieg erlebt haben und dabei traumatische Erfahrungen durchleben mussten, haben in der Nachkriegszeit und in den 1950er-Jahren oft 12 oder 16 Stunden am Tag gearbeitet.
Dies galt nicht nur dem Wiederaufbau nach dem Krieg, sondern hatte auch den Sinn, etwas tun zu können, um mit der Erregung umgehen zu können. Sie wollten aktiv sein statt passiv und hilflos und versuchten so, die innere Anspannung zu lösen. Schlimm wurde es für diese Menschen am Wochenende, am Sonntag, wenn „nichts zu tun war“, und schlimm wurde es im Urlaub. Da entlud sich die Anspannung oft gegen die Partner/innen, die Kinder und andere Menschen.
Viele der Interviewten der zweiten Generation zeigten ebenfalls dieses Symptom, obwohl sie selbst keine traumatische Erfahrung durchlitten hatten. Sie erzählten zum Beispiel:
» „Ich bin immer auf dem Sprung. Ich bin jetzt erst grad dabei …, mal mühselig zu lernen, wie ich zur Ruhe kommen kann. Das fällt mir nicht leicht.“ (I 1)
» „Wenn es mir so richtig gut geht, dann bin ich ganz sicher, dass gleich ein Unglück passiert, warum weiß ich auch nicht. Meine Mutter war auch so. Ich bin mir da ganz sicher. Und manchmal ist es ja auch so. Wenn etwas Schlimmes passiert, dann bin ich immer unvorbereitet, obwohl ich mich doch immer darauf vorbereite. Komisch.“ (I 11)
» „Ich war immer aktiv, schon in der Schule. Ich war Klassensprecher und habe die Schülerzeitung mitgemacht und hatte immer mit die besten Noten. Das musste sein und das war auch selbstverständlich. Und auch dann im Studium und bei der Arbeit. Immer vorneweg. Bis der Herzinfarkt kam. Seitdem muss ich ja kürzer treten. Wenigstens ein bisschen.“ (I 9)
» „So richtig loslassen kann ich nie. Wenn ich etwas erreicht habe, dann muss ich schon an das Nächste denken, was noch kommt, was ich noch vor mir habe. Meine Frau hat mir mal gesagt: ‚Du bist ja nie richtig zufrieden.‘ Und das stimmt nicht und es ist was dran … hat sie irgendwie auch recht. So, ich bin ganz zufrieden, ich bin sehr zufrieden, was ich so schaffe und wie ich so lebe, und es ist nie ganz genug, es muss immer noch was weitergehen und es gibt immer auch noch viel zu tun. Wir haben jetzt unser Haus renoviert und wenn ich mit einem Zimmer dran war, hatte ich im Kopf schon das nächste Zimmer und jetzt überleg ich mir ein Gartenhäuschen zu bauen oder den Keller auszubauen. Wahrscheinlich wird es beides. Auch mit dem Schlafen fällt‘s mir nicht leicht. Ich gehe abends jetzt meistens eine halbe Stunde joggen, manchmal eine halbe Stunde, manchmal aber auch länger, damit ich runterfahre.“ (I 10)
Sicherlich kann die Anspannung und Unruhe der Interviewten auch andere Ursachen haben als die transgenerative Traumaweitergabe und bei einigen wird sie aus unterschiedlichen biografischen Quellen gespeist werden. Doch die Häufung dieses Symptoms, von dem 11 der 15 Interviewten ungefragt erzählten, ist auffällig. Hochspannung und Dauererregung sind ein Symptom sowohl traumatisierter Menschen als auch zahlreicher Angehöriger der zweiten Generation. Auch hier gilt: Sie leiden oft unter diesem Symptom, ohne zu wissen, warum.
3.4 Vermeidungsverhalten
Wenn unsere Vorfahren in einem Waldstück einem Säbelzahntiger begegnet sind, vor dem sie sich gerade noch retten konnten, dann machte es Sinn, dass sie danach dieses Waldstück mieden. Situationen, in denen sich Menschen existenziell bedroht fühlen, zu vermeiden, gehört zu den Strategien des Überlebens. Insofern gehört das Vermeidungsverhalten zu den häufigsten Symptomen, die im Gefolge einer traumatischen Erfahrung auftreten.
Zum Problem wird diese an sich sinnvolle Reaktion, wenn Menschen unter den Folgen des Vermeidungsverhaltens leiden. Da wird nicht nur das Waldstück, in dem der Säbelzahntiger haust, gemieden, sondern jeglicher Wald. Wer nach einem traumatisierenden Autounfall versucht, ähnliche Erfahrungen zu vermeiden, kann wahrscheinlich noch relativ gut darauf verzichten, Autobahn zu fahren, vielleicht sogar den eigenen Führerschein abgeben oder nie mehr ein Auto besteigen – aber jeglichen Kontakt mit Autos und Autogeräuschen zu verhindern, wird nicht möglich sein. Schon der Versuch wird die Lebensmöglichkeiten sehr stark einschränken. Wenn Menschen sich im Gefolge eines undifferenzierten und chronifizierten Vermeidungsverhaltens äußerlich und innerlich zu sehr zurückziehen, verlieren sie zumindest Wahlmöglichkeiten ihres Lebens und Erlebens, oft mündet dieser Prozess sogar in der Depression.
Eine besondere Qualität nimmt das Vermeidungsverhalten an, wenn die traumatischen Erfahrungen sequentiell sind, also wiederholt durchlebt werden mussten. Wer mehrmals sexuelle Gewalt erfahren hat, wer im Krieg über einen langen Zeitraum lebensgefährlichen Bedrohungen ausgesetzt bzw. ihr Zeuge war, gerät oft, was das Vermeidungsverhalten betrifft, in eine Falle. Auf der einen Seite möchten diese Menschen unbedingt alle Situationen vermeiden, die den traumatisierenden Ereignissen ähneln, auf der anderen Seite haben sie durch die chronifizierten traumatischen Erfahrungen eine derartig hohe „Hab-Acht-Haltung“ entwickelt, dass ihre Sinne hoch sensibilisiert sind.
Wer ständig mit allen Sinnen auf mögliche Gefahren lauscht, kann das Lauschen oft nicht mehr abstellen, wenn die Gefahren nicht mehr drohen.
Diese Offenheit für alle möglichen Reize führt zu einer chronischen Reizüberflutung. „Chronische Traumatisierung überfordert jene seelischen Mechanismen, die uns im Alltag vor übermächtigen Reizen schützen.“ (Schmidtbauer 2008, S.140) Es geht nicht mehr um bestimmte Trigger, die entsprechende Reaktionen auslösen, sondern die generelle Reizüberflutung führt zu einer generellen Reizbarkeit. Über die kriegstraumatisierten Väter wird häufig erzählt, dass sie nicht nur unruhig waren, sondern auch oft Jähzornanfälle und cholerische Attacken an Kindern, Partnerinnen und Nachbarn auslebten, immer „beleidigt“ und „überempfindlich“ waren. In einem solchen Zustand der chronisch erhöhten Erregung und Reizbarkeit das Vermeidungsverhalten zu leben, ist kaum noch möglich. Nicht mehr der Donner triggert nun das Erleben des Artilleriebeschusses, sondern jedes Geräusch. Dann scheint der Rückzug oft nur noch möglich durch den Griff zu Drogen, zu Medikamenten oder zum Alkohol. Alkoholismus und Drogenabhängigkeit sind oft Versuche, das Vermeidungsverhalten auf dem Boden einer erhöhten Reizbarkeit umzusetzen.
Wenn Kinder traumatisierter Väter oder Mütter mit solchem Vermeidungsverhalten aufwachsen, reagieren manche mit dem Gegenteil, andere übernehmen das Verhalten, wie einige Interviews zeigen.
„Mein Vater trank und war jähzornig. Vielleicht hat das was mit dem Krieg zu tun und vielleicht war das auch seine Art, mit den fünf Jahren Kriegsgefangenschaft umzugehen. Er war sofort auf 180, ganz leicht reizbar, man wusste nie, ob er gut drauf war oder gleich einen Tobsuchtsanfall bekam. Ich tat alles, um ihn nicht zu treffen. Ich versteckte mich, und auch wenn ich mit ihm im Zimmer war, tat ich so, als wäre ich nicht da. Dass ich manchmal bei irgendwelchen Gelegenheiten anwesend bin und mir Leute sagen, sie hätten mich gar nicht bemerkt und … also das ist … Ich glaube, das habe ich da gelernt, so zu tun, als gäbe es mich nicht.“ (I 11)
Das Vermeidungsverhalten setzt sich fort, die interviewte Frau aus der zweiten Generation vermeidet den Vermeider. Das Vermeiden wird zu einem ihrer Wesenszüge, prägt ihr weiteres Leben.
Ein junger Mann erzählt: „Ich halte es in Fahrstühlen nicht aus, da gehe ich lieber die Treppe. Und auch sonst enge Räume, wo man in Tuchfühlung mit anderen ist – schrecklich. Da fange ich an zu zittern und zu schwitzen, einmal bin ich sogar ohnmächtig geworden.“ (I 12)
Der Interviewte konnte sich dieses Phänomen nicht erklären, er litt darunter, dass er sein ganzes Leben immer wieder darauf achtete, sich nicht zu eng mit anderen Menschen in einem Raum aufzuhalten. Er erfand dafür Notlügen und erzählte zum Beispiel im Büro, dass er prinzipiell nicht Fahrstuhl fahre, sondern, weil es gesund sei, immer Treppen gehe. Er mied Geburtstagsfeiern oder andere Partys, bei denen sich viele Menschen gleichzeitig in einem Raum aufhielten. Als er, angestoßen durch einen unserer Vorträge, seinen Vater fragte, was dieser im Krieg getan habe, erzählte dieser, er wäre Panzerfahrer gewesen, einer der wenigen, die überlebt hätten, und er hätte sich immer auf engstem Raum mit anderen Menschen zusammen aufhalten müssen und würde dies seitdem hassen. Er hatte vorher nie darüber gesprochen.
Einer Klientin wurde während der therapeutischen Arbeit deutlich, dass auch ihre Beziehungsruhelosigkeit Ausdruck eines transgenerativen Vermeidungsverhaltens sein könne. Sie sehnte sich verzweifelt nach einer dauerhaften Bindung, doch immer dann, wenn nach einer Phase der Verliebtheit der Partner mit ihr eine solche längerfristige Bindung eingehen wollte, inszenierte sie heftigste Auseinandersetzungen und fand allerlei Vorwände, um die Beziehung abzubrechen. Kurz danach bedauerte sie dies, schämte sich und fühlte sich schuldig – und dann wiederholte sich das Muster. In der Therapie wurde deutlich, dass die Kriegsund Nachkriegserfahrungen ihrer Mutter durch Verluste geprägt waren.
Die Familie stammte aus Siebenbürgen im heutigen Rumänien und floh, als die Mutter ein junges Mädchen war, vor der heranrückenden russischen Armee nach „Sudeten-Deutschland“. Der Vater war im Krieg gefallen, auf der Flucht wurde der Großvater erschossen, die Großmutter starb an Entkräftung. Die Mutter fand mit ihr und ihrem jüngeren Bruder Unterschlupf bei einer sudetendeutschen Familie im Gebiet des heutigen Tschechien. Von dort wurde die Familie vertrieben, auf der Flucht wurde der jüngere Bruder von ihnen getrennt und blieb seitdem vermisst. Die Mutter klammerte sich später an die verbliebene Tochter („Du bist das Einzige, was mir geblieben ist.“) und unterhielt nur noch oberflächliche Kontakte zu anderen Menschen. „Ich will nicht noch einmal jemanden verlieren“, war ihr Leitspruch, deswegen ging sie keine Bindungen mehr ein. Die Tochter übernahm dieses Muster und setzte das Vermeidungsverhalten fort. Auch Kinder von Holocaust-Überlebenden vermeiden oft neue Beziehungen. „Neue Liebe bedeutet oft genug Verrat an verlorenen Angehörigen, Partnern und früheren Kindern.“ (Wardi 1997, S.11)
Andere Menschen, die unter vielen traumatisierenden Verlusten litten, gingen eine neue Beziehung ein, vermieden aber alles, was eine Trennung hätte herbeiführen können. Nur nicht noch einmal jemanden verlieren, das war das Motto, das sie an Menschen kettete, die sie nicht oder nicht mehr liebten, die sie verletzten, ja, die ihnen manchmal das Leben zur Hölle machten. Auch dies ist eine – verstecktere – Form des Vermeidungsverhaltens auf dem Hintergrund oft chronifizierter traumatischer Erfahrungen.
3.5 Emotionale Abflachung, Ängste und Ängstlichkeit
Wer existenziell bedroht wurde und traumatische Erfahrungen durchleben musste, wird Angst haben, dass ihm dies noch einmal geschieht. Diese Angst ist normal und gesund, denn sie schützt davor, sich erneut in bedrohliche Situationen zu begeben. Zum Leiden führt die Angst, wenn sie durch alle Ritzen des Lebens und Erlebens sickert, wenn sie das Erleben und Verhalten eines traumatisierten Menschen prägt und die Ängstlichkeit zu einem Grundgestimmtsein der Persönlichkeit wird.
Wie in dem Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, ist eine Form der Angst auch die völlige Furchtlosigkeit. Die Angst ist so groß und so allgegenwärtig, dass sie irgendwann dissoziiert wurde. Die betreffenden Menschen kennen wie der Held des Märchens keine Furcht und begeben sich selbstverständlich in die gefährlichsten Situationen, ohne dass sie das Gefühl haben, dafür Mut zu benötigen. Die Angst ist so sehr Thema, dass sie kein Thema mehr ist.
Chronische Ängste sind ein häufiges Symptom, das in Folge traumatischer Erfahrungen auftritt. Oft werden sie begleitet von emotionaler Abflachung. Das gesamte Gefühlsleben ist stumpf, die emotionalen Spitzen sind geglättet – auch dies ein Ausdruck von Angst und Hilflosigkeit. Wer zum Beispiel sexuelle Gewalt erfahren hat und in seiner Hilflosigkeit keine Hilfe gefunden hat, in seiner Angst keinen Trost, in seinem Zorn keine Parteilichkeit, wird häufig emotional resignieren. Auch das Gegenteil ist möglich: nur noch emotionale Spitzen zu leben und die Hocherregung in oft übertrieben wirkenden Gefühlsausbrüchen auszuagieren. Doch als Teil des Posttraumatischen Stresssyndroms sind Ängstlichkeit und emotionale Abflachung häufiger. Dies gilt vor allem, wenn Menschen wiederholt traumatische Erfahrungen machen mussten, zum Beispiel in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Hannah Arendt beschrieb in ihrem Tagebuch 1950 bei ihrem Besuch in Deutschland:
„Inmitten der Ruinen schreiben die Deutschen einander Ansichtskarten von Kirchen und Marktplätzen, die es gar nicht mehr gibt. Und die Gleichgültigkeit, mit der sie sich durch die Trümmer begeben, findet ihre Entsprechung darin, dass niemand um die Toten trauert (…). Dieser allgemeine Gefühlsmangel, auf jeden Fall aber die offensichtliche Herzlosigkeit, die manchmal mit billiger Rührseligkeit kaschiert wird, ist jedoch nur das auffälligste Symptom einer tief verwurzelten hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung, sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen.“ (Arendt 1993, S.24f.)
Wenn das „tatsächlich Geschehene“ zu brutal, zu unaushaltbar, zu schambesetzt, zu schrecklich war, um sich dem stellen zu können oder zu wollen, dann ist die emotionale Abstumpfung eine individuelle Reaktion, die zu einer Reaktion einer ganzen Generation werden kann. Betrachten wir einige Beispiele dafür, wie sich in den Interviews bei den Befragten diese Symptome der Ängstlichkeit und der emotionalen Abflachung zeigten:
Eine Frau erzählt, dass sie sehr leidenschaftslos sei.
„Ich habe es immer gern ruhig und wenn alles seine Ordnung hat. Ja, so kann man das sagen. Meine Freundin zieht mich immer auf. Ich suche mir immer Freunde und Freundinnen, die sehr leidenschaftlich sind, also irgendwie so das Gegenteil von mir. Meine Mutter war auch so. Die hat gesagt: ‚Ich habe schon genug Aufregung in meinem Leben gehabt, ich brauche keine mehr.‘ Manchmal denke ich, mir fehlt da was oder ich bin nicht ganz richtig, aber irgendwie ist das jetzt normal, das gehört zu mir.“ (I 13)
Oft ist die emotionale Abflachung wie bei dieser Befragten so selbstverständlich geworden, dass sie wie ein Teil der Persönlichkeit wirkt. Erst wenn sie im Zusammenhang mit den Reaktionen auf die traumatischen Erfahrungen der Mutter, also der ersten Generation, gesehen wird, wird deutlich, dass es sich um einen Aspekt transgenerativer Traumaweitergabe handeln kann.
Eine andere Frau erzählte von ihren Ängsten:
„Wir hatten immer große Angst … also meine Kindheit war überschattet mit der Angst, dass die Familie auseinanderfällt, dass irgendwas Schlimmes passiert und wir nicht zusammenbleiben können. Ich weiß nicht. Daraus resultiert mein Gefühl, nicht wirklich da zu sein, nicht das Gefühl zu haben, ah, jetzt bin ich da. Ich habe immer das Gefühl, dass sich irgendetwas verändert, dass irgendetwas geschieht und ich mich verändern muss. Ich muss woanders hin oder so. Und was ich übernommen habe und weitergebe, ist, glaube ich, dass ich unglaubliche Ängste meinen Kindern gegenüber habe. Schon als sie klein waren, auf dem Spielplatz, da habe ich gewisse Dinge nicht zugelassen aus Angst, ihnen könnte was passieren. Und auch jetzt ist das so. Sie müssen mir also immer Rechenschaft ablegen, wo sie sind, wann sie wiederkommen usw. Das ist nicht direkt Kontrollzwang, sondern geschieht eher aus dieser Angst heraus. Das ist auch so, wenn mein Mann zu spät nach Hause kommt. Wenn er sagt, er kommt um sieben und ist um acht noch nicht da, dann habe ich direkt irgendwelche Fantasien.“ (I 5)
Die Frau stammt aus einer großen Familie. Die meisten Angehörigen sind im Holocaust getötet worden, weil sie Juden waren.
Der Vater einer anderen Befragten musste mehrere Jahre in Süd-Ost-Europa als Kriegsgefangener in einem Bergwerk unter Tage arbeiten. Sie erzählt über sich:
„Ja, es war zum Beispiel immer so eine Angst vor dunklen, geschlossenen Räumen da, sich nicht hineinbegeben können, wenn jemand anders die absolute Lenkung und Verantwortung hat. Egal, ob das ein Flugzeug oder ein Schiff war, da war so ein Gefühl von Ausgeliefertsein. Mir fehlte einfach so eine Leichtigkeit, die ich nicht begründen konnte.“ (I 8)
Den Zusammenhängen zwischen dem Erleben solcher Ängste mit den Erfahrungen ihres Vaters kam die Frau erst langsam auf die Spur, wie sie sagte. Ihre Angst trat auf, wenn „jemand anders die absolute Lenkung und Verantwortung hat“. Auch als der Vater als Kriegsgefangener im Bergwerk eingesperrt war, hatte „jemand anders die absolute Lenkung und Verantwortung“, er war ohnmächtig und ausgeliefert. Sie erzählte später, dass sie einmal in einen Berglift gestiegen ist:
„Ich war kurz vor einem Herzkasper und auch da war es wieder so: Ich kriegte keine Luft mehr, wollte da raus und hatte dieses Gefühl von: Ich bin da ausgeliefert!“ (I 8)
Auch hier muss sie sich wieder dem Gefühl ausliefern, vollständig abhängig zu sein von anderen, die die Verantwortung für das eigene Schicksal haben. Dies ist die Grundlage ihrer Angst. Auch wenn sie mittlerweile vermutet, dass diese Angst mit den Erfahrungen ihres Vaters zusammenhängen könnte, erschienen auch ihr, wie allen anderen, viele Jahre lang diese Ängste als Ängste ohne Grund.
3.6 Wie erklären sich Gemeinsamkeiten?: Spiegelneuronen und Resonanz
Alle vier beschriebenen Kernsymptome des Posttraumatischen Stresssyndroms treten auch bei Angehörigen der zweiten Generation auf. Dies zeigen sowohl die Forschungsergebnisse mit Kindern von Holocaust-Überlebenden als auch unsere Therapieerfahrungen sowie die Auswertung der Interviews.
Wie können diese Symptome als Folgen traumatischer Erfahrungen an Menschen weitergegeben werden, die diese Erfahrungen nicht selbst gemacht haben? Ein Hinweis bietet die neurobiologische Entdeckung der Spiegelneuronen.
„Die Patientin liegt wach im Operationssaal eines Krankenhauses im kanadischen Toronto. Ihr Kopf ist fest in einem Metallkäfig justiert, in der Schädeldecke über ihrem Stirnhirn klafft ein Loch. Wie Infusionsschläuche ragen zwei Mikroelektroden aus den Innereien ihres Geistes. Eigentlich unterzieht sich die Frau einem Eingriff gegen schwere Depression, gleichzeitig hat sie aber dem Physiologen William Hutchison erlaubt, an ihrem Gehirn ein neuro-wissenschaftliches Experiment vorzunehmen.
‚Schmerzt Sie das?‘, fragt Hutchison und piekst die Frau mit einer Nadel in den Zeigefinger. Noch bevor sie ihm mit ‚Ja‘ antwortet, messen die Sensoren das Feuern einer Einzelzelle. Kurze Zeit später sticht sich Hutchison vor ihren Augen selbst in den Finger. Erneut registrieren die Elektroden das Aufflackern der Schmerzzelle. Die Frau verneint jedoch, irgendetwas zu spüren.
Mit diesem Versuch hat der Wissenschaftler der Universität Toronto wohl erstmalig beim Menschen ein einzelnes Spiegelneuron beobachtet. Dieser Zelltyp versetzt Forscher weltweit in helle Aufregung – sehen sie in ihm doch die Basis für eine Reihe ureigener menschlicher Leistungen: das Erkennen fremder Absichten und Gefühle und sogar die Entwicklung von Sprache und Kultur.
Spiegelneuronen sind Nervenzellen mit einer Doppelfunktion. Einerseits sind sie an sensorischen oder motorischen Funktionen des Gehirns beteiligt – wie es bei den Schmerzzellen der Fall ist. Andererseits spiegeln sie Vorgänge, die wir in unserer Umgebung beobachten, in einer Art neuronaler Simulation nach.“ (Breuer 2002, S.70)
Die Spiegelneuronen sind die biologisch-neuronale Basis dafür, dass sich Menschen in andere Menschen hineinversetzen. Wir nennen dies Resonanz, vom lateinischen resonare „miteinander schwingen“ (Cramer 1998). Offensichtlich versetzen sich Kinder in ihre Eltern hinein und spüren das, worüber diese gerade nicht erzählen, was sie aber erleben, ihre Ängste, ihre Erregung, ihr Vermeidungsverhalten. Dies kann so weit gehen, dass selbst ähnliche Trigger wie bei den traumatisierten Eltern auch bei der zweiten Generation traumatisches Erleben auslösen. Diese Erklärung reicht nicht aus, um alle Prozesse der transgenerativen Traumaweitergabe verständlich zu machen, aber sie ist die Grundlage dafür, dass Menschen leiden, ohne zu wissen, warum.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.