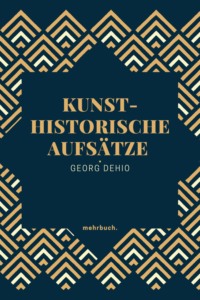Kitabı oku: «Kunsthistorische Aufsätze», sayfa 5
Wenn die italienische Renaissance darauf ausging, den Innenraum in seinen stereometrischen Verhältnissen klar darzulegen, ihn fest zu umgrenzen, ihn nach leicht fassbaren und messbaren Proportionen zu gliedern: so ist der spätgotische Raum das Gegenteil davon, eine unbestimmt verschwimmende, geometrisch undefinierbare, formlose Masse. Nein, die Spätgotik ist nicht »Raumstil«. Ihr Lebensprinzip liegt in einer ganz anderen ästhetischen Kategorie. Es ist die Zusammenfassung der Architekturteile zu einer malerischen Einheit. Noch mehr: die Architektur an sich ist unfertig, sie bedarf der Ergänzung durch die in bekannter Massenhaftigkeit in sie hineingestellten künstlerischen Sonderexistenzen: die Altäre, Sakramentshäuser, Kanzeln, Lettner, Schranken und Chorstühle, Grabmäler usw. Erst durch die optischen Beziehungen dieser Stücke unter sich und mit dem architektonischen Hintergrund wird das gewollte Endergebnis gewonnen: das Bild. Es hat dem Charakter dieser Innenräume wenig, oft nichts geschadet, wenn die gotischen Mobilien durch barocke ersetzt wurden, aber die nach modernen puristischen Restaurationen zurückbleibende Leere traf ihren Lebensnerv. Die schon in der sog. deutschen Renaissance eintretende Vermischung der Stilformen ist gar keine Inkonsequenz, sie passt ganz zum Wesen dieses nicht in Formen, Konstruktionen oder Raumkategorien, sondern in malerischen Bildeindrücken denkenden Stils.
Wohin sollen wir nun diese »Spätgotik« geschichtlich einordnen? Mit der Gotik der Kathedrale von Amiens hat sie offenbar, außer in Äußerlichkeiten, nichts zu tun – aber auch nichts mit der Renaissance eines Brunellesco und Bramante. Der fundamentale Irrtum bei Schmarsow liegt darin, zu meinen, dass wir nur zwischen den zwei Möglichkeiten – entweder Ende der Gotik, oder Anfang der Renaissance – die Wahl hätten. Ich sehe in der nordischen Spätgotik ein neues Drittes wirksam. Ich finde, dass dieses das Absterben der gotischen Zierformen überlebt, ja erst danach zu voller Klarheit über sich selbst kommt. Der Weg der Entwicklung geht von der Spätgotik in gerader Linie zum Barock, an der Renaissance vorbei, öfters durch Flankenangriffe der Renaissance beunruhigt, aber nie von ihr ganz durchbrochen. Vielleicht wird weitere Überlegung – die aber im Rahmen dieser kritischen Erörterung nicht mehr angestellt werden kann – noch einmal zur Einsicht führen, dass das historische Verhältnis von Renaissance und Barock nicht ein Nacheinander, sondern ein Nebeneinander ist. Damit wäre auch der eben so eifrig als fruchtlos geführte Streit über die Spätgotik geschlichtet. Sie wäre dann nicht sowohl Übergang zur Renaissance als Übergang zum Barock. Und vielleicht findet sich einmal in guter Stunde auch noch ein Name für sie. Etwa »Vorbarock«? wie wir ja schon lange gewöhnt sind, bekannte andere Erscheinungen als »Vorrenaissance« zu bezeichnen. Oder noch präziser: »gotisierendes Barock«.
Inhalt
DEUTSCHE KUNSTGESCHICHTE UND DEUTSCHE GESCHICHTE
(1907)
Aus dem 100. Band der Historischen Zeitschrift)
Es mag erlaubt sein, an dieser Stelle, wo regelmäßig über neu erschienene Bücher Bericht erstattet wird, einmal auch von einem Buch zu sprechen, das wir nicht haben, aber haben sollten.
Auf dem Titel dieses Buches würde stehen: »Geschichte der deutschen Kunst.« Warum hat die deutsche Kunstwissenschaft, der man Regsamkeit gewiss nicht wird absprechen können, eben dieses Buch, von dem man unbefangen meinen müsste, es sei das begehrteste unter allen denkbaren, noch nicht hervorgebracht? noch kein Buch, in dem die deutsche Kunst als historisches Ganzes erfasst und dargestellt wird?
Das vor 20 Jahren im Verlag der G. Groteschen Buchhandlung in Berlin herausgegebene bekannte fünfbändige Werk trug zwar den vermissten Titel »Geschichte der deutschen Kunst«, und es war ohne Zweifel auch ein gutes Buch; aber, was der Titel verhieß, eine einheitliche Geschichtsdarstellung war es doch wohl nicht. Von fünf Verfassern (Dohme, Bode, Janitschek, Lützow, Falke) wurde in fünf Sonderbüchern Baukunst, Bildhauerkunst, Malerei, Holzschnitt und Kupferstich, Kunstgewerbe jedes für sich vorgetragen – und dem Nachdenken des Lesers blieb das Letzte, Beste und Schwerste überlassen, die Erkenntnis dessen, was über den fünf Stücken als Einheit walte. Es ist retrospektiv von Interesse, in der Vorrede (von Dohme) die Rechtfertigung dieses Verfahrens nachzulesen. »Seit Schnaases grundlegender Arbeit ist es in der Kunstgeschichte vielfach beliebt, die sachliche Nüchternheit fachmännischer Erörterungen durch Einschiebung allgemeiner kulturgeschichtlicher Exkurse zu würzen. Derartige Hintergrundstimmung aber ist unvermeidlich einseitig auf das jedesmalige besondere Bedürfnis der Autoren getönt, wenn sie nicht einfach als entbehrliches Ornament auftritt. Denn in erster Linie muss die Entwicklung jedes Kunstzweiges aus sich selbst, d. h. aus den jedesmaligen technischen und künstlerischen Voraussetzungen heraus erfasst werden.« Worauf ich damals in meiner Anzeige erwiderte: »Diese Beschränkung ist gegenüber den »kulturhistorischen« Plattheiten und verschwimmenden Allgemeinheiten eine gesunde Reaktion. Aber eine Beschränkung bleibt es. Was Dohme vollkommen richtig als in erster Linie stehend bezeichnet, darf nicht vergessen machen, dass es noch ein zweites, höheres Niveau der Betrachtung gibt, auf dem die Einzelkunst nur als Ausfluss eines einheitlichen künstlerischen Gesamtbewusstseins, und dieses wiederum nur beschlossen in dem geistig-materiellen Gesamtzustand der jeweiligen Epoche erscheint.« Seitdem ist eine Geschichte der deutschen Kunst nicht wieder geschrieben worden. Das ist sicher: die, die uns nottut, kann nicht durch Assoziation entstehen. Sie wird das Werk eines Einzelnen sein müssen.
In einer jeden Wissenschaft gibt es Entwicklungsepochen, in denen die analytische Arbeit das Übergewicht über die synthetische hat, unvermeidlich. Kein Glück ist es aber, wenn sich eine solche Epoche zu sehr in die Länge zieht, was nachgerade der Fall geworden ist. Nun wird man von der deutschen Kunstwissenschaft der Gegenwart ohne Ungerechtigkeit nicht behaupten können, dass sie synthetischer Betrachtung überhaupt abhold sei. Nur die Kunst des eigenen Volkes ist es, die bis jetzt in dieser Hinsicht leer ausging. Warum das? Ein bloßer Zufall ist es nicht; Ursachen müssen da sein, aber wahrscheinlich sind sie sehr komplizierter Natur.
Die in Rede stehende Lücke macht sich noch auffallender geltend, wenn wir auf den nächstliegenden Parallelzweig der historischen Literatur, die Geschichte der deutschen Dichtkunst, hinsehen, wo es Darstellungen jeder Art und jeden Umfanges seit langem und in Fülle gibt, vom schweren gelehrten Kompendium bis zur populären Übersicht in mannigfachster Abstufung. Sollte etwa im Publikum das Interesse an der bildenden Kunst im gleichen Maßstab kleiner sein? Diese Folgerung wäre irrig. Wie man immer das Gewicht des ästhetischen Faktors im Gesamtleben unserer Zeit abschätzen mag, – zum mindesten die äußere Bekanntschaft mit Werken der Kunst, alter wie neuer, geht in der heute lebenden Generation in die Breite wie nie. Es ist die moderne Technik, die auch nach dieser Seite hin für unsere Kultur ganz neue Bedingungen hervorgerufen hat. Eisenbahnen und Photographie haben den angesammelten Schatz alter Kunst aus seiner örtlichen Gebundenheit gelöst, ihm wie durch ein Wunder gleichsam Überallheit geliehen, sei es, dass wir als Reisende mit leichter Mühe an ihn herankommen, sei es, dass er in der Vervielfältigung durch den Kunstdruck uns ins Haus dringt. Poesien kann man ungelesen lassen; Architekturen, Skulpturen, Bilder und ihre Nachbildungen nicht zu sehen, ist beinahe unmöglich. Der heutige Mensch, mag er wollen oder nicht, er steht unter einer Überschwemmung von Eindrücken dieser Art, und seine größte Sorge müsste sein, in seinem Geist in dies Viele, Vielzuviele einigermaßen Ordnung zu bringen. Betrachten wir die diesem Bedürfnis entgegenkommende Betriebsamkeit des Büchermarktes, so wird die Frage immer dringender: warum unter allem keine Geschichte der deutschen Kunst?
Der Erklärungsversuch muss weiter ausholen. Offenbar betrachten wir Kunstwerke, wofern wir nicht schon in bestimmter Weise wissenschaftlich diszipliniert sind, anders als alle anderen historischen Erscheinungen. Sobald ihr künstlerischer Gehalt spontan in Wirkung tritt, gewinnen sie die volle Kraft des Lebendig-Gegenwärtigen; wir können es gänzlich vergessen, dass wir es mit dem Niederschlag eines längst abgelaufenen geschichtlichen Prozesses zu tun haben. Es bedarf hier der gar nicht leicht zu gewinnenden geistigen Schulung des Fachmannes, um das ästhetische Interesse und das historische Interesse rein gegeneinander abzugrenzen. Nichts ist aber begreiflicher als dieses, dass der im Allgemeinen kunstfreundlich gesinnte Laie, der sich mit alter Kunst gelegentlich einmal beschäftigt, von der ästhetischen Seite viel schneller und stärker ergriffen wird als von der historischen. Darauf ist denn auch mehr und mehr unsere ganze populäre kunstgeschichtliche Literatur (einigermaßen nur mit Ausnahme der auf die Antike bezüglichen, für die schon durch unsere Gymnasialbildung andere Voraussetzungen geschaffen sind) abgestimmt. Um es kurz zu sagen: wer als Nichtfachmann ein kunstgeschichtliches Buch in die Hand nimmt, sucht heute nicht in erster Linie historische Erkenntnis, sondern Anleitung zu ästhetischem Genuss. So angesehen hat ganz folgerichtig auch für den Deutschen die deutsche Kunstgeschichte auch keinen Vorzug vor der Kunstgeschichte anderer Völker zu beanspruchen; ja es wäre begreiflich, wenn sie, als Quelle des Genusses angesehen, geringeren Reiz ausübte.
Dies führt hinüber auf einen zweiten Erklärungsgrund. Die Sprache der bildenden Kunst ist nicht – so scheint es wenigstens – wie die der Dichtkunst an ein einzelnes Volkstum gebunden, sie ist international. Es bedarf schon eines viel tieferen Eindringens in ihr Wesen, um zur Erkenntnis zu gelangen, dass das Wort: »Wer den Dichter will verstehn, muss in Dichters Lande gehn« – erst recht für die bildende Kunst eine Wahrheit ist. Wenn jemand in der Betrachtung der Dichtkunst seinen Interessenkreis weiter ausdehnt, so hat er doch immer mit der heimischen Dichtung begonnen, um nach und nach sich den fremden Literaturen zuzuwenden. Bei der Beschäftigung mit der bildenden Kunst gehen aber für jeden von Anfang an alle Nationen durcheinander; ja praktisch wird es den allermeisten Deutschen noch heute so ergehen, dass sie die ältere deutsche Kunst sogar später kennen lernen als die antike, die italienische, die niederländische (womit ich nicht urteilen, noch weniger verurteilen, vielmehr nur Tatsächliches feststellen will).
Beachten wir dann noch, als Bestätigung des eben Gesagten die Zurückhaltung des Verlagsbuchhandels. Er hätte, wäre ihm die Stimmung des Publikums günstig erschienen, längst die Initiative ergriffen. Dass er es nicht getan hat, darum sind wir ihm gewiss nicht gram. Denn er hätte nur unreife Früchte vom Baum geschüttelt.
Nun der wichtigste Punkt: warum man auch in den Reihen der Kunstwissenschaft zögert? Dass es die Größe und Schwierigkeit der Aufgabe allein sein sollte, die abschreckt, möchte ich nicht glauben. Eine gewisse Rolle spielt wohl die Befürchtung, dass ein so umfassender Gegenstand zu schnell in den Einzelheiten überholt sein werde. Gewiss, eine Monographie kann auf längere Lebensdauer rechnen und ist insofern lohnender. Aber das ist nichts der Kunstgeschichte Eigentümliches und braucht deshalb hier nicht weiter erörtert zu werden. Das am ernstlichsten hemmende Motiv wird Folgendes sein:
Zurzeit beschäftigt uns am meisten die Erforschung der inneren Kunstgesetze und die aus ihnen hervorgehende Stilentwicklung. Diese Betrachtungsweise verleugnet nicht das geschichtliche Moment, das in dem Begriff der Entwicklung schon gegeben ist; aber sie beschränkt es. Ihr erscheint die Kunst als eine autonome Macht. Sie fragt wenig, zu wenig nach den anderen geistigen Mächten, in deren Umgebung die Kunst ihr geschichtliches Leben führt, und von denen sie mitbedingt wird; sie fragt noch weniger nach den materiellen Voraussetzungen. Sie gibt eine Geschichte des künstlerischen Denkens, nicht eine vollständige Darlegung des wirklichen Verlaufes in seinen verwickelten Kausalzusammenhängen. Liegt nun einmal der Schwerpunkt des Interesses nach der eben angegebenen Seite, dann wird es ganz begreiflich, dass die deutsche Kunstgeschichte als Ganzes keine besondere Anziehungskraft ausübt. Was die französische Kunst des hohen Mittelalters, die italienische der Renaissance dem Beobachter darbieten, die allein auf ihrer eigenen Achse ruhende Abwandlung eines bestimmten Komplexes von Problemen, in sich geschlossen, vom Ausland weder hemmend noch fördernd beeinflusst, etwas dem Ähnliches hat die deutsche Kunstgeschichte nicht zu geben. Angenommen, über die Kunst Italiens wären alle historischen Nachrichten verloren gegangen, so könnten wir doch allein aus den Denkmälern den ganzen Verlauf von Giotto bis auf Bernini im Wesentlichen richtig rekonstruieren. Angesichts der deutschen Kunst, im gleichen Fall, würde uns wer weiß wie oft der Faden abreißen. Ihre Bewegungszentren liegen eben zu einem nicht geringen Teil außerhalb ihres eigenen Gebietes. Ihr 13. Jahrhundert ist nicht denkbar ohne die französische, ihr 15. nicht ohne die niederländische, ihr 16. nicht ohne die italienische Kunst. Und mit diesen Einwirkungen durchkreuzen sich außerkünstlerische Gewalten der eigenen Volksgeschichte. So entstehen, ohne von innen heraus motiviert zu sein, Hebungen und Senkungen, Abbiegungen, Brüche, irrationale Erscheinungen an allen Enden. Der Nur-Kunsthistoriker hat ein Recht zu sagen: was ich hier sehe, ist keine Einheit; mich interessieren die einzelnen Abschnitte, aber das Ganze ist mir kein Gegenstand der Darstellung, weil es für mich ein Ganzes nicht ist.
Also: die Kunstgeschichte im engeren Sinne kann das am Eingang unserer Erörterung postulierte Buch wohl entbehren. Aber es gibt eine andere Wissenschaft, die es nicht kann: das ist die deutsche Geschichte. Die Kunstgeschichte fragt: was sind die Deutschen der Kunst gewesen? Die deutsche Geschichte: was ist die Kunst den Deutschen gewesen? Beide Fragestellungen sind an sich berechtigt. Zu einem organischen Aufbau des Geschehens führt nur die zweite. Und auch nur sie zu einer Wertbeurteilung nach einheitlichem Maßstab.
Die ästhetische Analyse behält daneben ihren selbständigen Wert, sie erst lehrt uns die Sprache des Kunstwerkes verstehen, sie ist die grundlegende Arbeit. Die historische Betrachtung aber verlangt mehr. Sie weiß, dass an der realen Existenz des Kunstwerkes auch noch andere als ästhetische Kräfte mitarbeiten (man erwäge beispielsweise das große Kapitel Kunst und Religion). In der Geschichtsdarstellung, an die ich denke, soll nicht von den Taten der Künstler allein die Rede sein, sondern ebenso viel vom Gegenspieler, dem Publikum. Den Stoff zum Kunstwerk gibt das Leben, die Kunst gibt die Form. Die eigentliche Aufgabe des Historikers nun, die allein er lösen kann, ist die Aufdeckung des Lebensstoffes, der danach getrachtet hat, in Kunstform überzugehen und in dieser gereinigten Gestalt wieder ins Leben zurückzukehren. Für den Historiker haben hier auch die Misserfolge – die der Ästhetiker gleichgültig beiseite schiebt – eine Bedeutung, und man erwartet von ihm Einsicht in ihre Ursachen. Ganze Epochen, die dem Ästhetiker leer erscheinen, werden dem Historiker einen Inhalt gewinnen; oft genug wohl einen, der uns nicht gefällt, den wir aber mit anderen Augen und weit aufmerksamer ansehen werden, wenn wir erkannt haben, wie eng er mit den allgemeinen Schicksalen unserer Nation verknüpft ist.
Dass die Denkmäler der Kunst eine Geschichtsquelle ersten Ranges sind, insofern sie Zustände der Volksseele beleuchten und Geheimnisse an den Tag bringen, von denen keine andere Quellengattung etwas auszusagen vermag, das ist eine nicht bestrittene Wahrheit, in ihrer praktischen Anwendung bleibt noch sehr viel zu tun übrig. Es bedarf hier einer kombinierten Arbeit, deren Voraussetzung allerdings eine andere als die heute bestehende Arbeitsorganisation der historischen Disziplinen wäre. Kunstwissenschaft und Geschichte müssten sich viel nähertreten; auch schon in der Erziehung durch die Universität. Was ich natürlich nicht für jeden Einzelnen fordere. Auf jeden Fall müssen wir, um Kunst aus Kultur und Kultur aus Kunst zu erklären, über die vagen hypothetischen Analogien, deren schon genug vorgebracht sind, hinauskommen und auch hier in wirkliche Einzelforschung eintreten. Glückliche Zufallsfunde haben schon manchmal ganz unerwartete Lichter aus der Tiefe aufblitzen lassen. Noch fehlt die Methode. Wenn sie erst gefunden ist, stehen der Arbeit auf diesem Gebiet noch große Erfolge bevor.
Die Deutschen sind als eine Rasse ohne Kunst in die Geschichte eingetreten; alle Versuche, eine urgermanische Kunst zu entdecken, bewegen sich in Illusionen. Nicht ästhetische Begabung überhaupt fehlte den Deutschen der Frühzeit, wohl aber waren die Kräfte seelisch-sinnlicher Anschauung, welche die nächste Voraussetzung der bildenden Kunst sind, noch latent. Sprache, Religion, Recht finden wir mit poetischer Phantasie getränkt: – an der Stelle, wo wir die Ansätze zur Kunst zu suchen hätten, eine absolute Lücke. Was in dieselbe eintritt, ist Lehngut, von den ältesten Anfängen an bis herab auf die große umfassende Rezeption unter Karl dem Großen. Gesetzt, die Deutschen wären von der Berührung mit älteren Kulturvölkern gänzlich abgeschieden geblieben, so könnten wir uns nicht denken, dass sie kulturlose Wilde für immer geblieben wären; aber sehr gut könnten wir uns denken, dass sie so gut wie ohne Kunst geblieben wären. Die Kunst ist zu den Deutschen gekommen als untrennbarer Bestandteil der christlich-antiken Kultur. Sie ist gekommen wie die Rose und der Weinstock. Und etwas von dem Charakter eines empfindlichen Fremdlandgewächses hat sie immer behalten. Wo die Kunst Urbesitz eines Volkes ist, da folgen die kunstgeschichtlichen Schwankungen genau denen der allgemeinen Volksgeschichte. Steht bei Griechen oder Italienern das allgemeine Leben der Nation in Kraft, so steht auch immer die Kunst in Blüte; das Welken der einen lässt mit Sicherheit auf Erkrankung des anderen schließen. Einen so genauen Parallelismus kennen wir in Deutschland nicht. Wir haben Zeiten gehabt, in denen das Salz unseres Volkes keineswegs dumm geworden war und dennoch die bildende Kunst gar nicht gedeihen wollte. Ja, es ist klar, die Bedeutung, die die Kunst im späteren Mittelalter und bis in die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts für das deutsche Leben gehabt hat, hat sie nie wieder erreicht. Wollten wir daraus Rückschlüsse von allgemeiner Tragweite ziehen, so kämen wir zu ungerechtfertigt pessimistischen Ergebnissen.
In der Zeit von Karl dem Großen bis auf die ersten Staufer etwa war die Herrin und Pflegerin der Kunst allein die Kirche. Die Kunst war Tradition der Kultur, religiöses Erziehungsmittel; ohne dieses Motiv hätte sie keine Existenz gewonnen. Was die Laien beim Anblick z. B. der großen Bilderfolgen, mit denen sich die Wände der Kirchengebäude bedeckten, unmittelbar ästhetisch empfanden, wir wüssten es gern; aber jede Möglichkeit, darüber direkt etwas zu erfahren, fehlt. Wir dürfen aber für die Wissenschaft die Hoffnung nicht aufgeben, dass verfeinerte Methoden in der Beobachtung des Verhältnisses von Inhalt und Form uns tiefere Aufschlüsse noch geben werden, als bis zu denen wir zurzeit gelangt sind. Wäre die Volksphantasie ästhetisch indifferent geblieben, so hätte auch die Kunst niemals mehr erreicht als nachahmende Konservierung der Formenwelt der christlichen Antike. Die Geschichte des romanischen Stils zeigt uns mit Deutlichkeit eine wirklich lebende Kunst; ohne aktiven Anteil der allgemeinen Phantasie hätte sie niemals hervorgebracht werden können. Wir wissen, dass im Leben des einzelnen Menschen die vielleicht größte Leistung seines Gehirns das Sprechenlernen im Kindesalter ist: etwas Ähnliches bedeutet im Verhältnis des deutschen Geistes zur Kunst die karolingisch-ottonische Epoche. Fügen wir noch hinzu, dass, nachdem die erste Rezeption vollzogen war, der deutsch-romanische Stil sich ohne nennenswerte Mithilfe Frankreichs oder Italiens weiterentwickelte. Was dann die Kunst für ihren zweiten, oder wenn man will obersten Beruf, die Vermittlung religiöser Vorstellungen, geleistet hat, ist noch nie zusammenhängend untersucht worden; eine wissenschaftlich nicht leichte Aufgabe, aber Aufschlüsse verheißend, die auf keinem anderen Wege gewonnen werden könnten. – Nun folgt das staufische Zeitalter und gibt das schönste Beispiel von dem, was durch Kulturgemeinschaft gewonnen werden kann. Der deutsche Kunstorganismus öffnet seine Poren durstig nach allen Seiten. Von Byzanz, von Italien, vor allem von Frankreich wird viel gelernt, doch so, dass alles Erworbene wieder zur Entbindung und Erhöhung der eigenen Kräfte dient. Das glückliche 13. Jahrhundert ist das einzige in unserer Geschichte, in dem alle künstlerischen Kräfte gleichmäßig tätig waren: die Baukunst, die Bildhauerkunst, die Malerei und ihnen das Gleichgewicht haltend, die Dichtkunst. Es ist das am meisten ästhetische Jahrhundert, das wir erlebt haben. Die Ursachen, weshalb schon vor seinem Ende die hohe Stimmung wieder sank, weshalb die Kunst akademisch erstarrte oder handwerklich verflachte, sind gewiss zu finden, aber nur für den, der die Geschichte der Zeit nach allen Seiten übersieht, und eben hier, wo die ästhetische Teilnahme erkaltet, wird die historische erst recht lebendig. – Die neue Blütezeit, von 1430 etwa bis 1530, ist der des 13. Jahrhunderts durchaus unähnlich. Mit einer Einheitlichkeit und physiognomischen Schärfe, wie auf keinem anderen Beobachtungsfelde, macht die Kunst die innere Wandlung der Nation offenbar. Sie ist demokratisch geworden. Zu großen typischen Stilschöpfungen ist die Zeit nicht angetan, es ist die drängende Wirklichkeit des Lebens, mit der sie jetzt auch künstlerisch sich auseinanderzusetzen hat. Damit treten die Bildkünste an die Spitze der Bewegung, während die alte Königin im Reich, die Architektur, beiseite steht und nichts als ihre alten Schläuche für den neuen Wein zu bieten hat. Niemals vorher oder nachher hat im deutschen Volke, und zwar so, dass in ausgeprägtester Weise die mittleren und unteren Schichten den Ton angeben, ein ähnlich überschwängliches Verlangen nach Kunst sich Luft gemacht. Man denke beispielsweise nur an die eine Gattung der Schnitzaltäre, deren jede Dorfkirche drei besaß und die Stadtkirchen oft 30 oder 40, und berechne die daraus sich ergebenden Zahlen; man denke weiter an die nicht leicht einer Kirche fehlende Ölbergs- oder Kreuzigungsgruppe; endlich an die unermessliche Summe sepulkralen Bildwerks: – das gibt schon in der einen, der plastischen Kunst die Vorstellung von einer Massenproduktion, gegen die die gleichzeitige Leistung der italienischen Renaissance (wobei natürlich nur nach der Seite der Quantität der Vergleich gezogen wird) ärmlich erscheint. Dies alles war noch öffentliche Kunst. Zu ihr addiere man die neue, ebenfalls auf Massenproduktion gerichtete Kunst fürs Haus, den Kupferstich und Holzschnitt. Technisch lange schon vorbereitet, hat doch erst der demokratische Drang dieses Zeitalters sie ins Leben gerufen. Unsere besten Künstler haben ihre besten Gedanken diesem unscheinbaren Vehikel anvertraut, wohl wissend, was sie damit gewannen, eine Publizität, gegen welche die von der Wandmalerei des Mittelalters gewährte eine ganz enge war. Es will doch viel sagen, dass diese Nation, welche in ihrer Jugend von Kunst nichts gewusst hatte, welche sie erst von Fremden hatte erlernen müssen, jetzt am Vorabend größter innerer Entscheidungen auf sie als Ausdrucksmittel ihrer Herzensregungen so volles Vertrauen setzte. Denn das ist klar: bei diesem allverbreiteten Hunger nach Kunst handelt es sich nicht um die Kunst allein. Wieder, doch in einem sehr anderen Sinne als in den Anfängen, ist es die Religion, die mit der eindringlichen Stimme der Kunst sprechen will. Kein Historiker kann den Seelenzustand des deutschen Volkes am Vorabend der Reformation kennen, er hätte denn die Bilderwelt dieser Zeit aufs Gründlichste sich zu eigen gemacht. Und ebenso wird kein Kunsthistoriker glauben dürfen, sein Gegenstand sei hier mit Forschungen über Schulzusammenhänge und Stilprobleme erschöpft. – Dann kam im 16. Jahrhundert, nach kurzer Blüte, die Katastrophe. Die deutsche Kunst hat sich von ihr nie wieder ganz erholt. Der ersten Berührung mit der Antike, in der Karolingerzeit, hatte sie ihr ganzes Dasein zu verdanken gehabt; die zweite, in der Renaissance, wurde ihr Verderben. Die Deutschen des 16. Jahrhunderts haben das Wesen der Renaissance niemals begriffen, nur das Äußerlichste ihrer Schale sich angeeignet und willkürlich aufgebraucht. Vielleicht wäre ihnen die durch das neue Problem geforderte Gedankenarbeit zu einem besseren Ende gediehen, wenn nicht zur unglücklichsten Stunde die Reformation die Geister auf ganz andere Zielpunkte abgelenkt hätte. Was die Kunst aus dem Kampf gegen Veräußerlichung des Religionswesens gewinnen konnte, das hatte sie schon in den letzten vorreformatorischen Jahrzehnten gezeigt, und wir dürfen ohne Klügelei sagen: schon damals war sie reformatorischen Geistes voll. In den Jahren des Streites verschob sich alles zu ihren Ungunsten. Auch ihre zweite Lebensader, die volkstümliche, zeigt sich alsbald nach Niederwerfung der Bauernbewegung unterbunden. Sie weicht in die Häuser der Reichen und an die Höfe der Fürsten zurück und wird hier zu dem, was für das deutsche Gefühl das wenigst angemessene ist, zu einer Luxuskunst, einer Verzierung des täglichen Lebens. Die große Schulung und Geschicklichkeit des Handwerks lässt ihr noch einen gewissen äußeren Glanz – mit den tiefsten Interessen der Nation hat sie keinen Zusammenhang mehr. Dem Dreißigjährigen Krieg blieb nur übrig zu vollenden. – Als der Friede wiederkehrte, waren von volkstümlicher Kunst noch einige verkümmerte Reste übrig, die aber weiterhin aus Nahrungsmangel vollends zugrunde gingen mit einziger Ausnahme des katholischen Südens, wo die Verwüstung nicht so tief eingedrungen war, und wo die Kirche mit Aufbietung großer Mittel die Wiederherstellung eines Kunstlebens durchsetzte. Dass die Barockkunst in Bayern, Oberschwaben und den geistlichen Staaten am Main und Rhein eines der glänzendsten Kapitel der deutschen Kunstgeschichte ist, dass in der fremden Formensprache viel deutsche Gedanken zum Ausdruck kommen, ja dass selbst volkstümliche Anpassung nicht fehlte, dieses wird heute nicht mehr verkannt. Wir haben eher Anlass vor Überschätzung – nicht ästhetischer, aber historischer – zu warnen. Die Kunst des 18. Jahrhunderts gehört nicht zu den Mächten, welche die Erhebung unseres nationalen Lebens vorbereiteten. Je mehr dieses sich in seiner eigentümlichen Kraft entfaltete, umso schwächer wurde sie, die Kunst. Parallel aber dem Sinken der produktiven Kraft geht eine Verfeinerung, Erweiterung und bewusste Pflege der rezeptiven Fähigkeiten, die in der deutschen Kultur etwas Neues ist. Goethe ist darin vorbildlich für den Deutschen des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert wird in der Kunstgeschichte keine tiefen Spuren hinterlassen; sicher ist doch diesem Jahrhundert die Kunst etwas, sogar viel gewesen; nur war es nicht die eigene Kunst. Das Jahrhundert Goethes gleicht in seiner Traditionslosigkeit und seinem Vertrauen auf ein in der Zeiten Ferne liegendes klassisches Ideal keinem früheren so sehr als der Karolingerzeit.
Mit dieser Skizze habe ich zeigen wollen, dass eine Darstellung der Geschichte der deutschen Kunst erheblich mehr zu umfassen hätte, als was man gewöhnlich der Kunstgeschichte zuschiebt. Nicht auf etwas mehr oder weniger »kulturgeschichtlichen Hintergrund« kommt es an, sondern darauf, das Verhältnis der Nation zur Kunst in seiner Ganzheit, in seinen Bedingungen wie in seinen Wirkungen, nach der produktiven wie nach der rezeptiven Seite hin historisch zu erfassen. Unter den Aufgaben, die der Geschichtswissenschaft vorgelegt werden können, wird es freilich eine an den Bearbeiter größere Anforderungen stellende nicht leicht geben. Prinzipiell unlösbar ist sie nicht.
Inhalt
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.