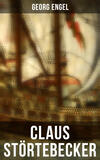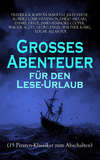Kitabı oku: «Hann Klüth: Roman», sayfa 11
Sie verzog den Mund und nickte wie zur Bekräftigung mehrmals vor sich hin.
Da war es heraus, das Innerlichste von ihr, jenes Abenteuernde, Irrlichtierende, das Bruno nur dunkel geahnt hatte, das ihn jetzt aber mit solcher Macht fing, daß er, halb seiner selbst beraubt, die Hände gegen die Augen preßte, um sich zurückzuhalten, sich zu zähmen.
»Hast du was?« fragte sie.
Er verneinte. »Kopfschmerzen.«
»Ja, ja, es ist auch kalt,« brach sie ab. »Wollen schlafen, ich bin müde.«
Damit lehnte sie sich in das Leder zurück, und bald verkündeten ihre regelmäßigen Atemzüge, daß ihrem Willen auch der Schlummer dienstbar wäre.
Bruno rieb sich die Stirn und sah neugierig auf sie hin.
Ob sie wirklich schlief? – Oder ob die raffinierte kleine Person ihm nur zeigen wollte, wie lieblich sie aussah, wenn das Mondlicht über sie huschte, und wie weiß die Zähne hinter den halbgeöffneten Lippen hervorblitzen konnten.
Nein – nein, er wandte sich ab, er blickte auf die Chaussee hinaus, auf deren Schneedecke die Pappeln schwarze Schatten warfen, wie lange Schlangen, die auf das Gefährt zukriechen wollten.
Aber auch dieser Anblick zerstreute ihn nicht.
Nein, nein.
Die Schläferin rührte sich. Sie saß jetzt aufgerichtet, nur der Kopf war hintenübergesunken, während die Brust sich leise hob und senkte.
Ob sie wirklich schlief?
Schon nahten die ersten Häuser der Stadt.
Da hatte Bruno ausgekämpft. Die kleine, schwarze Hexe neben ihm war stärker als er.
Ziemlich unsanft, beinahe rüttelnd fuhr er über ihren Arm.
Gegen sich selbst wollte er sie bewahren. »Wach auf, wach auf!« schrie es in ihm.
Aber die Schläferin sank, der Bewegung folgend, in voller Schlaftrunkenheit gegen die Schultern des Mannes.
Oh, wie weich rundeten sich ihre Lippen.
Er hob ihr Kinn, ruhig atmete sie fort, selbst die Grübchen in ihren Wangen konnte er bei dem trüben Lampenlicht gewahren, und leise, leise, wie ein vorsichtiger Dieb, stahl er ihr von den kostbaren Früchten.
Da gab es einen Stoß. Ruckartig hielten sie.
Ob Hann zurückgeblickt hatte?
Wie taumelnd sprang der grobkörnige Geselle von dem Schlitten herab, dann öffnete er den Schlag und grollte: »Wir sind da.«
»Schon?« gab Bruno atmend zurück, und auf Line deutend, setzte er hinzu: »Fest eingeschlafen.«
Hann starrte in dumpfem Staunen auf sie hin.
Und erst nach geraumer Zeit gelang es den beiden, das Mädchen zu wecken.
Verwundert blickte sie sich um, dehnte sich, und dann lachte sie und meinte gleichgültig: »Ah – das war geschlafen. Aber seht da oben, da lauert schon die Alte auf mich. Sie brennt noch Licht. Na, kommt gut nach Hause.«
Durch die klingelnde Haustür sprang sie die Stufen hinauf, nickte nocheinmal zurück und verschwand.
Als Hann nach einer Weile im Schritt zurückkutschierte, da hielt er in seinem Fausthandschuh ein Zehnmarkstück. Das hatte ihm Bruno beim Abschied in die Hand gedrückt, halb als Geschenk, halb als Trinkgeld. Und der unbeholfene Bursche besah es sich beim Sternenlicht, kratzte sich hinter dem Ohr und seufzte tief auf.
»Hüh, Schimmels!«
X
Zwei Tage später – bei Sonnenaufgang – da fand der einzige, goldige Strahl, der durch das hochangebrachte Traillengitter hindurchdringen konnte, den Moorluker Philosophen fröstelnd und mit blödem Haupt auf der Pritsche des Militärgefängnisses hingestreckt und mit dumpfem, verwundertem Ausdruck an den grauen Mauern hinaufstarren.
»Nee,« stellte er fest, indem er erwartete, Siebenbrod müsse ihn ja zuletzt mit einem Fußtritt aus dem schweren Traum erwecken, hielt sich den Kopf und schloß die Augen. Aber der liebe, erlösende Tritt Siebenbrods blieb aus, und das einzige, was zu ihm drang, war vom Hof aus ein Kommandoruf, dem ein hartes, klirrendes Geräusch folgte, wie wenn Gewehre taktmäßig auf das Pflaster gestoßen werden.
»Je – je – «
Hann riß abermals die Augen weit auf.
Halb zerschlagen kroch er von dem harten Marterlager herunter, um von neuem kopfschüttelnd um sich herum zu stieren.
Da in der Ecke die Pritsche mit der Wolldecke, an der anderen Seite ein Kasten, der häßlich roch und beinahe aussah, als ob man seine Notdurft darein verrichten sollte. Sonst nichts.
Kein Stuhl – kein Tisch. Auf vier Seiten lang und breit nur kahle, graue Mauern, und eine niedrige, braune Tür, die von innen keine Klinke bot.
Hann strich sich die Haare aus der Stirn und schüttelte sich.
Darauf schlich er zur Tür, um sie doch wenigstens einmal zu untersuchen, als an dem Holz in Manneshöhe eine Klappe herabsank, während ganz dicht etwas polterte.
Nun, das war doch gewiß ein gutes Zeichen, hoffnungsfroh steckte Hann die Hand durch die Öffnung, da erhielt er mit einem harten Gegenstand einen Hieb auf die Finger, daß er schreiend zurückfuhr, und zu gleicher Zeit wurde die Klappe durch ein bärtiges Gesicht ausgefüllt.
»Nicht so hitzig, Patron,« knasterte eine Stimme, die sehr geschäftsmäßig und keineswegs wohlmeinend klang. »'s kommt schon.«
Ein irdener Wasserkrug wurde hereingereicht, ein halbes Kommißbrot, und der Verschluß hob sich wieder.
»Halt,« schrie Hann in aufsteigender Verzweiflung. »Männing, weswegen – «
»Jawoll,« knasterte die barsche Stimme, und der Eingeschlossene hörte, wie die Klappe eilig wieder verriegelt wurde.
Ja, da sollte doch Gott den Deuwel totschlagen? – Was war denn nun?
Erschöpft, mit ängstlich klopfendem Herzen, sank Hann von neuem auf die Pritsche und starrte auf den Krug und das Brot.
Fi – das war ja nicht einmal etwas Warmes, wie es ihm Mudding doch täglich gab, und dabei fröstelte ihn, daß ihm die kalten Schauer die Brust zusammenschnürten.
»Präsentiert das – Gewehrrr!« scholl es schrill von unten. Darauf ein klirrender Schlag.
Je, ja, waren das nicht Soldaten? – Hann erschrak so sehr, daß ihm beinahe der Krug entglitten wäre, – Bilder, lauter fremde Bilder zuckten plötzlich durch seine langsame Vorstellung. – Ein Gasthofszimmer, Uniformen, nackte Menschen! —
Wo war er denn gestern gewesen?
Mit Gewalt schob er sich plötzlich den Kasten zurecht, kletterte hinauf, und nun konnte er durch die Eisengitter hinuntersehen.
Ein weiter, schneebedeckter Hof, eingeschlossen von einer roten Ziegelmauer, vor deren einzigem Tor ein Soldat im grauen Mantel mit geschultertem Gewehr ruhig auf und ab wanderte. An der Seite, beinahe unter ihm, zwei Reihen Infanteristen, die unter Leitung eines Unteroffiziers mit roten Händen und roten Gesichtern Griffe übten. Unbeweglich, nur die Arme lebendig, immer Schlag auf Schlag.
»Das Gewehrrr über – Gewehrrr ab. – Das Gewehr über!«
»Also doch!«
Schwerfällig stieg Hann herab. Nun wußte er genug. Und nachdem er auf seiner Pritsche einen tiefen Zug aus der Kanne getan, schlug er sich mit der Faust auf die Stirn.
Ja – ja – er hatte es also doch erlebt. – Wie war's doch?
– —
– —
Ein lärmender Zug junger Fischer- und Bauernsöhne vor dem Voglerschen Gasthof, und immer zehn werden zugleich hineingeführt.
Unter der ersten Abteilung befindet sich – Hann.
Er hört noch die Stimme oll Kusemanns, der zur Feier des Tages mit in die Stadt gekommen.
»Immer an den großen Zeh denken. Das hilft.«
Ein kleines quadratisches Vorzimmer, weiß getüncht, mit einigen Kleiderrechen und Stühlen. Drinnen ein Unteroffizier – richtig, Hoffmann hieß der Brave – der sich unternehmend einen mächtigen, starrenden Schnauzbart dreht und, nachdem er mit einem überlegenen Blick die Schar gemustert, das Kommando erteilt: »Ausziehen!«
Die Burschen entkleiden sich.
»Den Rock auch?« fragt Hann Herrn Hoffmann, nachdem er sich seines Überziehers entledigt.
»Selbstverständlich – wie Gott euch geschaffen hat, Kerls,« befehlt der Unteroffizier, martialisch im Zimmer auf und nieder schreitend.
Hann streicht sich über die nackte Brust. Sein Herz klopft, als er so auf die anderen schielt.
»Die Büxen auch?« hält Hann nach einer Weile von neuem inne.
»Donnerwetter – Mensch – was sind das für Reden?« wettert der Aufseher.
»Aber es is ja man wegen der Schanierlichkeit.«
»Aha, ich weiß schon, Sie sind wahrscheinlich auch so einer.«
Ein verdächtiger Blick streift ihn, während Hoffmann rasch in seinem Notizbuch etwas revidiert.
Aber Hanns methodischem Sinn ist diese Andeutung nicht verständlich genug. »Was für einer?« will er sich eben vorsichtig erkundigen, da erhält er einen Stoß gegen die Schulter, daß die streitigen Hosen ihm von selbst abfliegen, und eine wütende Stimme zischt dicht an seinem Ohr: »Maul halten – vorwärts – das weitere wird sich finden.«
– Die zehn nackten Menschen stehen plötzlich in einem niedrigen, weiten Gasthofszimmer, vor einem schmalen, langen Tisch, hinter dem mehrere Offiziere und einige Herren in Zivil sitzen. An einem Nebentische schreiben zwei Unteroffiziere.
»Heinrich Kagelmacher,« ruft es nach einigem Murmeln und Vergleichen von da.
»Hier,« meldet eine Stimme neben Hann.
»Stand?«
»Fischer!«
»Woher?«
»Aus Hermsmühl.«
»Geboren – Konfession?«
»21. Oktober 1877. – Evangelisch.«
»Kagelmacher, Heinrich,« murmelt daneben der zweite kontrollierende Beamte. »Stimmt.«
»Kagelmacher,« fordert der Unteroffizier Hoffmann und leitet den eben Aufgerufenen unter eine Art Galgen, wo die Länge und das Maß festgestellt werden.
Der Querbalken senkt sich.
»1,70,« meldet Hoffmann.
»Kagelmacher, Heinrich – 1,70,« murmeln beide Schreiber.
»Gut, na, nu kommen Sie mal her,« tönt jetzt eine bierfette, gemütliche Stimme, und ein beleibter Mann mit rotem Gesicht, dicken, wulstigen Lippen und weißen, pudligen Haaren erhebt sich und steht nun auf etwas zu kurz geratenen Beinen und mit offenem Uniformrock da, während er mit seinem schwarzen Auskultationsrohr winkt.
»Das muß woll so eine Art Doktor sein,« denkt sich Hann Klüth, während sein Nebenmann untersucht wird. Der ist jedoch ein großer, kräftiger Kerl, daher dauert das Beklopfen und Behorchen nur kurze Zeit. Der Oberstabsarzt, der von dem Bücken noch röter geworden, streicht Kagelmacher wohlwollend über die nackte Brust und blinzelt ihn schlau an: »Na, klagen Sie vielleicht über was?«
Jetzt wird der Bursche blutrot: »Herzklopfen,« bringt er zögernd hervor.
Kaum ist das Wort gefallen, da schickt der Untersuchende einen merkwürdig schlauen Blick zu dem stattlichen Oberst mit dem Habichtskopf hinüber, der in der Mitte der Tafel sitzt, und in demselben Moment erhebt sich dieser, schiebt seinen Stuhl wie empört zurück und wandert, leise Verwünschungen ausstoßend und säbelrasselnd, im Zimmer auf und ab, während er im vollen Zorn mehrmals auf ein Blatt Papier schlägt, das er in der Hand hält.
Mit einem Male bleibt er »baff« vor einem eleganten, jungen Herrn stehen, der, ein Monokle im Auge, die Begebenheit, weit über den Tisch gebeugt, verfolgt.
»Na, was sagen Sie zu der Bescherung, Herr Landrat?«
Der Angeredete erhebt sich und flüstert dem Oberst etwas zu. Darauf zuckt der die Achseln, nickt aber, und beide lassen sich wieder auf ihre Plätze nieder.
Unterdessen hat der Oberstabsarzt, immer mit seinem schlauen Lächeln, bei Kachelmacher tatsächlich starkes Herzklopfen konstatiert. »Na, da wird wohl nicht viel zu machen sein – treten Sie mal vorläufig zurück, Mann.«
Der Nächste.
Er ist gleichfalls aus Hermsmühl und klagt über dieselbe Beschwerde.
Der Oberstabsarzt bemerkt gegen den Landrat, daß dieses Hermsmühl in seinem Kreise doch ein höchst ungesundes Loch sein müsse.
Als aber auch bei den nächsten drei Hermsmühlern, die zwar verschüchtert über nichts zu klagen haben, unter großer Zufriedenheit des Untersuchenden »starkes Herzklopfen« festgestellt wird, pfeift der Oberstabsarzt eine kleine Tonleiter, und von irgendwoher fällt ein unterdrückter Fluch: »Die Bande.«
Inzwischen ist es sehr still im Zimmer geworden. Die Hermsmühler stehen in einer Ecke zusammengepfercht wie ein Häuflein nackter Sünder, das auf den Henker lauert.
Hann perlt der Schweiß von der Stirn, obwohl sein entkleideter Körper vor Kälte zittert.
Er merkt, daß hier »nicht alles richtig« ist.
Da —
»Johann Klüth,« ruft es von dem Unteroffizierstisch. Er stottert etwas, wird von seinem Freund Hoffmann unter den Galgen befördert, der Querbaum fällt ihm nicht gerade sanft auf den Kopf, und eine geringschätzige Stimme meldet: »1,65.«
»Klüth – Johann – 1,65,« rapportieren die beiden monotonen Echos gleichgültig.
Was nun kommt, gleitet wie ein Traum vorüber. Er befindet sich unter den Händen des dicken Herrn, es wird etwas von einem gesunden Herzen gesprochen.
Hierauf allerlei unverständliche Bemerkungen, und dann das bedauernde Wort, daß es sehr schade wäre, aber der Mann hätte linksseitig einen kürzeren Fuß.
»Ersatzreserve ohne Dienstpflicht.«
»O je – o je – Hurra,« stößt er hervor.
Was das bedeutet, das hat oll Kusemann Hann bereits vorher erklärt. Das wäre das Beste, das Allerbeste, Hanning, ja, wenn das dich so passieren könnte —
Und über Hanns Gesicht verbreitet sich ein Leuchten, er lacht vor Vergnügen und will eben, nackt wie er ist, eine Art Dankverneigung machen, da bemerkt er mit Schrecken, wie sich der Oberst mit beiden Fäusten auf den Tisch stemmt und schreit, als ob der Kalk von den Wänden fallen sollte. Warum er sich so aufregt, das versteht Hann nicht. Er hört bloß verschwimmend: »Frechheit – hier Freude Ausdruck geben – Drückeberger von Kaisers Diensten – Exempel gegen solche Sozialdemokraten statuieren – stehen zum Glück am heutigen Tage alle unter den Kriegsartikeln – die Hermsmühler Bande noch besonders vornehmen – «
Und als er sich halbwegs auf sich selbst besinnen kann, da sieht er mit dumpfem Erstaunen, wie ihn zwei Soldaten in die Mitte nehmen, um ihn nach einem Marsch durch die Stadt hinter der roten Mauer abzuliefern.
Es ist Spätnachmittag, und noch immer hält er das Brot und den Krug in der Rechten und der Linken.
Was is denn nu?
Is das Kaisers Dienst??
Und von unten schallt es herauf, es werden Monturstücke geklopft, und eine frische Stimme summt dazu:
»Wer will unter die Soldaten,
Der muß haben ein Gewehr,
Der muß haben ein Gewehr,
Das muß er mit Pulver laden
Und mit einer Kugel schwer.«
XI
Da ward aus Abend und Morgen der andere Tag.
Der Mittelarrest hatte, wie alles Leid auf der Welt, auch sein Gutes. Hann fand, daß er noch niemals so ungestört hätte nachdenken können wie hier. Denn immer wurde er in Moorluke davon aufgescheucht, einmal von Siebenbrod, oder von Mudding, am meisten jedoch durch oll Kusemanns unzeitige Späße.
Hier aber, ja hier hatte man solche Leute woll ordentlich lieb. Draußen auf dem Gange patrouillierte sogar direkt ein Aufseher auf und nieder, damit nur alles hübsch still bliebe, und nichts ihn störe.
Ja, ja, für die Gedanken war das doch eigentlich ein wunderhübscher Raum. Man brauchte nichts zu arbeiten, und wie pünktlich dabei noch für einen gesorgt wurde.
Da stand schon wieder der Krug mit frischem Wasser und daneben ein neues halbes Kommißbrot, und der Gefangene streifte sie mit einem dankbaren Blick.
Nur etwas kalt war es ja, den Ofen hatte man wahrscheinlich vergessen, allein dafür blieb ihm schließlich die wollene Schlafdecke. Und er schlug sie um sich und hockte nun, bis zur Nasenspitze eingehüllt, auf der Pritsche und sah aufmerksam in die eine graue Ecke, wo sich eine Spinne ein dickes Gewebe gebaut hatte.
Langsam, langsam, wie Wanderer, die mühsam über ungepflasterte Landstraße dahertappen, kamen und gingen die Gedanken.
Was da allmählich für schnurrige Gestalten vorbeizogen. Der liebe Gott und oll Kusemann, der Kaiser und Line, Malljohann und die Spinne.
Und Hann saß da und nickte nachdenklich hinter ihnen her, und während von unten wieder die Kommandorufe: »Das Gewehrrr über – Gewehrrr ab – das Gewehrrr über!« herauftönten, da merkte der Einsame gar nicht, wie er im Grunde schwere Arbeit verrichtete, eine, die sehr selten geworden, nämlich das Hauptbuch des Lebens umblättern und addieren und subtrahieren und schließlich zu einem Resultate gelangen. Zu einem wirklichen Fazit, das dann wieder ins Leben umgesetzt wird.
Freilich, das kann nicht jeder, es fehlen den meisten ein paar unumgängliche Posten dabei, nämlich Wahrheit und Bescheidenheit.
Aber der eingesperrte »Sozialdemokrat« Hann Klüth, der hatte das Glück, diese friedensstille Zelle zu finden, die sein Vorhaben so sehr begünstigte.
Und so vermochte er's.
– —
Jetzt is man so alt geworden, und doch is meistens allens schiefgegangen, was man sich in die Kinderjahren und auch später noch vorgenommen und vorgeträumt hat.
Erst hat man sich's im Elternhaus so recht mollig sein lassen wollen, ja, prost Mahlzeit, da is Dietrich Siebenbrod dazwischen gestiegen – nachher hat man doch für sich selbst so'n bißchen was ins Trockne bringen mögen – aber, allens Dummheiten, wie kann ein abhängiger Bootsmann was aufs Trockne bringen? – Zuletzt hat dann das dumme Herz noch was abkriegen sollen, da hat es sich aber zu hoch verstiegen und muß zusehen, wie ein anderer die »sie« im Schlitten abküßt, wenn auch man im Schlaf. – Nee, das muß nun alles hinter einen liegen, einmal muß man doch Schluß machen und vernünftig werden, und jedes Ende hat auch was, so recht was Beruhigendes. Da kann einen nichts mehr irrig machen, denn das Ende is eben – das Ende.
Na … aber was soll man dann hinterher?
I, Jünging, das is doch ganz einfach – der Mensch muß ebend nach seinem Glück aussehn.
Ja, aber – hum – was is denn nu eigentlich das Glück?
I, das muß doch rauszukriegen sein, was soll es denn groß vorstellen?
Kuck – ich hab's all, dagegen wird keiner was anreden: das Glück is ein großer Haufe Talerstücke.
Jawoll, das is sicher, wer auf so'n mächtigen Haufen sitzt, der sitzt auf einem verdeuwelt hohen Berg, von dem aus er über die ganze Welt fortgucken kann, wenn's ihm Spaß macht. Und wer weiß, ob der Berg, auf den der Deuwel einst unsern lieben Heiland geführt hat, nich auch so ein Haufe Geld war, denn wer das hat, das is doch klar, der hat das Glück einfach so in Wispelsäcke stehen und —
Halt, Jünging – stopp, nich so fix – alles kann man sich schließlich auch nich kaufen. Zum Beispiel die Gesundheit und dann einen anschlägigen Kopf und dann – Liebe. Nein, das is wahr. Die sackermentsche Liebe besonders nich. Wenn ich auch auf einem Wispelsack mit Talerstücken säß, so hoch wie Hollandern sein Speicher, Line würd mich deswegen doch nich lieber haben. – Und dann, was sagen woll die alten, weisen Sprichwörter dazu? »Reichtum macht nich glücklich.« – Kuck, da haben wir's ja. Ich werd' doch nich so dumm sein, gegen ein Sprichwort anlaufen zu wollen. Ne!
Aber, was nu weiter?
Das Glück muß also doch wo anders stecken. Na, wollen eins sehen. —
Da fällt mich so ein, wo kommt überhaupt der Reichtum her? Sieh, das is doch 'ne schnurrige Frag'. Der Reichtum is doch nich von Anfang an dagewesen, bei den sechs Tagewerken kommt er nich vor. Er muß also doch erst so allmählich in die Welt gekommen sein, als der liebe Gott die Menschens zur Arbeit verflucht hat, was ja eigentlich gar nich väterlich von ihm war – Holl eins an – die Arbeit, stopp, Kinding, stopp, das is mir denn doch ganz einleuchtend, daß aus der Arbeit sich eigentlich erst all der Reichtum herschreibt. Und wenn Konsul Hollander so viel Säck' mit Talerstücken stehn hat, wie er hat, dann hat er eigentlich lauter Säcke mit Arbeit dastehen, mit unsre Arbeit, mit fremde Arbeit. Ja, überleg dich mal, darf denn das der Mensch? Darf einer, und wenn er dreist Konsul is, die Arbeit vom andern wegnehmen und auf seinen Speicher stellen? – Pfui, ich würd's nich tun. Ne, mit dem Reichtum bleib mir einer vom Leibe.
Aber nun vielleicht mit der Arbeit?
Vielleicht steckt's darin.
Denn, daß der liebe Gott mit ihr eine Strafe gegen das menschliche Geschlecht hat ausüben wollen, i, das mag ja auch woll bloß so ein Läuschen1 vorstellen; ich frag man, wozu hätt' der liebe Gott sonst am Anfang von alle Geschicht selbst so hart geschuftet, daß er ja eigentlich richtig als der erste Wochenarbeiter gelten kann. Ne, die Sache muß ihm doch höllischen Spaß gemacht haben, und deshalb wollte er den Menschens vielleicht auch von der Art Spaß was zukommen lassen.
Na, und is es nun nich möglich, daß in der Freud' an dem Spaß das Glück stecken tut? —
Hier sah Hann, wie in der grauen Ecke das Spinngewebe erzitterte, und daß die Bewohnerin, einen langen Faden ziehend, hin und her lief. Er schüttelte das Haupt.
Ne, Hanning, was redst und redst du auch heute. Kuck doch erst eins hin. Was arbeitet da das Biest? Eine Bettstell' baut es sich und frißt's dann wieder auf, wenn Not an'n Mann is. Und was arbeit't der Mensch? – Nun, er baut ein Haus, damit er drin wohnt, und er zimmert einen Tisch, damit er dran ißt, und er haut Holz, damit er sein Essen daran kocht, und er fängt Fisch', wie ich, damit auch was zum Kochen da is. Also der Mensch arbeitet bloß um das gewöhnliche, gemeine Leben. Um weiter nichts. Aber daß den Maurer das Hausbauen und den Fischer das Fischfangen so besonders glücklich macht, das hätt' ich auch noch nich erlebt. Wenigstens bei uns in Moorluke is das nich so.
Zwar die Pasters sagen, daß Arbeit besser machen soll. Spaß. – Ich frag man: bünn ich denn so'n Musterspiegel, weil ich alle Tag' ein paar Wall von arme Heringen aus'm Wasser zieh' und sie um mich herum krepieren seh'? – Und für wen is denn schließlich all die Rackerei? Doch bloß für den Schwamm und den Wurm. Denn was nich verfault, das zermürbt. Ne, das seh ich woll, das Glück von die Arbeit is auch bloß solch ein Trostmittel vor die Menschheit. Wollen uns doch lieber nach was anderem umkucken!
Aber zuerst will ich nu schlafen! —
– —
Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Als Hann seiner Spinne freundschaftlich »Guten Morgen« geboten und nun feierlich auf seiner Pritsche thronte, da wurde auf dem Hof ein helles Signal geblasen. Fröhlich schmetterte es ringsum, die starken Luftschwingungen stießen sich förmlich an den Mauern.
»Was is?« fragte Hann unwillig über die Störung.
»Rataplan – Ratatata – «, wirbelten ein paar Trommeln zur Antwort. »Ratatata.«
»Was nu? – Nu kommt woll der Kaiser?«
Aber bald hörte der Eingesperrte an den dröhnenden, klappernden Tritten, daß nur eine Truppenabteilung zum Tor hinausmarschieren müßte.
»Man gut, daß sie fort sind,« dachte Hann, der dies Trommeln und Blasen für einen Eingriff in seine Rechte betrachtete. »Man gut.«
Alles war wieder still, Hanns Gedanken jedoch waren ehrfürchtig neben dem Kaiser stehengeblieben. In seinem Geist nahm er den Hut ab.
»Ja, das is noch was,« sagte er. »Das nenn' ich noch 'ne Stellung.«
Er bedeckte sich wieder.
Ne, bei uns Niederen, da steckt es nich, aber bei solch einem Herrn, der die Macht hat, da is woll's Glück zu Hause. – Ich kann mir man denken, so einer pfeift – hüh – und dann gleich zehn Dieners schmieren ein Butterbrot, – und pfeift wieder, und – hast du nich gesehn – zehn andere ziehen ihm die Stiebeln aus. Ja, das laß ich mir noch gefallen – Aber – hm – ne, wie is das denn mit den Attentaten? Ich besinn' mich doch, wie oll Kusemann einst vorlas, mit den russ'schen Kaiser? Da soll es so 'ne Sorte geben, die es für ehrenvoll halten, so 'nen hohen Herrn mit allerlei Mordwerkzeuge auf den Leib zu rücken? Ich trink 'ne Tasse Kaffee, und dann is da Gift drin, ich drück' jemandem freundschaftlich die Hand, und die Karnallge stößt mir zur Antwort ein Brotmesser ins Genick. Pfui Deibel, mir könnten sie ja solche Kaiserstellung umsonst anbieten. Und was so 'ne arme Kaiserfrau zu Hause woll vor Angst aushalten muß – Ne, das wär ja rein zum Verzagen.
Aberst, das merk ich schon, mit allens, was unsre menschlichen Augen rund um sich herum sehen können, da bin ich nu durch. Is aber überall das Glück nich dabei gewesen. Na aber – daß mir das zuletzt noch einfallen muß – vielleicht verhält sich das mit dem Glücke nich anders wie mit dem lieben Gott; – es is unsichtbar. —
Hier schlug er vor Freude über den Einfall schallend auf die Pritsche, daß das Spinngewebe in der Ecke erzitterte. Und da er grade beim »lieben Gott« angelangt war, so fuhr er fort: Ja, es mag wohl in den innerlichen Geschichten liegen, vor allen Dingen in der Frömmigkeit. Wer fromm is, dem sind ja alle Seligkeiten versprochen.
>Selig ist – <, na, ich hab das auch nicht mehr so im Kopf, aber das is wahr, wer so recht fest an oben hängt, der kommt sich wohl zum Schluß vor, als ob ihm an Händen und Beinen ein langer Faden angebunden wär', wie bei die Hampelmänner auf dem Weihnachtsmarkt, und oben wird nun bei jedem Schritt gezogen, so daß man am Ende gar nich fehl gehen kann. Wahrhaftig, das wär doch recht sicher! – Und is das nicht auch beinah' so, wie bei den neumodischen Feuerversicherungen? Da heißt's: >Laßt ruhig zu Haus brennen, die Feuerversicherung Phönix zahlt nachher doch.< Sieh, dies Stück könnt' mir eigentlich gefallen.
Na ja, wenn bloß der lahme Krischan nicht hinterher hinkte.
Wer nämlich so eine himmlische Versicherung hat, wird sich der nich fix auf die faule Seite legen? – Und dann – gegen die Bettelei haben sie Vereine gegründet; wird jeder gleich eingesperrt. Zu dem lieben Gott aber gehen dieselben Vereine hin und betteln da ganz ausverschämt. – Denn was is Beten anders als Betteln? Und um was für Dinge belästigen sie nun den lieben Gott? Der eine wegen sein krankes Schwein, der andere um eine Nacht bei einer hübschen Dirn', und Bauer Haberkorn auf Poggenpfuhl hat den liefen Gott ganz andächtig gebeten, ob er seine Frau nich an einem giftigen Pilz draufgehn lassen wollt'. Und wenn nun der erste am selbigten Tag um Regen und der zweite um Sonnenschein bittet, was soll der Herr da anfangen? – Da is gar keine Menschenmöglichkeit.
Ne, mich is das grad'zu entgegen, wenn ich so die vielen Menschen wie Spitzbuben in die Kirch' schleichen seh', um den lieben Gott was aus der Tasch' zu ziehen. Ich hab' mich immer gedacht, hinbringen müßten sie was, hinbringen, und wenn's die lumpigste gute Tat wär', zum Beispiel einen Betrunkenen nach Haus tragen, damit er kein Elend anricht't. Und nich immer bloß die off'nen Bettlerhänd' hinhalten. Denn was muß das auf den lieben Gott woll auf die Dauer für einen Eindruck machen? – Ne, wenn ich Er wär', ich hätt' all längst das Schild >gegen Bettelei< an der Kirch' anschlagen lassen.
Ja, aber nun überhaupt mit dem lieben Gott —
Diesen Satz beendete Hann Klüth jedoch nicht, sondern erschrak und zog scheu die wollene Decke enger um sich, denn die Abenddämmerung war bereits niedergesunken.
Er fröstelte zusammen.
Oll Kusemann meint ja, man könne gar nich wissen, ob – hm – ne, ne, oll Kusemann, den lieben Gott laß ich mir nich ausreden, man braucht ja bloß die Augen zuzumachen oder in eine recht wüste Gegend zu gehen, dann fühlt man ja ordentlich, wie nah er is.
Aber – aber ich sagte doch von Wissen.
Ob das ganz genaue Wissen von allen Dingen, wie es hier die Professors in der Stadt haben, ob das die Leut' nu wohl sehr glücklich macht?
Darüber muß ich nu direkt lachen. Denn die Studentens, die ich auf dem Bodden spazieren fahr', die sagen doch immer, was der eine von die Professors weiß, davon weiß der andere just immer das Gegenteil. Und wenn der eine rausklüstert, alles Leben käm' aus der Luft, dann find't der andere, es käm' aus dem Wasser – und Professor Römer sagt, es käm' aus dem alten Testament. Und wie düsig muß wohl den Studentens zumute werden, wenn die drei ihnen das so hintereinander einremsen.
Ne, vor so'n Elend bewahr' mich der liebe Himmel —
»Maul halten!« schrie auf dem Gange der Wachthabende und klopfte an die Tür. Und Hann mußte sich auf seinem Lager ausstrecken, während sein Atem regelmäßig in der Kälte ausdampfte.
* * *
Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. – »Nun wird mich das aber mit der Zeit recht ungemütlich,« sprach Hann Klüth. »Ich frier hier ja, wie ein Schneider, und all' meine Glieder werden mir lahm. Soll ich denn nu fürs Vaterland auf immer hier eingesperrt bleiben? Das halt' ich wohl gar nicht mehr lange aus. Und das Kommißbrot liegt mir auch schon wie Steine in'n Magen. Dazu das kalte Wasser, das schuddert mich durch den ganzen Leib.
»Ich hab' ja eigentlich gar nichts getan? Weshalb ist man bloß so streng zu mir?«
Er erhob sich schwerfällig und schlurfte mit steifen Beinen in die Ecke zu seiner Freundin im Spinnenhaus. Aber wie erschrak er, als er das Tierchen mit eingezogenen Füßen, erstarrt, eine Art Krümel, vorfand.
»Herr im hohen Himmel,« stotterte er. »Die is also auch bereits so weit? Erfroren? Und bei mir kann's auch jeden Moment kommen, denn mir is all recht elend.« Ganz zerschlagen wankte er wieder auf seine Pritsche, dort sank ihm sein Kopf schwer auf die Brust, und die Kälte senkte immer größere Müdigkeit und Erstarrung auf ihn.
»Merkwürdig, ganz merkwürdig,« murmelte er, »weshalb eigentlich die Menschen so schlecht zueinander sind? Und dabei gibt es doch nichts Besseres, als wenn man jemanden recht lieb haben kann.
»Aber was geht mich das an? – Ich werd' keine mehr lieb haben, und mich wird auch keiner mehr lieb haben, denn ich leg' mich nu hin, wie die Spinne, und steh nich wieder auf.«
Damit bettete er die graue Decke über sich, richtete die blauen Augen nichtssagend auf das Traillengitter, durch das der frostige Tag gleichgültig hereinsah, und lag regungslos.
Da erhob sich ein Gepolter an der Tür. Das bärtige Gesicht erschien wieder in der Klappenöffnung und schrie, Hann möchte ihm den Topf abnehmen, er sei sehr heiß. »Extraration,« setzte er erklärend hinzu, »vierter Tag. Um ein Uhr Ausgang.«
Da saß nun Hann, lachte über das ganze Gesicht und atmete neubelebt den Dampf ein, der ihm aus dem heißen Napf entgegenquoll.
I, das waren ja Bohnen und Schweinefleisch, na, nu sieh bloß mal, und wie warm, wie schön warm.
Und nachdem er heißhungrig sein Mahl längst beendet, saß er noch immer und streichelte dankbar den Napf.
»Kuck,« sprach er zu dem Topf, »zu Haus, bei Mudding, eß ich so was aus verschiedenen Gründen, die ich hier aus Anstand nich anführen will, gar nich gern. Aber hier? – hm! Wenn ich mir überleg', wie leicht, wie kindsleicht hat es nich ein Mensch, gegen andere Menschen gut zu sein. Mitunter tut's sogar, wie hier, ein Topf mit heiße Bohnen.
Pfui Deibel, – aber gut war's doch.
Ja, aber nun hab' ich solang über das menschliche Glück nachgedacht, und dieser Topp mit Bohnen belehrt mir nu, daß ein bißchen Liebe doch eigentlich das Hauptstück bleibt. Und wenn einem so'n Bohnentopp nun noch von eine liebe Hand gereicht wird und nich bloß von so'n Schweinigel, dessen Geschäft das is, ja, ich glaub', das hätt' solche Wirkung, daß man sich beinah einbilden könnt', es wär eigentlich Kartoffelsupp' mit Wurscht, was ich so sehr gern ess'.