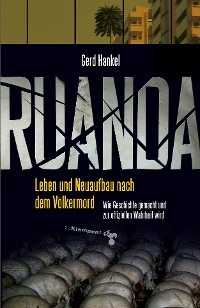Kitabı oku: «Ruanda», sayfa 8
2.2 Völkermord, Massaker und andere Verbrechen – Begriffe und ihre Botschaften zur Benennung von Unrecht
Der Völkermord in Ruanda hat eine Vorgeschichte. Er ist nicht überraschend geschehen und auch nicht ohne Vorbereitung. Der Völkermord stellt die extreme Eskalationsstufe eines Krieges dar, in dem Vernichtungsrhetorik nicht nur auf Propaganda beschränkt war, sondern auch Eingang in normale Nachrichten gefunden hatte. Wo Tötungsbereitschaft nicht schon vorhanden war, wurde sie gezielt gefördert oder erzwungen. Ein Menschenleben galt nichts und im Vernichtungsfuror wurde, so wird berichtet, der kurze, schmerzlose Tod zu einem Privileg.122
Mit diesen Sätzen könnte ein Tutsi Ruandas, fragte man ihn nach der Gewalt und Gewaltentwicklung gegenüber sich und seiner Bevölkerungsgruppe, seine Beobachtungen und Erfahrungen zusammenfassen. Fragte man einen Hutu Ruandas, müsste man damit rechnen, dass er Gewalt und Gewaltentwicklung gegenüber sich und anderen Hutu in ähnlichen Sätzen beschreibt. Der eine hat die Grausamkeiten des Völkermords vor Augen, die Vernichtung von Menschen jedweden Alters und Geschlechts wegen ihrer bloßen Existenz, der andere denkt an die Ermordung ganzer Dorfbevölkerungen während des Krieges. Dass die Zahl der im Völkermord Getöteten ein Mehrfaches der Kriegstoten beträgt, reduziert diese für ihn nicht zu einer beiläufigen Angelegenheit, eine Überlegung, die für den Völkermordüberlebenden eine unzulässige Gleichsetzung, den Versuch der Aufrechnung bis hin zur Annahme eines doppelten Völkermords und schlimmstenfalls die Leugnung des Völkermords bedeutet. Begriffe wie Krieg und Völkermord, aber auch Massaker, Opfer und Überlebender (rescapé) waren in Ruanda Schlüsselbegriffe im kommunikativen Gedächtnis, die, nach beiden Bevölkerungsgruppen getrennt, zu Chiffren für die Suche nach einer integrativen Geschichte, nach Selbstvergewisserung und Identität geworden waren.123
Wer von Krieg (guerre) sprach, meinte damit den Krieg, der am 1. Oktober 1990 angefangen hatte. An diesem Tag hatte der militärische Arm der FPR, die APR, das Land angegriffen. Die FPR war 1987 in Uganda gegründet worden, ihre Mitglieder waren zum größten Teil Tutsi, die dort Zuflucht gefunden hatten aus Angst vor Verfolgung in Ruanda. Ziel der FPR war es, die Rückkehr der Flüchtlinge, die zum Teil schon seit Jahrzehnten unter schwierigen Umständen in Uganda lebten, mit militärischen Mitteln zu erzwingen und auf diesem Weg zugleich das autoritäre, sich auf die Hutu-Mehrheit in Ruanda stützende Regime des ruandischen Präsidenten Juvénal Habyarimana zu beseitigen. Doch schon nach einem Monat war der Angriff der etwa 2500 FPR-Kämpfer zurückgeschlagen. Belgische, zairische und vor allem französische Militärunterstützung hatten, gepaart mit internationalem Druck, den Vormarsch gestoppt und erfolgreich eine Gegenoffensive ermöglicht. Aber die FPR hatte sich als politisch-militärischer Faktor bemerkbar gemacht und sie erwies sich in den folgenden Jahren als strategisch lernfähig und überaus diszipliniert. Kleinere Einfälle und größere Angriffe führten schließlich Anfang 1993 zu beträchtlichen Geländegewinnen entlang der Nordgrenze Ruandas und zur Einrichtung einer »befreiten Zone«.
Die FPR war nach Ruanda zurückgekehrt und für die Staatsführung, die längst zwischen verschiedenen, sich an Radikalität überbietenden Strömungen zerrissen war, zu einem Akteur geworden, mit dem sie sich arrangieren musste. In den Friedensverhandlungen von Arusha wurde die Einsetzung einer »Übergangsregierung auf erweiterter Basis« (Gouvernement de transition à base élargie) und eines »Übergangsparlaments« (Assemblée nationale de transition) beschlossen, in dem auch die FPR vertreten sein sollte. Militär und Polizei, bislang fast ausschließlich Domänen der Hutu, sollten bis in die Offiziersränge hinein und bis zu einer 50-zu-50-Parität für Tutsi zugänglich sein. Umgesetzt werden sollten die Vereinbarungen in konstruktiver Begleitung einer aus zirka 2500 Personen bestehenden UN-Mission, die als Friedensmission deklariert war, deren Soldaten daher Waffen nur zur Selbstverteidigung einsetzen durften. Hinzu kam noch, als vertrauensbildende Maßnahme, ein Bataillon von 600 FPR-Soldaten in der Hauptstadt Kigali, dessen Aufgabe es war, für den Schutz der künftigen FPR-Minister und -Abgeordneten zu sorgen.124
Das war die Situation um die Jahreswende 1993/1994. Darüber im Rückblick aus der Perspektive des Jahres 2002 sprechend, hieß für FPR-nahe ruandische Tutsi, den Krieg als alternativlosen Auftakt zur Befreiung des Landes von einem völkermörderischen Regime wahrzunehmen. Er war, nach jahrzehntelanger Unterdrückung, der erste Schritt zu dessen Überwindung. Dass dazu Gewalt angewandt und Leid zugefügt wurde, ging auf und verschwand in der späteren Gewalterfahrung während des Völkermords, der genau wegen dieser Gewaltintensität als etwas anderes, vom Krieg Losgelöstes verstanden werden musste.
Für Hutu hingegen, vor allem für solche, die im Norden des Landes längs der ruandisch-ugandischen Grenze lebten, war der Krieg ein Symbol für Tod und Vertreibung. Überfälle auf Dörfer und Städte, die Ermordung auch von Frauen und Kindern mit Macheten und Feldhacken, die Eliminierung von Personen, die als »intellektuell« galten (Bürgermeister, Lehrer, Beamte), schufen ein Klima der Angst, ja der Panik.125 Bewohner ganzer Gemeinden mit dem Bürgermeister und den Verwaltungsbeamten an der Spitze flohen, um nach dem Rückzug der FPR in ihre Dörfer zurückzukehren und 1993 aus der dann »befreiten Zone« erneut zu fliehen. Fast eine Million Flüchtlinge, mehr als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung von damals zirka 7,5 Millionen, hatte in mehreren Lagern gut 60 Kilometer nördlich von Kigali Zuflucht gefunden. Wer die Situation dort beschreiben wollte, sollte sich später auf Roméo Dallaire berufen können, der seine Eindrücke vom August 1993, kurz nach seiner Ankunft in Ruanda als Leiter der UN-Friedensmission, folgendermaßen wiedergibt:
»Und dann, inmitten dieser ländlichen Idylle, stießen wir auf eine teuflische Erinnerung an den langen Bürgerkrieg.
Wir rochen das Lager, noch bevor wir es sahen, eine giftige Mischung aus Fäkalien, Urin, Erbrochenem und Tod. Ein Wald aus blauen Plastikbahnen bedeckte eine ganze Hügelseite, wo 60 000 Vertriebene […] auf wenigen Quadratkilometern zusammengepfercht lebten. Als wir hielten und aus unseren Fahrzeugen stiegen, umschwärmten uns dichte Wolken von Fliegen, die an unseren Augen und Mündern kleben blieben und in unsere Ohren und Nasen krochen. Es war kaum möglich, sich bei dem Gestank nicht zu erbrechen, aber der Fliegen wegen konnten wir auch nicht durch den Mund atmen. Eine junge belgische Mitarbeiterin des Roten Kreuzes erblickte uns und unterbrach ihre Arbeit, um uns durchs Lager zu führen. Die Flüchtlinge kauerten um kleine offene Feuer zusammen, eine stille, geisterhafte Menge, die uns träge mit den Augen folgte, während wir behutsam unseren Weg durch den Schmutz des Lagers suchten. […]
Die Szene war erschütternd, es war das erste Mal, dass ich solches Leid sah, ohne dass es durch die künstliche Linse des Fernsehens gefiltert wurde. Am schockierendsten von allem war der Anblick einer alten Frau, die allein dalag und ruhig den Tod erwartete. Sie mochte nicht mehr als ein dutzend Kilo wiegen. Schmerz und Verzweiflung durchfurchten jede Linie ihres Gesichts. Sie lag inmitten der Überreste ihres Schutzzeltes, das bereits seiner Plastikplane und aller persönlichen Dinge beraubt war. In der erbarmungslosen Welt des Camps war sie bereits abgeschrieben, ihre kärglichen Besitztümer hatten die gesünderen Nachbarn unter sich aufgeteilt.«126
Das Gefühl von Angst und Panik, so würde der gedachte Vertreter der Hutu-Bevölkerung fortfahren, dauerte an, als der Krieg am Abend des 6. April 1994 in eine Phase bis dahin nicht gekannter Intensität trat. Das Gefühl erfasste weniger die Täter der Morde an den Tutsi und ihre Unterstützer, die vor den vorrückenden FPR-Kämpfern flohen und dabei noch genügend Zeit fanden, immer neue Massenmorde zu begehen. Vielmehr waren es Hutu, die nicht am Krieg teilgenommen und sogar Tutsi gerettet hatten, die um ihr Leben fürchten mussten und manchmal auch noch um das der von ihnen Geretteten. Nicht selten nämlich hätten die Eroberer des Landes die im Vertrauen auf ihre Unschuld in ihren Dörfern Gebliebenen zu Versammlungen befohlen, um ihnen die Grundzüge der neuen Politik bekannt zu geben. Statt Worte seien jedoch Schüsse gefallen, so lange, bis niemand mehr gelebt habe. Hunderte, je nach Größe des Dorfes auch über tausend Tote habe es so gegeben. Kwitaba inama (dem Ruf einer Versammlung Folge leisten) sei in Wirklichkeit kwitaba imana (dem Ruf Gottes folgen) gewesen, hieß es in bitterem allerschwärzesten Humor noch Jahre später.127
Die Überlebenden beziehungsweise diejenigen, die ihren Erzählungen Glauben schenkten, hatten keinen Zweifel: Das waren Massaker, die nicht ungesühnt bleiben durften. Nur waren jetzt die Täter Tutsi und nicht Hutu, wie bei den Massakern an den tatsächlichen oder vermeintlichen Oppositionellen des Habyarimana-Regimes während des Völkermordes. Wenn also in Ruanda der Begriff »Massaker« fiel, weckte er Assoziationen, die alles andere als deckungsgleich waren. Wohl war in dieser Phase die Opfergruppe identisch, Täter und Tatumstände waren es jedoch nicht. Wo in einem Fall die Täter unter den späteren Siegern des Krieges gesucht werden mussten (das war bekanntlich die Tutsi-dominierte APR), gehörten sie im andern zur Gruppe derer, die die Verbrechen in der Spätphase des Krieges, das heißt im Kontext des Völkermords und sozusagen zu dessen vereinfachter Durchführung begangen hatten (die Morde der Hutu-Extremisten an den sogenannten »gemäßigten Hutu«/(Hutu modérés). Tutsi als Täter, Hutu als Täter, und in beiden Fällen Hutu als Opfer, das dürfe nicht vergessen oder durch die fortwährende, unausgesprochen kollektiv gemeinte Anklage der Hutu wegen der Völkermordverbrechen verdrängt werden.128
In den Augen der meisten ruandischen Tutsi war dies jedoch eine faktisch und moralisch unzulässige Aufrechnung von Unrecht beziehungsweise der zweifelhafte Versuch einer solchen durch die Behauptung von Unrecht. Ihre Geschichte im Ruanda nach der Unabhängigkeit sei eine Geschichte von Verfolgung und Pogromen gewesen, vor dem Krieg genauso wie nach dessen Beginn,129 was ihn deutlich zu einer Art Durchgangsstation auf dem Weg zur Befreiung gemacht habe. Ihre Zuspitzung habe die Gewalt, so würde der gedachte Vertreter der Tutsi-Bevölkerung weiter ausführen, in den unzähligen Mordaktionen erfahren, die sich zuerst gegen einzelne Personen und dann, vom Baby bis zum Greis, gegen ganze Familien gerichtet hätten. Es habe regelrechte Menschenjagden gegeben, Morden sei zu einer Arbeitstätigkeit geworden, unterbrochen von Pausen und Nachtruhe. Langjährige Freunde seien zu Todfeinden geworden, Ehemänner hätten ihre Ehefrauen getötet und Mütter ihre Kinder. Und auch hier könnte die Zeugenschaft Roméo Dallaires bemüht130 oder auf einen der wenigen anderen nichtruandischen und somit der Parteinahme weniger verdächtigen Beobachter des Völkermords verwiesen werden, dessen Bericht von einem kleinen Geschehensausschnitt noch heute das Erschrecken verrät, das ihn damals befiel:
»Gerüchte von grauenvollen Massakern zirkulierten schon seit dem frühen Morgen. Gegen 11 Uhr kam mein Kollege dann völlig aufgelöst und schockiert bei mir zu Hause vorbei und berichtete von vielen hundert Leichen auf den Straßen hin zur Präfektur und nach Nyabidahe sowie von mehreren hundert abgeschlachteten Flüchtlingen in der Sekundarschule von Nyamishaba. Er schätzte spontan, daß etwa die Hälfte der Wohnbevölkerung von Nyabidahe und dem Wohnzentrum von Cyumbati umgebracht worden sei, wenn man den hohen Tutsi-Anteil zugrundelege. Er bat mich zu versuchen, einige noch (über-) lebende Kinder unter den Leichenbergen der Schule herauszuholen. Nach kurzer Rücksprache mit meiner Frau fuhr ich mit Freiwilligen des Roten Kreuzes in der Krankenhausambulanz los: Vor Ort führte uns ein Verwaltungsangestellter der Schule durch ein grauenvolles Szenario: Im Hof und auf den Außengängen vor den Schlafräumen lagen mehrere hundert Leichen, überwiegend von Frauen und Kindern. Wenige Männerleichen lagen auf einer Böschung vor den Schlafgebäuden (Verteidigungs- oder Fluchtversuch?). Fast alle hatten zentimetertiefe Machetenschnittwunden im Nacken oder auf dem aufgeplatzten Schädel, einige auch auf Gliedmaßen und Rumpf. Die meisten waren schon in Totenstarre vom Vorabend, doch einige waren noch halbwarm und beweglich, das heißt, sie waren erst vor Stunden nach langsamem Verbluten qualvoll gestorben. Unter all den Leichen fanden wir nur zwei unverletzte Kleinkinder und fünf schwerverletzte Kinder, deren tiefe Wunden verkrustet offenstanden. Einer konnte sogar trotz der tiefen Nackenwunden noch seinen Kopf hochhalten und gehen. Nach eiliger Besichtigung mehrere Lehrerwohnungen, wo wir ebenfalls zahlreiche Leichen drinnen und draußen vorfanden, flüchtete unsere nun voll beladene Ambulanz wieder zum Krankenhaus zurück. Einige Frauen mit Kindern, die in einem anderen Wohnhaus verschont worden waren, mussten wir zurücklassen, da sie nicht auf dem Weg zum Krankenhaus vorauszugehen wagten. Am Eingang zur Schule saßen drei gelangweilt wirkende Schüler aus Byumba mit Machete, die ›Wache hielten‹.«131
So oder so ähnlich hat es sich zwischen April und Juli 1994 zigtausendfach in Ruanda zugetragen. Und es war vor allem die Zahl der Opfer und die angestrebte Vollständigkeit der Vernichtung, die als Nachweis des erlittenen Unrechts zählten. Dass hier der Völkermord als das größere Verbrechen galt, stand daher allgemein132 und nicht nur für die Überlebenden – und als solche wurden nur die Opfer des Völkermords bezeichnet – außer Zweifel. Massaker, so sie denn überhaupt glaubhaft mitgeteilt werden konnten, waren dem Völkermord zeitlich vorgelagert oder dessen Begleiterscheinung, jedenfalls Verbrechen, die in der Tatschwere hinter denen des Völkermords rangierten. Allerdings betrafen sie die große Mehrheit der Bevölkerung, wurden untereinander kommuniziert und prägten Selbstbild und Erwartung. Demgegenüber standen Selbstbild und Erwartung der Bevölkerungsminderheit, über die Landesgrenzen hinaus unterstützt von der assoziativen Kraft des Genozidbegriffs und gefördert von einer Regierung, deren stärkste Kraft – die FPR – sich die Beendigung des Völkermords auf die Fahnen schrieb.
Natürlich gab es auch eine ganze Reihe von Versuchen, die Distanz oder Kluft zwischen beiden Seiten zu überbrücken: Hutu-Politiker, die in Opposition zum Habyarimana-Regime gestanden hatten und in die Übergangsregierung eingetreten waren, sogar Offiziere der früheren Armee Forces Armées Rwandaises (FAR), die, obwohl notwendigerweise Hutu (kein Tutsi konnte in der Habyarimana-Armee Offizier werden), in der Rwandan Patriotic Army und den neuen Rwanda Defense Forces (RDF)133 Dienst tun wollten und auch übernommen worden waren. Oder aber Tutsi, die nicht der FPR beitraten, sondern zusammen mit Hutu in den alten Oppositionsparteien blieben, oder Überlebende des Völkermords, die sich um den Erhalt des Friedens willen eine nicht militärisch erzwungene Rückkehr der Flüchtlinge gewünscht hatten und von der späteren Politik der Übergangsregierung enttäuscht worden waren.
Von beiden Gruppen, ihrem Selbstverständnis und erhofften Politikalternativen wird noch zu berichten sein. Jetzt, am Ende des Jahres 2002, als erstmals im großen Maßstab mit der Aufarbeitung der von Gewalt geprägten jüngsten Vergangenheit begonnen werden sollte, sind sie ohne Einfluss auf die Botschaften, die von den Worten Krieg, Völkermord, Massaker, Überlebende oder Opfer ausgehen. Zu lange haben alle Betroffenen, das heißt fast jede Ruanderin und jeder Ruander, auf den Moment gewartet, die eigene Wahrheit über das Geschehene erzählen zu können und bestätigt zu bekommen. Eine Stimmung abwartender Spannung liegt über dem Land. Die verbreitete Skepsis, die Aufarbeitung der vergangenen Verbrechen werde in denselben Bahnen verlaufen wie die bis dahin zunehmend praktizierte Erinnerung an diese Verbrechen, nämlich ausschließlich auf den Völkermord an den Tutsi bezogen,134 versuchen Ruander, die um den inneren Frieden im Land und um dessen Erscheinungsbild nach außen besorgt waren, zu zerstreuen. Robert Masozera, bis 2015 für einige Jahre ruandischer Botschafter in Belgien und davor Botschaftsrat in der ruandischen Botschaft in Deutschland, auf einer Diskussionsveranstaltung anlässlich der Vorstellung von Alison Des Forges’ Buch über den Genozid in Ruanda im Dezember 2002 in Bonn: »Das Gesetz macht von seinem Wortlaut her keinen Unterschied zwischen Opfergruppen. Die Rechtsprechung wird sich mit dem Unrecht insgesamt beschäftigen. Es geht um die Wahrheit, ein hohes Gut.«

I.1 Das Zentrum von Kigali im Jahr 2002 (Busbahnhof)

I.2 Die Kirche von Ntarama

I.3 Nach dem Massaker: in der Kirche von Ntarama

I.4 Menschliche Schädel und Knochen in der Kirche von Ntarama

I.5 Das von Granatsplittern durchsiebte Dach der Kirche von Nyamata

I.6 Genozidopfer in Murambi

I.7 Emmanuel Murangiro in Murambi

I.8 Das »Tor der Erinnerung«

I.9 Plakat zur Sensibilisierung für die Gacaca-Justiz

I.10 Kurz vor einer Présentation von Völkermordhäftlingen
Teil II
Eine neue Verfassung,
erstmalige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und die Herausbildung eines Narrativs
(in den Jahren 2003 und 2004)
Bevor die Gacaca-Justiz aus ihrer Pilotphase tritt, werden die Grundlagen für den konstitutionellen Neuaufbau Ruandas geschaffen: eine neue Verfassung, Wahlen des Staatspräsidenten und zur Nationalversammlung. Paul Kagame, Ruandas starker Mann, wird mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt, seine Partei, die FPR, erhält mit Abstand die meisten Stimmen. Massive Wahlfälschungen lassen den Verdacht aufkommen, die Vorherrschaft einer Partei soll etabliert werden. Das spiegelt zwar das Bedürfnis weiter Bevölkerungsteile nach Stabilität und Sicherheit, erweist sich aber als Beginn einer Repression, die mit großer Härte alles unterdrückt, was der offiziellen Anschauung zuwiderläuft. So nimmt die janusköpfige ruandische Entwicklung ihren Anfang: auf der einen Seite ein forcierter wirtschaftlicher Aufschwung mit Modernisierung des Staates, auf der anderen eine Staatsführung, die mit allen Mitteln an der Macht bleiben will und deren repressiven Charakter zu verbergen sucht.
1. Ein Staat konstituiert sich unter schwierigen Bedingungen, aber nach vorgefasstem Plan
Wie schreibt man eine neue Verfassung? Wie stattet man einen Staat mit Organen aus, die das, was die Verfassungsgeber beabsichtigen, in konkrete Politik überführen? Fragen wie diese sind es, die in der ersten Hälfte des Jahres 2003 in Ruanda das politische Geschehen dominieren. Schon Ende 2000 war, wie im Friedensvertrag von Arusha vorgesehen, eine Verfassungskommission (Commission Juridique et Constitutionnelle) unter Vorsitz von Tito Rutaremara, einem führenden FPR-Politiker, eingesetzt worden. Sie hatte die Aufgabe, aus dem bestehenden Konglomerat an gesetzlichen Bestimmungen, die bis dahin der staatlichen Existenz und seiner Handlungsweise zugrunde lagen,1 diejenigen herauszufiltern, die auch Teil einer neuen, homogenen Verfassung sein sollten. Außerdem und vor allem aber sollte die Kommission Vorschläge für Verfassungsbestimmungen ausarbeiten, die die Lehre aus den Erfahrungen der jüngsten Zeit spiegeln und ein erneutes Versinken Ruandas in völkermörderische Gewalt unmöglich machen. Der Verfassungsentwurf sollte, so war weiterhin geplant, per Referendum zur Abstimmung gestellt werden und den Weg zu Präsidentschafts- und Parlamentswahlen öffnen. Diese Wahlen sollten letztlich das Ende der Übergangszeit und zugleich den Beginn einer neuen Staatlichkeit markieren.2
Als die Verfassungskommission ihre Arbeit aufnahm, begann ein Prozess, der sehr an das Verfahren zur Reaktivierung der Gacaca-Justiz erinnerte. Von oben nach unten, von der Spitze der Ministerien bis hinunter zur Verwaltungsebene des Sektors (es gab 1545 Sektoren), fanden Informationsveranstaltungen statt, wurde um Anregungen gebeten und zur Förderung des Dialogs die Botschaft übermittelt, dass die neue Verfassung eine Verfassung »des Volkes für das Volk« sein werde. Anders als früher, als den Ruandern die jeweiligen Verfassungen übergestülpt worden seien,3 solle die Bevölkerung sich jetzt mit ihr identifizieren können. Auf international besetzten Konferenzen wurden verschiedene Entwürfe diskutiert (wobei der Diskussionsverlauf sehr stark von ruandischen Erwartungen dominiert wurde) und nach einem kurzen Zwischenstopp im Übergangsparlament, das nur marginale Änderungen vornahm, wurde der Verfassungsentwurf dann zur Abstimmung gestellt. An dieser nahmen am 26. Mai 2003 rund 87 Prozent der 3,7 Millionen Wahlberechtigten teil, von denen sich 93 Prozent für die Annahme des Verfassungsentwurfs aussprachen.4 Neun Jahre nach dem Völkermord und Zusammenbruch des ruandischen Staates war dies ein eindrucksvolles Votum – das im Übrigen nach Einschätzung ausländischer Wahlbeobachter ohne Unregelmäßigkeiten zustande gekommen war – für die Abkehr vom alten Regime und den Aufbau eines neuen Ruanda. »Nichts wird die Renaissance der ruandischen Nation aufhalten können«, lautete folglich das Fazit des Leitartikels in der größten Zeitschrift des Landes.5
Am 4. Juni 2003 tritt die neue Verfassung in Kraft. Eingeleitet wird sie durch eine Präambel, die in zwölf Absätzen die Leitgedanken der folgenden 203 Artikel auflistet. An der Spitze steht die Erinnerung an den Völkermord und das durch ihn hervorgerufene Leid, gefolgt von der Beschwörung der Entschlossenheit, jede Form der genozidalen Ideologie und Volksverhetzung zu bekämpfen, und von dem dringlichen Hinweis auf die Notwendigkeit, die nationale Einheit und Versöhnung zu fördern und zu festigen. Dann wird noch das Ziel genannt, einen Rechtsstaat zu errichten, in dem die Grundrechte und Grundfreiheiten auf der Basis einer pluralistischen Demokratie und von Gewaltenteilung garantiert sind, und der der Erkenntnis verpflichtet ist, dass alle Ruander, vereint in demselben Land, in derselben Sprache, derselben Kultur und einer langen gemeinsamen Geschichte, ihre Zukunft konstruktiv gestalten sollen. Maßstab dabei soll auch die strikte Beachtung von Vereinbarungen zum Schutz der Menschenrechte sein, wie sie in verbindlichen völkerrechtlichen Verträgen – sie werden im Einzelnen aufgezählt – niedergelegt sind.
Die eigentlichen Verfassungsbestimmungen beginnen in den Artikeln 1 bis 9 mit der Aufzählung der Attribute, die den Staat und die nationale Souveränität ausmachen sollen. So heißt es gleich in Artikel 1, dass Ruanda eine »unabhängige, souveräne, demokratische, soziale und säkulare Republik« ist. Die Landessprache ist Kinyarwanda, die offiziellen Sprachen sind zusätzlich noch Französisch und Englisch (Artikel 5), und das Motto der ruandischen Republik lautet »Einheit, Arbeit, Patriotismus« (Artikel 6). Unter den Prinzipien des Staates (Artikel 9) hat der Kampf gegen »die Ideologie des Genozids und alle ihre Erscheinungsformen« oberste Priorität. Demzufolge stehen auch die Grundrechte und Grundpflichten der Menschen und Bürger (Artikel 10–51) unter dem Vorbehalt, dass durch sie keiner Leugnung oder Verharmlosung des Völkermords Vorschub geleistet werden darf. Unter dem gleichen Vorbehalt stehen auch die politischen Parteien (Artikel 52–59). Zu diesem Zweck ist unter anderem die Einrichtung eines »Forums der politischen Parteien« vorgesehen, das, bei Wahrung der jeweiligen Parteiunabhängigkeit, als Instanz für die Diskussion wichtiger nationaler Fragen und als Förderer der nationalen Einheit dienen soll. Das allerdings tut dem Umstand keinen Abbruch, dass der Staatspräsident die dominante Funktion in der staatlichen Organisation Ruandas innehat (Artikel 98–115). Er ist in allgemeiner Wahl für eine Amtszeit von höchstens zweimal sieben Jahren wählbar und damit tendenziell mit einer langen Amtszeit ausgestattet. Er ist der Oberbefehlshaber der ruandischen Streitkräfte, in vielfältiger Weise an der Besetzung wichtiger Positionen im Staat beteiligt und vertritt das Land nach außen. Hinsichtlich der Regierung (Artikel 116–125), des neben ihm zweiten Organs der Exekutive, bezieht er seine starke Stellung dadurch, dass er den Ministerpräsidenten bestimmt oder abberuft und auf dessen Vorschlag die Mitglieder des Kabinetts ernennt. An den Kabinettssitzungen kann er teilnehmen und führt dann den Vorsitz. Der Staatspräsident kann auch, nach einer vorgeschriebenen Reihe von Konsultationen, das Parlament auflösen (die Mandatszeit der Abgeordneten beträgt fünf Jahre; der Senat, das zweite Legislativorgan, wird für acht Jahre gewählt beziehungsweise bestimmt und kann nicht aufgelöst werden). Sein Veto gegen ein vom Parlament beschlossenes Gesetz kann, je nach Gesetzesart, nur durch eine Zwei-Drittel- bis Drei-Viertel-Mehrheit der Abgeordneten überstimmt werden.
Das größere Gegengewicht zur Macht des Präsidenten ist nach dem Verfassungswortlaut die Judikative (Artikel 140–159). Sie bindet alle Gewalten, ist unabhängig sowie finanziell und administrativ autonom. Außerdem ist sie zweigeteilt, in die Bereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Sondergerichtsbarkeit. Zu Letzterer gehört auch die Gacaca-Justiz. Mit der Zuweisung eines Verfassungsrangs an die traditionelle Justizform beginnt sich gewissermaßen die Klammer, die sich mit der Präambel öffnet, zu schließen. Als Instrument der versöhnenden, einheitsfördernden Justiz wird sie am Schluss der Verfassung (Artikel 176–186) um Institutionen ergänzt, die dazu beitragen sollen, die Leitgedanken der Präambel Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Institutionen sind: die Nationale Kommission für Menschenrechte (Commission nationale des droits de la personne), die Nationale Kommission für Einheit und Versöhnung (Commission nationale de l’unité et la réconciliation), die Nationale Kommission für den Kampf gegen den Genozid (Commission nationale de lutte contre le génocide) und das Büro des Ombudsmans (Office de l’ombudsman).
Wie passt es zu dieser Aufzählung und zur Verfassung insgesamt, dass Menschen plötzlich verschwinden? Wie passen dazu willkürliche Verhaftungen oder die Unterdrückung von Meinungsäußerungen? Natürlich gar nicht, so die Antwort, die dem wohl generellen, noch vom Eindruck der eben gelesenen Verfassungsinhalte und -gebote vorgegebenen Impuls folgt. Und doch passierte genau das im Frühjahr 2003, als sich Ruanda anschickte, das Fundament eines neuen Staates zu legen. Menschen verschwanden oder wurden unter dubiosen Umständen inhaftiert, Kritik an der Übergangspolitik in die Ecke staats- und versöhnungsgefährdender Hetze gedrängt. Wie so oft, wenn unter der Oberfläche des Lebensalltags Missstände existieren, die dem noch unerfahrenen Blick unsichtbar bleiben oder sich ihm nicht in ihrer zusammenhängenden Bedeutung erschließen, war es ein einzelnes Ereignis, das den Blick schärfte und Zusammenhänge offen legte. Am 23. April 2003, einen Monat vor dem Verfassungsreferendum, war gemeldet worden, dass ein Mann namens Augustin Cyiza nach einer Vorlesung, die er an einer Universität in Kigali gehalten habe, nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Cyiza, ein 48-jähriger Jurist, der in der Habyiarimana-Armee FAR bis in die Position eines Majors aufgerückt war und Ruanda bei den Friedensverhandlungen in Arusha vertreten hatte. Nach dem Völkermord war er, da er zu den sogenannten gemäßigten Hutu gehört und vielen Tutsi das Leben gerettet hatte, in die neue ruandische Armee übernommen worden. Er wurde zum Oberstleutnant befördert und zum Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs ernannt.6 Sein Ruf war der eines unbestechlichen Richters, der nur dem Gesetz und seinem Gewissen unterworfen Recht spricht. Das machte ihn auch in der Zeit des politischen Übergangs zu einer moralischen Instanz, zu einem gesuchten Gesprächspartner von Menschenrechtsorganisationen. Als Botschafter der Belange der Hutu, die in Opposition zum Habyarimana-Regime gestanden hatten, genoss er auch bei den neuen Machthabern hohes Ansehen, allen voran beim Übergangspräsidenten Kagame.7
Was sein Schicksal war, blieb unbekannt, wie auch das Schicksal eines Studenten, eines Tutsi aus dem Kongo, der mit ihm im Auto unterwegs war. Offiziellen Ermittlungsergebnissen, wonach Augustin Cyiza das Land verlassen haben soll, wurde allgemein kein Glauben geschenkt. Zu konstruiert erschienen die Parallelen zur polizeilichen Darstellung des Verschwindens anderer Personen (Offiziere, Politiker und Geschäftsleute), denen Sympathien mit den vom benachbarten Ausland aus operierenden Feinden Ruandas unterstellt wurden.8 Augustin Cyiza war beseitigt worden, so im Mai 2003 nahezu jede Meinung außer der offiziell vertretenen, weil er dem Wiederaufbau Ruandas, wie er von den Protagonisten der Übergangsperiode geplant worden war, im Wege gestanden haben soll. Hatte nicht Kagame noch in einer öffentlichen Rede wenige Monate vorher »mit Bedauern festgestellt, dass einigen danach verlangt, verletzt zu werden, bevor die Unumkehrbarkeit der 1994 eingeleiteten Veränderungen verstanden wird«?9 War nicht mit drakonischer Härte gegen jedes Anzeichen einer Opposition gegen das FPR-Projekt eines neuen Ruanda vorgegangen worden, angefangen von der Entlassung, Vertreibung und Inhaftierung missliebiger Minister, Premierminister und sogar eines Staatspräsidenten (Pasteur Bizimungu, vom 19. Juli 1994 bis 23. März 2000 Staatspräsident, dann zum Rücktritt gezwungen und im April 2002 verhaftet) bis hin zur ihrer mutmaßlichen Ermordung (so die von Seth Sendashonga, der 1994/95 Innenminister war, nach Kenia ins Exil gehen musste und dort im Mai 1998 erschossen wurde)?10 Und sollte nicht nach der Empfehlung einer parlamentarischen Untersuchungskommission vom April 2003 die Partei Mouvement Démocratique Républicain (MDR), seit 1994 mit der FPR und anderen Parteien kontinuierlich in der Übergangsregierung und im Übergangsparlament vertreten und ein Schwergewicht in der Parteienlandschaft, wegen ihrer plötzlich festgestellten angeblich spalterischen, auf Ethnie und Region setzenden Politik kurz vor den geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen verboten werden?11