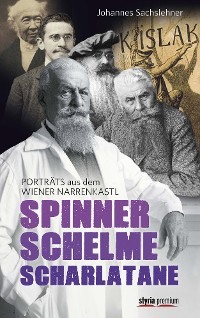Kitabı oku: «Spinner. Schelme. Scharlatane», sayfa 2
DAS RÄTSEL DES „SCHMELZTIEGLERS”
Im Badehaus an der Liesing lagen inzwischen noch immer einige seiner Materialien und persönlichen Besitztümer, die niemanden zu interessieren schienen. Erst einige Jahre nach dem Verschwinden Sehfelds kam ein Mann nach Rodaun, der alles ganz genau wissen wollte: Der preußische Berghauptmann und Nationalökonom Johann Heinrich Gottlob von Justi (1720 - 1771), Professor der Kameralwissenschaften an der Theresianischen Ritterakademie, ein durchaus nüchtern denkender Aufklärer, führte mit der Witwe des inzwischen verstorbenen Bademeisters Friedrich lange Gespräche über die Ereignisse von 1745 und sammelte auch in Wien alles, was über Sehfeld noch zu erfahren war. Seine Erkenntnisse veröffentlichte er in der kleinen Schrift Geschichte des Sehfelds, eines vermutlich noch lebenden Adepti, in der er die Meinung vertrat, dass es durchaus „starke und ungezweifelte Beweise“ dafür gebe, dass der Fremde von Rodaun die Kunst des Goldmachens tatsächlich beherrscht habe. Justi werden von der Familie Friedrich noch Reste einer Tinktur gezeigt, die Sehfeld verwendet haben soll und die aus einem himmelblauen Material – Justi vermutet Azurit – hergestellt worden war. Sein Resümee: „Ich leugne gar nicht, daß nicht unzählige Betrügereyen in dem Punct des Goldmachens gespielet worden sind. Allein, wenn je in einer Sache starke und ungezweifelte Beweise vorhanden sind, so ist es hierinnen: und man müsste allen historischen Glauben verwerfen, wenn man leugnen wollte, daß es von Zeit zu Zeit einige Leute gegeben hat, welche das Geheimniß, Gold zu machen, besessen haben.“

Unter den hundert „ausbündigen Narren“ fand der närrische Abraham a Sancta Clara auch einen „Bergwercks-Narren“.
Die Erinnerung an Sehfelds Wirken in Rodaun blieb jedenfalls wach, einige Zeit hindurch genoss das Badehaus den Rang einer Sehenswürdigkeit, wie der streitbare schwäbische Publizist und Aufklärer Wilhelm Ludwig Wekhrlin bezeugt. Über einen Ausflug nach Rodaun, der um etwa 1770 stattgefunden haben dürfte, berichtet er in seinen Denkwürdigkeiten aus Wien: „Heute war unsere Caravane zu Rodaun, einem eine Meile von der Stadt entlegenen Dorfe, um die Trümmern von den Öfen des Seefels (sic!), eines berufenen Schmelztieglers, zu sehen. Die Wiener erzählen Wunderdinge von diesem Mann. Man muß gestehen, wenn sie keine Goldmacher sind, so besitzen sie doch die Religion derselben. Ein Mann, der die Protokollen der Stadt genau kennet, versichert mich, daß man im Jahre 1752 dreyzehntausend und acht und vierzig Laboranten, Geisterbeschwerer, Freymaurer und Schatzgräber gezählt habe.“ Weckhrlin erwähnt auch ein Gerücht, das in Wien offenbar die Runde machte: Die treibende Kraft hinter dem harten Vorgehen gegen Sehfeld sei Maria Theresias Leibarzt Gerard van Swieten (1700–1772) gewesen – er habe es nicht verkraftet, dass er mit seinen eigenen chemischen Versuchen erfolglos geblieben sei. Er habe daraufhin alle Bücher zu alchimistischen Themen aus der Hofbibliothek entfernen und vergraben lassen.

Eine Wandplastik in der Ketzergasse 372 erinnert an den geheimnisvollen Goldmacher von anno 1745.
Ein Jahrhundert später gab es das Rodauner Bad noch immer, doch die Erinnerung an den Wundermann Sehfeld war längst verblasst, nun pilgerte man hinaus an die Liesing, um sich kulinarischen Freuden hinzugeben: Unter dem aus Breitenfurt stammenden Wirt Johann Stelzer (1852 - 1924) war die alte Gaststätte des Badehauses zum legendären „Wirtshaus von Österreich“ ausgebaut worden; beim „Stelzer“ traf sich an schönen Sommertagen die Prominenz der Monarchie: Adelige und hohe Beamte, Schauspieler, Künstler und Diplomaten.
Nach dem Ersten Weltkrieg verkaufte Johann Stelzer seinen Betrieb, neuer Besitzer wurde Paul Deierl, der den Gasthof bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs weiterführte; 1960/61 wurde das desolate Gebäude abgerissen. Eine Wandplastik und eine Gedenktafel in der Ketzergasse 372 erinnern heute an den „Goldmacher von Rodaun“, dem Ludwig Bechstein mit dem Roman Geheimnis eines Wundermannes (1856) und Gustav Meyrink mit der Erzählung Der seltsame Gast (1925) literarische Denkmäler gesetzt haben.
Bleibt letztlich die Frage, was damals, anno 1745, wirklich passiert ist – war Sehfeld ein Betrüger und mit welchen Tricks konnte er die Familie Friedrich von seiner geheimnisvollen „Kunst“ überzeugen? Welche Intrigen wurden von den Neidern wie van Swieten gegen ihn gesponnen? Wer war dieser Mann wirklich?

1734–1800
DER HAND-
AUFLEGER
FRANZ JOSEPH
GRAF
VON THUN
Das reinste Fluidum, welches die Seele genannt wird, wird als ein magnetischer Strohm betrachtet, und dieser magnetische Strohm ist das belebende Fluidum woraus ein Chaos der Dinge entspringt, und das Organn der Gottheit zur Erhaltung des ganzen All bildet.
Franz Joseph Graf Thun, Encyclopedie
Mit dem Grafen Franz Joseph von Thun, tritt uns eine faszinierende Figur entgegen, ein Aristokrat, der sich im Spannungsfeld von Aberglauben, Aufklärung und Wissenschaft bewegt, ein Mann, der an Geister glaubt und sich gleichzeitig für die „halbgöttliche“ Luftschifffahrt begeistert, der nach der letzten Wahrheit sucht und den Menschen Gutes tun will, ein leichtgläubiger Schwärmer, der sich magischen Ritualen unterwirft, und ein gewandter Weltmann, der auf die Freiheit der Vernunft und den Fortschritt der Technik setzt – so begeistert er sich etwa auch für den berühmten „Schachtürken“ des Hofrats Wolfgang von Kempelen, von dem er glaubt, dass es sich tatsächlich um einen Automaten handelt (siehe dazu auch das Kapitel „Der große Illusionist“).
Franz Joseph von Thun wird am 14. September 1734 als ältester Sohn des reichen Landbesitzers Johann Joseph von Thun geboren, die Güter des Vaters liegen in Nord- und Mittelböhmen. Seine Mutter Marie Christine ist eine geborene Fürstin von Hohenzollern-Hechingen. Gemeinsam mit seinem Bruder Wenzel Josef beginnt er in Prag ein Studium der Rechte, das die beiden Brüder 1755 abschließen können. Wie in jenen Tagen für junge Adelige üblich, begeben sich die beiden Thuns anschließend auf Kavalierstour durch Europa. Auf dieser Reise, so soll Franz Joseph einem Freund erzählt haben, sei er auf einen „seltsamen Mann“ gestoßen, der ihn in die Geheimwissenschaften eingeweiht habe. Thun und sein Sekretär hätten von dem geheimnisvollen Fremden so etwas wie eine „Taufe“ und „geistige Instruktionen“ empfangen – Franz Joseph sieht sich von nun als „Wissender“. 1761 heiratet der junge Adelige Maria Wilhelmine Gräfin von Uhlfeld, die Tochter des Obersten Hofmeisters Anton Corfiz Uhlfeld, und tritt am Wiener Hof seinen Dienst als Kämmerer an, eine Stelle, die er wahrscheinlich bis 1785 ausgeübt hat. Das Ehepaar Thun hat sechs Kinder, von denen vier das Erwachsenenalter erreichen: der Sohn Josef Johann und die Töchter Marie Elisabeth, Wilhelmine Christine und Marie Karoline. Als erstgeborener Sohn erhält Franz Joseph von Thun 1785 ein Drittel des Familienvermögens, das Fideikommiss Klösterle (Klasterec nad Ohrí).
DER SALON THUN
Im Salon von Maria Wilhelmine Gräfin Thun nahe der Minoritenkirche treffen sich in den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts Künstler und Wissenschaftler, hohe Beamte und Aristokraten. Unter den Gästen sind Ignaz Born, Aloys Blumauer und Mozart, ja selbst Kaiser Joseph II. pflegt „fast wöchentlich einmal im Circle abends bei ihr einzusprechen“, wie der junge deutsche Weltumsegler und Freimaurer Georg Forster in seinen Briefen aus Wien berichtet. Forster, Mitglied der Wiener Loge „Zur wahren Eintracht“, lernt in der Gräfin die „vortrefflichste, aufgeklärteste Dame in Wien“ kennen, er schätzt ihre Liebe zu den Wissenschaften und ihre „ausgebreitete Lektüre“, die es ermögliche, sich mit ihr in „feinster Unterredung“ zu ergehen. Sie hört ihm geduldig zu, wenn er ihr einen Abend lang englische Gedichte vorliest, er kann mit ihr aber ebenso über Fragen der Erziehung oder des Glaubens sprechen.

Georg Forster schätzt die „feinsten Unterredungen“ mit Gräfin Thun. Porträt von J. H. W. Tischbein.
Vom Gatten der so glänzend geschilderten Dame schweigt Forster jedoch. Dabei ist Franz Joseph Graf Thun so wie er Mitglied der Loge „Zur wahren Eintracht“, allerdings unterhält der Graf auch Kontakte zu den Rosenkreuzern und zu magisch-mystischen Schwärmern, vor allem aber ist er ein überzeugter Anhänger des Mesmerismus und er glaubt offenbar an Geister – Dinge, die dem nüchternen Aufklärer Forster wohl doch zu weit gehen.
Selbst Mozart, der vom gräflichen Paar tatkräftig unterstützt wird, kann mit den seltsamen Vorlieben seines Gönners für Mystik und Magnetismus wenig anfangen. Er lernt das Ehepaar Thun bereits in der ersten Woche seines Wiener Aufenthalts kennen – Mozart trifft mutterseelenallein in einer Postchaise am 16. März 1781 in der Habsburgerresidenz ein – und ist von der Persönlichkeit der Gräfin sofort tief beeindruckt. Das „ist die scharmanteste, liebste Damme (sic!), die ich in meinem leben gesehen; und ich gelte auch sehr viel bey ihr“, schreibt er an seinen Vater Leopold. Der junge Künstler schätzt das offene Haus, das die Gräfin führt, fast täglich ist er nun bei ihr zu Gast. Was den Grafen betrifft, so bleiben Mozart dessen eigenwillige Züge nicht verborgen – in einem Brief an seinen Vater vom 24. März 1781 urteilt Mozart über den Mann seiner Wohltäterin: „Ihr Herr ist noch der nembliche sonderbare – aber gutdenkende Cavalier.“ Im Laufe seiner Wiener Jahre hat Mozart Gelegenheit, den Grafen und seine esoterischen Neigungen näher kennen zu lernen, so begleitet er Thun im Juni 1784 auf einer Reise nach Baden, gut möglich auch, dass es, wie Ivo Cerman vermutet, der Graf ist, der den genialen Musiker im Dezember 1784 zum Eintritt in die Loge „Zur wahren Eintracht“ bewegt.
Die beiden Töchter Marie Elisabeth und Wilhelmine Christine zählen zu den besten Partien Wiens – die beiden Mädchen sind im Kloster erzogen worden und werden im November 1784 verheiratet: Marie Elisabeth wird die Frau des Fürsten Rasumowsky, des späteren russischen Botschafters; Wilhelmine Christine heiratet den Fürsten Lichnowsky. Die beiden jungen Frauen gehen völlig ahnungslos in die Ehe; die Brautnacht wird für Marie Elisabeth, die als Erste Hochzeit hält, zum verstörenden Erlebnis, sie beklagt sich über die „Misshandlung“ und „Abscheulichkeit“, die ihr zuteil geworden sei – daraufhin löst Schwester Wilhelmine Christine die Verlobung mit dem Fürsten Lichnowsky, nur mit Mühe kann sie von der Familie doch noch zur Hochzeit überredet werden.
DIE HOMUNCULI DES GRAFEN VON KUEFFSTEIN
Gegen Ende der 1770er-Jahre taucht in den Freimaurerkreisen Wiens ein Mann auf, der Fantastisches mit sich im Gepäck führt: Johann Ferdinand Graf von Kueffstein (1727–1789) ist Herr über acht Homunculi, die er, betreut von seinem Diener Josef Kammerer, in verschlossenen Gläsern mit sich führt. Die acht, etwa „zwei Spannen langen“, angeblich im Misthaufen eines Klostergartens in Kalabrien mit Unterstützung eines Abbé Geloni „gezeugten“ Geister – sie verkörpern die Charaktere König, Königin, Seraph, Ritter, Architekt, Mönch, Nonne und Bergknappe – besitzen die Gabe der Wahrsagung. Neben den sichtbaren Homunculi führt der Graf noch zwei unsichtbare Geister mit sich, den „blauen“ Geist und den „roten“ Geist. Auch diese beiden Geister leben in wassergefüllten Gläsern, zeigen sich allerdings nur, wenn der Graf dreimal mit einem kleinen silbernen Hammer auf das Glas klopft und dazu ein jüdisches Gebet spricht – dann beginnt sich das Wasser himmelblau bzw. feurig rot einzufärben und es erscheinen die Gesichter der beiden Geister. Der blaue Geist zeigt sich „lieblich und fromm“, das Gesicht des roten Geistes ist aber „fräch und garstig, wie ein boshafter Teufel, streckte auch manchmal die Zunge langmächtig heraus und verdrehte die Augen wie ein Hinfallender, das einem völlig todtenangst dabei wurde“. Joseph Kammerer sorgt dafür, dass die zehnköpfige Geisterschar gut versorgt ist: Alle acht Tage muss das Wasser in den Gläsern gewechselt werden, alle drei bis vier Tage bekommen sie zu essen: „ein etwa erbsengroßes Stück von einer rosenfarbigen Salbe oder Latwerge, die der Graf mit einem ‚noch ungebrauchten‘ Ohrlöffelchen einer silbernen Dose“ entnimmt. (Zitiert nach Rainer Schmitz, Schwärmer – Schwindler – Scharlatane.)

Das „Arcanum“ der Alchimie: die Erzeugung des Homunculus, eines künstlichen Menschen. Illustration zu Goethes „Faust II“, 19. Jh.
Von Zeit zu Zeit präsentiert der Graf seine Geistertruppe ausgewählten Logenbrüdern. Ort dieser magischen Sitzungen, die um 11 Uhr abends beginnen und um 1 Uhr früh enden, ist das „fürstlich Auerspergische Haus“ in der Schenkenstraße, die acht Homunculi imponieren den staunenden Brüdern „mit Enthüllungen der wunderbarsten Art“ (Rainer Schmitz) und mit Prophezeiungen, die „fast immer“ eintreffen. Joseph Kammerer, dessen Aufzeichnungen in seinem „Verrechnungsbuch“ wir die Kenntnis von diesem seltsamen Treiben verdanken, berichtet aber auch, dass die Geister, vor denen kein Geheimnis im Himmel und auf Erden sicher sei, manchmal schlechter Laune sind – dann seien sie „bockbeinig und gar nicht zum tractiren“ und ihre Orakelsprüche reiner Unsinn. Jeder Homunculus hat sein Fachgebiet: Der König und die Königin wissen über die politische Entwicklung in der Zukunft Bescheid, Mönch und Nonne zeigen sich als Wissende auf religiösem Gebiet, der Architekt gibt Auskunft zu freimaurerischen Fragen, der Ritter ist Experte in militärischen Dingen, der Seraph überblickt das Geschehen in den Lüften, der Bergknappe jenes unter der Erde. Über diesen acht stehen der blaue und der rote Geist, die alles wissen, was „Gott im Himmel und Satan in der Hölle eben getan“.
Graf Thun, der „an allen geistigen Epidemien seiner Zeit sehr stark laborirende adelige Herr“ (Gustav Brabbée), ist von der Geisterschar fasziniert und gewinnt bei Kueffstein eine Vertrauensstellung. Als der Graf während eines Beschwörungsrituals das Gefäß mit dem Mönchsgeist unabsichtlich vom Tisch wischt, das Glas zerbricht und der Homunculus an den Folgen des Sturzes stirbt, nachdem er „verschiedene Male schwer und mühsam nach Luft geschnappt und die Äuglein erschröcklich verdreht“ hatte, wird Thun zu Hilfe gerufen – ein neuer Geist, so der Wunsch Kueffsteins, soll gezeugt werden, am besten wieder ein Mönch. Thun sagt begeistert seine Unterstützung zu: Irgendwo in der Wiener Vorstadt wird – wohl mit seinem Geld – ein Laboratorium eingerichtet, mehr als einen Monat lang versuchen sich die beiden Grafen an der Schöpfung eines Ersatzgeistes, das Ergebnis ist jedoch ernüchternd. Aus der Phiole, in der der Homunculus heranwachsen soll, können sie schließlich nur „ein gar winzig Ding“ herausziehen, nicht größer als „ein junger Blutegel“, das nach „kurzem Zappeln jämmerlich verreckt“. Die beiden adeligen Herren sind schwer enttäuscht, der tote Homunculus wird verbrannt, seine Asche in alle Winde zerstreut. Josef Kammerer, der brave Diener, denkt sich seinen Teil: Die Herren, so notiert er, müssen bei ihrem Schöpfungsexperiment „etwas Wichtiges“ vergessen haben.

Aus menschlichen Spermien, die man in Pferdemist verfaulen ließ, glaubte man Homunculi züchten zu können. Buchillustration, 1721.
Um 1780 scheint sich der Graf von Kueffstein von seinen Homunculi getrennt zu haben, angeblich auf Zureden seiner Gemahlin und seines Beichtvaters, die ihn beschworen, sein Seelenheil nicht weiter durch diesen „gotteslästerlichen Unfug“ zu gefährden.
Gustav Brabbée, geboren 1822 in Wien, selbst Freimaurer und von Beruf Beamter in einer Wiener Sparkasse, der die Aufzeichnungen Kammerers 1873 auszugsweise im freimaurerischen Taschenbuch Die Sphinx veröffentlichte, behauptete, dass sich diese im Besitz eines „ehrwürdigen, nunmehr 84-jährigen Freundes“ befunden hätten, der wiederum hätte sie im Nachlass seines Vaters gefunden, der einst Besitzer der Nürnberger Warenhandlung „Beim Todtenkopf“ in der Bognergasse war. Brabbée, dessen Todesdatum unbekannt ist, wollte jedenfalls an der Echtheit des „Verrechnungsbuches“, bestehend aus siebzig lose gehefteten Blättern, nicht zweifeln. Stellt sich die Frage: Was ist mit dem Original passiert? Oder saß Brabbée doch einer Mystifikation auf?
DIE GABLIDONE-AFFÄRE
Der gemeinsam mit dem Grafen Kueffstein veranstaltete alchimistische Zeugungsversuch bleibt nicht der einzige Kontakt Thuns mit der Welt der Geister. Als Mitglied der Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“ – im Brüderverzeichnis des Jahres 5785 wird er als Inhaber des dritten Grades geführt – sollte er dem nüchternen Geist der Wissenschaft verpflichtet sein, doch der leichtgläubige k. k. Kammerherr kann sich der Faszination „magischer, theosophischer, alchymistischer und sonstiger krankhafter Aftergebilde“ (Gustav Brabbée) nicht entziehen. So lernt er um 1766 einen zwielichtigen Taschenspieler und Zauberkünstler kennen, der sich als „Rechner Magnanephton“ ausgibt und behauptet, mit einem spiritus familiaris, einem Geist namens „Gablidone“, in Verbindung zu stehen. Thun ist Feuer und Flamme, eine „Gablidone-Brüderschaft“ wird gebildet, der u. a. auch ein gewisser Reiter und andere Freunde des „Rechners“ angehören. Die besondere Leistung des „Rechners“ liegt darin, die angeblich von Gablidone diktierten Botschaften in Zahlenreihen zu übersetzen und diese dem Publikum mitzuteilen. Jedem Buchstaben ist ein Zahlenwert zugeordnet, die Dechiffrierung daher einfach.

Lavater stellt in seinem „Protokoll“ dem Geisterseher Thun ein ausgewogenes Zeugnis aus.
Thun nimmt das „schnöde Gaukelspiel“ (Gustav Brabbée) jedenfalls für bare Münze, über zwölf Jahre lang lässt er sich von Gablidone „Lektionen“ geben, der Geist weiß „auf eine unzählige Menge von Fragen über geschehene und existirende Dinge“ die „richtigsten uund treffendsten Antworten zu geben“. Von Gablidone selbst erfährt Thun, dass er der Geist eines jüdischen Magiers aus der Zeit vor Christi Geburt sei, der seinen eigenen Vater getötet habe und nun dazu verurteilt sei, „8 Rechnern oder ähnlichen Magiern viele Jahrhunderte lang, jedem in besonderen Stunden, zu Gebote zu stehen“. „Rechner Magnanephton“, von dem erwartet wird, dass der Geist auf alle Fragen eine Antwort weiß, zeigt sich allen heiklen Situationen gewachsen, so weiß er sich auch Rat, als Thun und Reiter verlangen, dass Gablidone sein Porträt auf Papier zeichnen solle, sie würden gerne sein Gesicht sehen. Der „Rechner“ willigt ein und inszeniert eine Sitzung, bei der für den spiritus familiaris eine Staffelei und Malwerkzeug bereitgestellt werden. Gablidone lässt sich dann auch nicht lange bitten: „Alle drei beteten, stimmten um 7 Uhr des Abends beim Betglockengeläute den 51. Psalm an – Magnanephton that wie immer vorher seine leise Beschwörung oder Citation – sie knieten alle drei, jeder eine Schnur oder Quaste, die an dem Rahmen des Gemäldes angemacht war, der auf einer Art von Staffelei stand, in der Hand haltend“. Noch mitten im Psalmengebet hören die drei Adepten plötzlich „einen Schlag wie einen Pistolenschuss. Dieser Schlag schlug den Pappendeckel hinter dem leinenen Tuch, das mit Papier überkleistert war, weg an den Boden. Nun hörten sie ein mächtiges Gezische und Geräusche in den Farbenmuscheln, die schnellen Striche des Pinsels und bemerkten, da die Lichter nahe bei dem Rahmen standen, durch das leinene Tuch, wie den Schatten einer kleinen Hand, die sich auf dem Tuche bewegte.“ Nachdem das Zischen verstummt ist, wagen sich die drei aus ihrer Deckung und gehen zur Staffelei – Gablidone hat tatsächlich ein mit Wasserfarben „schnell und kühn“ gemaltes Bild hinterlassen, das Porträt entspricht der Erwartungshaltung der drei: „ein gerade vor sich hinsehendes Sehergesicht, ein klein, rund, schwärzlich Käppchen auf dem Scheitel, dünne, zart und flüchtig gerollte Haare, ziemlich grosse, offene, ungestarrte Augen, eine markichte, aber nicht erhaben stylisierte Nase, einen nicht gemeinen, wohlgeschweiften Mund. Im Ganzen ist bei aller Rohheit, die bei Wasserfarben auf einem stehenden Blatte wohl nicht zu vermeiden war, das Gesicht wacker, keck, sehr natürlich und ganz anders gezeichnet, als es ein gemeiner, menschlicher Maler zeichnen würde. Die Höhe des Gesichtes ist ungefähr zwei Zoll, die Figur hat einen weissen, liegenden Kragen bis an’s Ende der Achsel, und einen schwarzen Rock. Von den Händen sieht man nichts.“

Offen für den Geisterspuk: Johann Caspar Lavater. Gemälde von Alexander Speisegger, 1785.
Thun, der den Geisterspuk weiter ernst nimmt, nimmt die Zeichnung im Juli 1781 mit nach Zürich zu Johann Caspar Lavater, mit dem er befreundet ist und dessen Ansichten zur Physiognomik er teilt. Die Gablidone-Brüderschaft ist inzwischen zerfallen, nach dem Tod des „Rechners Magnanephton“ findet sich kein entsprechend geschickter Schwindler mehr. Lavater zeigt sich von den Berichten Thuns jedoch angetan und stellt tatsächlich das verlangte „Protokoll“ zusammen. Seinem adeligen Freund aus Wien stellt er darin ein sorgfältig abgewogenes Zeugnis aus: „(Thun) war im Juli 1781 zu mir gekommen, und hatte sich etwa vierzehn Tage bei mir aufgehalten. Ein Mann von 46 Jahren, der sich allen und jeden Menschen, die ihn kennen lernten, durch seine Grossmüthigkeit, Natürlichkeit, Dienstbegierde und kurz durch seinen kindlichen Geist sogleich und mit jedem Augenblick mehr empfohlen hatte. Er ist weder ein ausserordentliches Genie, noch viel weniger ein eigentlicher Gelehrter. Sein Haupttalent ist Mechanik. Er hat eine gewisse gutherzige, sich nicht verbergende Eitelkeit, die aber nichts Drückendes hat. Sein Herz ist immer auf seiner Zunge. Es ist schlechterdings unmöglich, ihm böse zu sein, oder in seine Aufrichtigkeit ein Misstrauen zu setzen. Er scheint mir einer der liebenswürdigsten Etourdis (= leichtsinnigen Menschen, J. S.) zu sein, die alle Augenblicke Prise über sich geben, davon aber niemand, als ein determinirter Schurke oder abscheulicher Schiefkopf Gebrauch oder Missgebrauch machen kann.“
Zurück in Wien, verteilt Thun Abschriften des Protokolls an seine Freunde, kann jedoch nicht verhindern, dass es in unberufene Hände gelangt und 1787 unter dem Titel Lavater’s Protokoll über den Spiritus Familiaris Gablidone sogar in Druck erscheint. Die kuriose Schrift, von einem unbekannten Herausgeber mit einer Einleitung versehen, erregt bei den „Wissenden“, wie Brabbée schreibt, einiges Aufsehen, Thuns Name wird zwar durch drei Sterne ersetzt und kein einziges Mal erwähnt, die Wiener wissen jedoch, wer sich dahinter verbirgt. Mehr denn je gilt Thun in der Öffentlichkeit als seltsamer Schwärmer mit einem Hang zum Okkulten. Wie Ivo Cerman gezeigt hat, steht Thun möglicherweise auch in Kontakt mit einer neuen „Sekte“, die sich in den 1780er-Jahren in Wien bildet, den „Asiatischen Brüdern“. Der vollständige Name dieser Illuminaten-Gruppierung lautet „Orden der Ritter und Brüder St. Johannis des Evangelisten aus Asien und Europa“, ihre Instruktionen verfasst der Abenteurer Moses Dobruschka. Die Asiatischen Brüder zeichnen sich durch ihre tolerante Haltung gegenüber Juden aus und messen der Licht-Symbolik besondere Bedeutung zu. Einem Bericht des französischen Pamphletisten Luchet de la Roche du Maine zufolge sollen die Mitglieder des Ordens einem Orakel namens „Gablidone“ gefolgt sein – trifft dies zu, muss auch Thun bei den Asiatischen Brüdern eine Rolle gespielt haben!